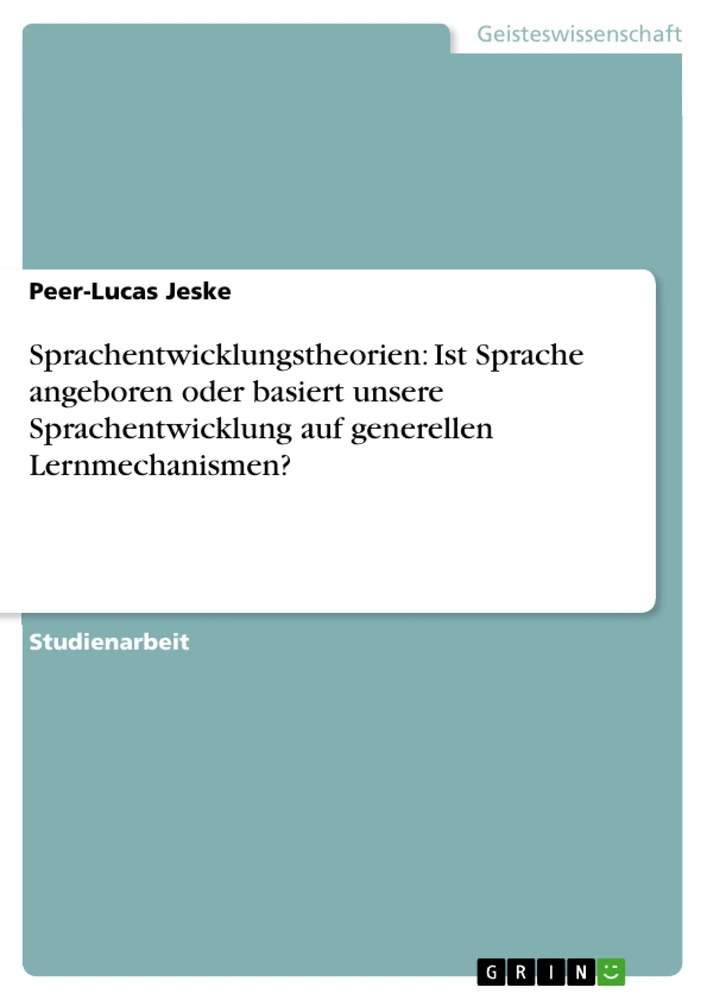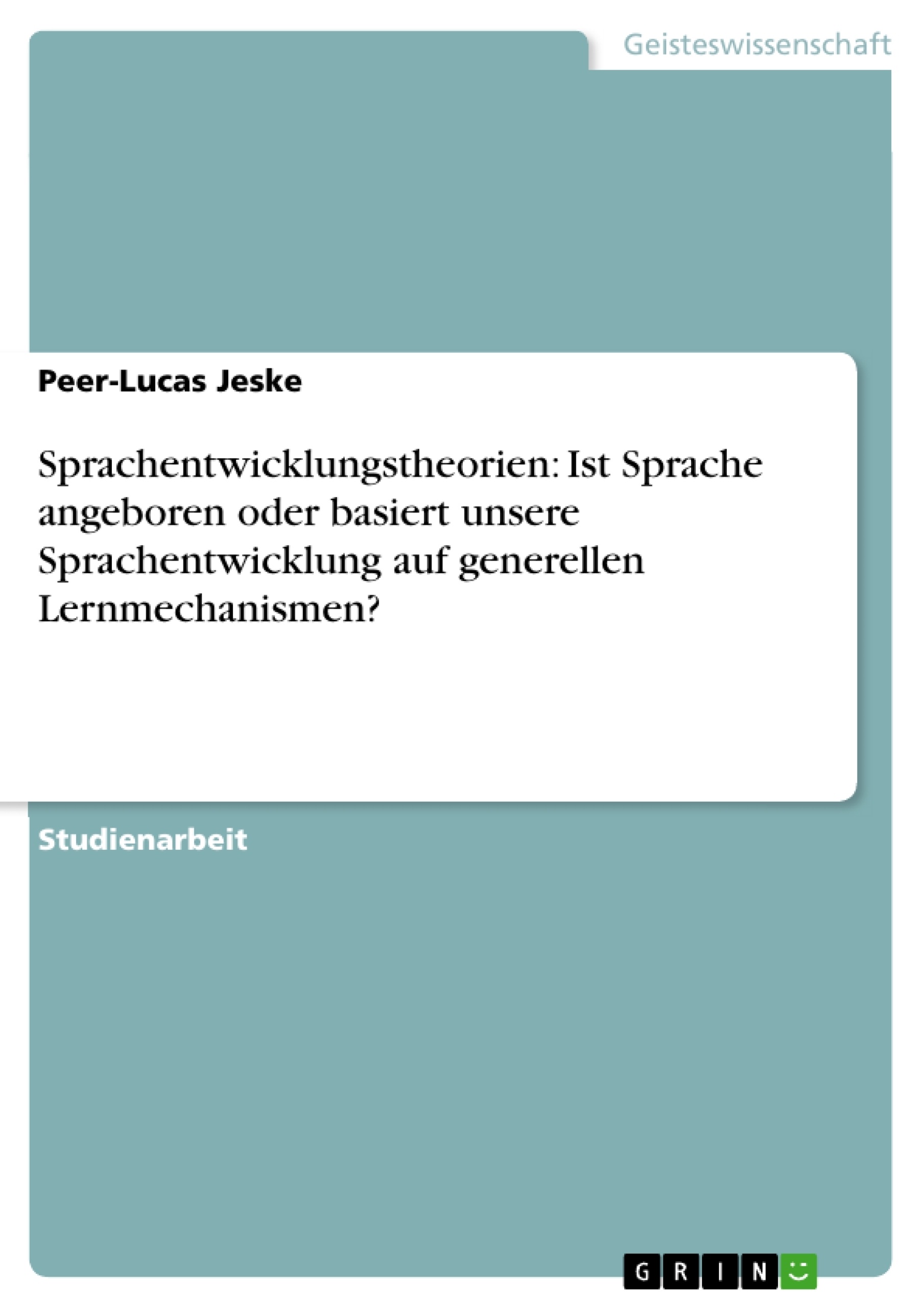Menschen kommunizieren auf vielfältige Weise mit ihrer Umwelt: durch Gestik, Mimik, Körperhaltung und auch Laute. Doch ab wann kann man von einer Sprache sprechen? Oft wird z.B. die Mitteilung von Emotionen durch Gestik als „Körpersprache“ bezeichnet, genauso wie das Bellen oder Schwanzwedeln eines Hundes oft als „Tiersprache“ bezeichnet wird. Sprache im engeren Sinn besitzt allerdings einige Eigenschaften, die sie von anderen Kommunikationswegen abhebt: Sie ist ein einzigartiges Kommunikationssystem, das bei keinem anderen Lebewesen als dem Menschen zu finden ist. Sie ermöglicht den Menschen trotz begrenztem Vokabular unendlich viele Ideen auszudrücken. Es kann sowohl über Anwesendes, als auch über weit Entferntes gesprochen werden. Die Gegenwart kann genauso Thema sein, wie die Vergangenheit oder sogar die Zukunft (Szagun, 2010).
Möglich wird das durch die Verwendung von akustischen Symbolen, die in jeder Sprache unterschiedlich sind und nach einem, von der jeweiligen Sprache abhängigen, hochkomplexen Regelsystem angewendet werden. Dieses Regelsystem beinhaltet unter anderem, wie Laute miteinander kombiniert werden um Worte zu bilden, wie Worte miteinander kombiniert werden um Sätze zu bilden, wie die Sprachmelodie und –rhythmik eingesetzt und letztendlich auch wie die Sprache in welchem Kontext verwendet werden kann (Szagun, 2010).
Trotz dieser Komplexität gilt es als selbstverständlich Sprache zu erlernen und obwohl sie in diesem Alter im Hinblick auf abstrakte Problemlösefähigkeiten noch sehr eingeschränkt entwickelt sind, lernen fast alle Kinder bis zu ihrem fünften Lebensjahr die grundlegenden Regeln ihrer Muttersprache (Weinert & Grimm, 2008). Zwei große Theoriegruppen versuchen zu erklären, welche Mechanismen hinter diesem faszinierenden Prozess des Spracherwerbs stehen. Die eine geht davon aus, dass Sprache eine angeborene Fähigkeit des Menschen ist, grammatische Strukturen also von Geburt an vorhanden sind, während die andere den Spracherwerb als einen Lernprozess darstellt (Weinert & Grimm, 2008).
Diese Arbeit versucht sich der Frage anzunähern, welche dieser Mechanismen dem Spracherwerb tatsächlich zugrunde liegen: Ist uns Sprache angeboren oder basiert unsere Sprachentwicklung auf generellen Lernmechanismen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Voraussetzungen für den Spracherwerb
- 2.1 Neuronale Voraussetzungen
- 2.2 Voraussetzungen in der sozialen Umwelt
- 3. Die Entwicklung der einzelnen Sprachkomponenten
- 3.1 Die prosodisch-phonologische Komponente
- 3.2 Die lexikalische Komponente
- 3.3 Die syntaktische Komponente
- 3.4 Die pragmatische Kompetenz
- 4. Erklärungsansätze der Sprachaquisitionsprozesse
- 4.1 Inside-Out-Theorien
- 4.2 Outside-In-Theorien
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Sprache eine angeborene Fähigkeit des Menschen ist oder ob sie durch Lernen erworben wird. Sie analysiert die Voraussetzungen für den Spracherwerb, sowohl im Hinblick auf die neuronalen Strukturen als auch die soziale Umwelt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der einzelnen Sprachkomponenten und stellt die beiden großen Theoriefamilien zur Erklärung des Spracherwerbs vor: Inside-Out-Theorien, die von einer angeborenen grammatischen Ausstattung ausgehen, und Outside-In-Theorien, die den Spracherwerb als einen Lernprozess verstehen.
- Neuronale und soziale Voraussetzungen für den Spracherwerb
- Entwicklung der einzelnen Sprachkomponenten (prosodisch-phonologische, lexikalische, syntaktische und pragmatische)
- Inside-Out-Theorien und Outside-In-Theorien zur Erklärung des Spracherwerbs
- Empirische Befunde zur Überprüfung der Theorien
- Abwägung der verschiedenen Erklärungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Der Text führt in das Thema der Sprachentwicklung ein. Es werden die Besonderheiten der menschlichen Sprache im Vergleich zu anderen Kommunikationssystemen erläutert, wie die Generativität und die Fähigkeit, über Dinge zu sprechen, die nicht im unmittelbaren Kontext vorhanden sind. Die Einleitung beschreibt außerdem, dass der Spracherwerb trotz seiner Komplexität ein natürlicher Prozess ist, der bei den meisten Kindern bis zum fünften Lebensjahr abgeschlossen ist. Die beiden großen Theoriefamilien, die versuchen, den Spracherwerb zu erklären (Inside-Out-Theorien und Outside-In-Theorien), werden vorgestellt und die Fragestellung der Arbeit wird formuliert.
2. Voraussetzungen für den Spracherwerb
Dieses Kapitel beleuchtet die Voraussetzungen für den Spracherwerb. Es wird die Bedeutung von neuronalen Strukturen für die Sprachentwicklung sowie die Rolle der sozialen Umwelt beim Erwerb der Sprache untersucht. Das Kapitel vertieft die Ausführungen der Einleitung und verdeutlicht, welche Faktoren für den erfolgreichen Spracherwerb entscheidend sind.
3. Die Entwicklung der einzelnen Sprachkomponenten
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der einzelnen Sprachkomponenten: die prosodisch-phonologische Komponente, die lexikalische Komponente, die syntaktische Komponente und die pragmatische Kompetenz. Es werden wichtige Meilensteine und Entwicklungsverläufe der einzelnen Bereiche des Spracherwerbs beschrieben.
4. Erklärungsansätze der Sprachaquisitionsprozesse
Das Kapitel stellt die beiden großen Theoriefamilien zur Erklärung des Spracherwerbs vor: Inside-Out-Theorien und Outside-In-Theorien. Es werden die wichtigsten Vertreter der beiden Theorien sowie deren Grundannahmen und Argumentationslinien dargestellt. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Stärken und Schwächen der Theorien.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Sprachentwicklung, Inside-Out-Theorien, Outside-In-Theorien, neuronale Voraussetzungen, soziale Umwelt, prosodisch-phonologische Entwicklung, lexikalische Entwicklung, syntaktische Entwicklung, pragmatische Kompetenz, Generativität, Kommunikationssystem, empirische Befunde.
- Arbeit zitieren
- Peer-Lucas Jeske (Autor:in), 2012, Sprachentwicklungstheorien: Ist Sprache angeboren oder basiert unsere Sprachentwicklung auf generellen Lernmechanismen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202993