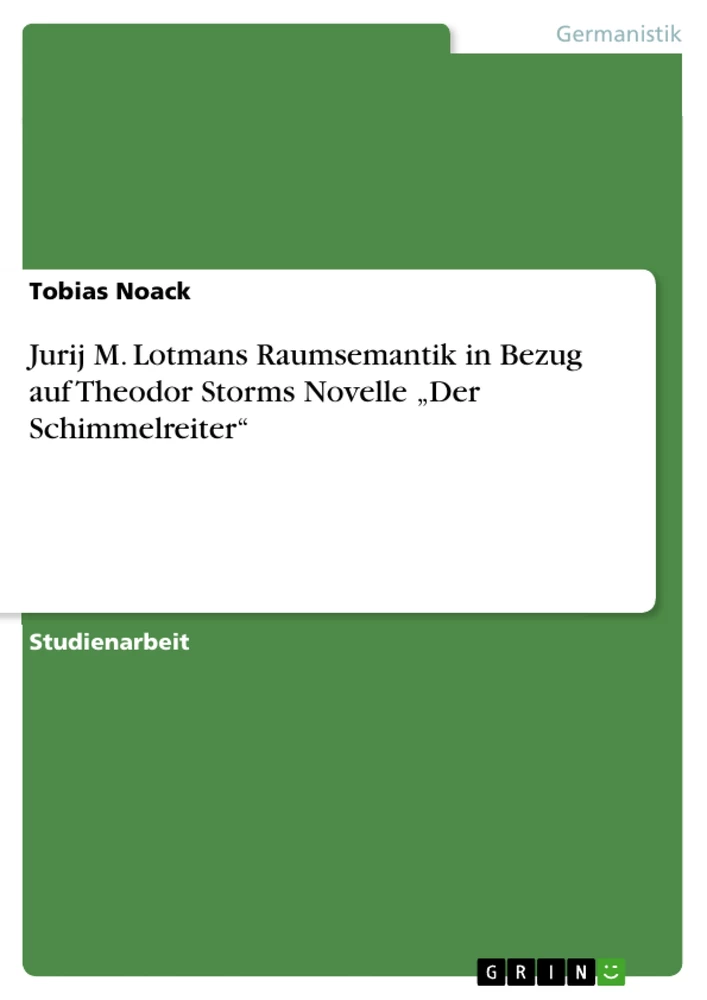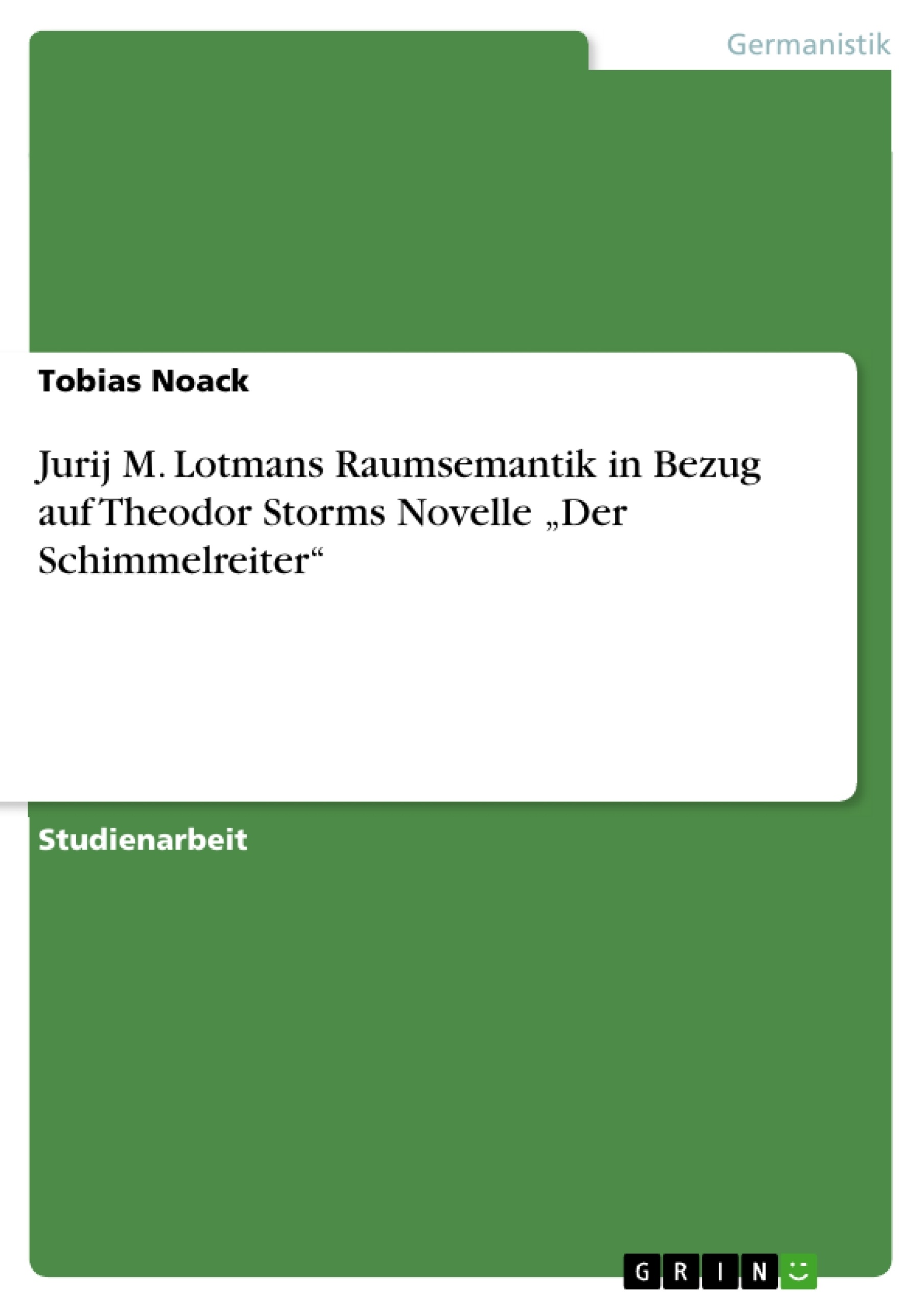Diese Arbeit setzt sich mit der Raumtheorie von Jurij M. Lotman auseinander. Anhand der Novelle "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm wurden die verschiedenen semantischen Räume und das zentrale Ereignis durch die Grenzüberschreitung des Protagonisten herausgearbeitet. Der Schlussteil setzt sich mit dem Konzept von Michael Titzmann auseinander, der in seiner Arbeit von Grenztilgung und einem Metaereignis spricht. Markiert die Novelle "Der Schimmelreiter" einen Konventionsverstoß zwischen Realismus und Früher Moderne indem es in dieser zu einem "Metaereignis" kommt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Novelle „Der Schimmelreiter" als Analysegegenstand der Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman
- Metaereignis in „Der Schimmelreiter"'?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Novelle „Der Schimmelreiter" von Theodor Storm unter Verwendung der Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman. Ziel ist es, die verschiedenen semantischen Räume und Grenzüberschreitungen in der Novelle zu identifizieren und zu analysieren, um die narrative Struktur und die Bedeutung des Aberglaubens und Mythos des Schimmelreiters zu erforschen.
- Semantische Räume und Grenzüberschreitungen in „Der Schimmelreiter"
- Die Rolle des Deiches als topografische Grenze zwischen Natur und Kultur
- Die Oppositionen „alt vs. neu", „arm vs. reich" und „ungebildet vs. gebildet" in der Novelle
- Der Deichbruch als zentrales Ereignis und seine Auswirkungen auf die semantische Ordnung
- Die Frage nach einem möglichen Metaereignis in „Der Schimmelreiter"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Novelle „Der Schimmelreiter" als Analysegegenstand vor und führt in die Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman ein. Sie beleuchtet die historische und literarische Bedeutung der Novelle und die besondere Relevanz des Themas des Aberglaubens und des Schimmelreiters.
- Die Novelle „Der Schimmelreiter" als Analysegegenstand der Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman: Dieses Kapitel erläutert die Theorie von Jurij M. Lotman und ihre Anwendung auf die Novelle. Es werden die zentralen Konzepte der Theorie, wie semantische Räume, Grenzen und Ereignisse, erklärt und auf die Figuren und Handlungselemente in „Der Schimmelreiter" angewandt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman, semantische Räume, Grenzüberschreitung, Deichbau, Aberglaube, Mythos, Schimmelreiter, „Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, Realismus, Metaereignis, Grenztilgung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von "Der Schimmelreiter"?
Die Arbeit analysiert Theodor Storms Novelle mithilfe der Raumtheorie und Grenzziehungstheorie von Jurij M. Lotman.
Welche Rolle spielt der Deich in dieser Untersuchung?
Der Deich wird als topografische Grenze zwischen Natur und Kultur interpretiert, die für die semantische Ordnung der Novelle zentral ist.
Was versteht man unter dem "Metaereignis" in diesem Kontext?
Es wird untersucht, ob der Deichbruch und die Grenzüberschreitung des Protagonisten ein Metaereignis darstellen, das einen Konventionsverstoß zwischen Realismus und Früher Moderne markiert.
Welche Gegensätze werden in der Novelle analysiert?
Die Arbeit untersucht Oppositionen wie "alt vs. neu", "arm vs. reich" und "ungebildet vs. gebildet".
Wer ist Jurij M. Lotman?
Lotman ist ein Theoretiker, dessen Konzepte der semantischen Räume und Grenzüberschreitungen hier zur Erforschung der narrativen Struktur genutzt werden.
- Arbeit zitieren
- Tobias Noack (Autor:in), 2012, Jurij M. Lotmans Raumsemantik in Bezug auf Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202952