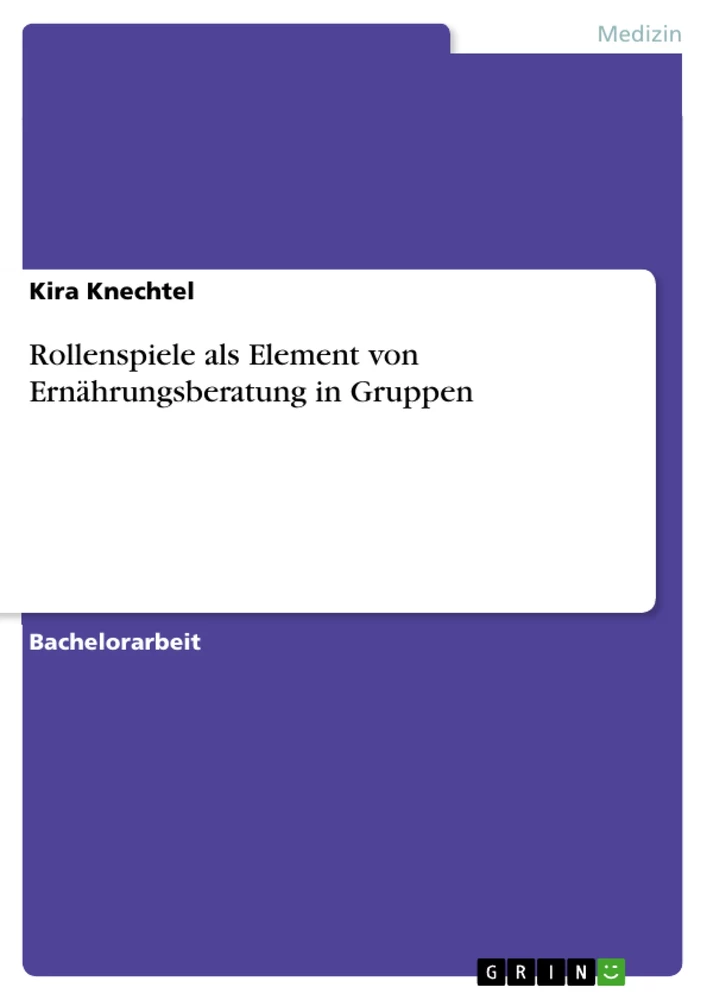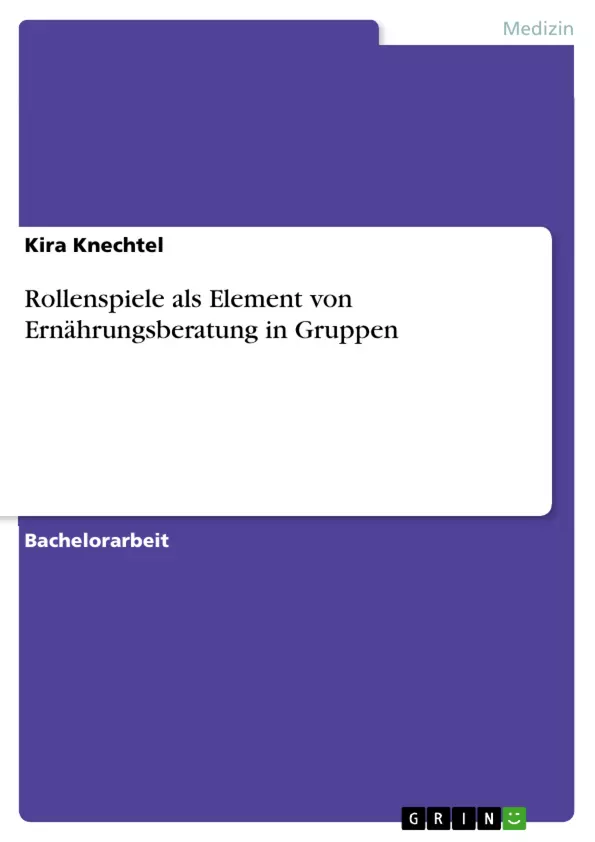Häufig werden Menschen überraschend mit neuartigen und komplexen Ernährungsproblemen konfrontiert. Bei der Ernährungsberatung ist es wichtig zielgruppenorientiert vorzugehen und dabei den Lebenskontext der Betroffenen zu berücksichtigen. Am besten eignen sich Menschen ein dauerhaft gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten durch soziales Lernen an. Eine Möglichkeit hierzu stellen Institutionen von Gesprächsgruppen in Verbindung mit handlungsorientierter Ernährungsberatung dar. Dabei sollten Lösungswege für Ernährungsprobleme gemeinsam erarbeitet, praktisch eingeübt und erprobt werden. In der Realität steht jedoch noch zu sehr eine abstrakte Vermittlung von ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen sowie die Erteilung von Ratschlägen im Vordergrund. Allerdings führt eine ausschließlich auf Wissensvermittlung ausgerichtete Beratung zu keiner Verhaltensänderung, da Wissen allein nicht automatisch eine gesunde Ernährung nach sich zieht. Die Bevölkerung reagiert auf Belehrungen oder Bevormundungen mit Desinteresse oder Kritik. Ebenso scheitert Ernährungskommunikation prinzipiell, da der Berater und der Ratsuchende ein anderes Bild von Ernährung haben und aneinander vorbeireden. Der Experte spricht von Ernährung und der Rezipient von Essen. Jedoch ist die Art der Umsetzung und Integration in den Alltag alles andere als einheitlich und vor allem breiter angelegt, als die üblichen Ernährungsempfehlungen. Es geht hier nicht um eine Veränderung der täglichen Speisen, sondern um eine andere Art des Lebensstils. Essen ist integraler Bestandteil des Alltags, der von jedem selbst gestaltet wird. Die Beratungssituation ist immer eine kurzfristige Ausnahmesituation, in der die eigentliche Problemlösung nicht realisierbar ist. Die betroffene Person muss dies selbst in ihrem gewohnten Lebensumfeld erproben, damit der Entscheidungskonflikt, der im Beratungszimmer als gelöst erscheint, auch im Alltag und sozialem Umfeld gelöst bleibt. Es geht also nicht darum Verhaltensprobleme theoretisch zu lösen, sondern es muss gemeistert werden, auch wenn der Klient sich alleine in emotional belasteten Situationen befindet. Die Vermittlung von handlungsorientiertem Wissen ist eine Seite, die andere ist die Einübung des Verhaltens. Zu überlegen ist, den praktischen Anteil in der Ernährungsberatung durch den Einsatz von Rollenspielen zu erhöhen. Die Teilnehmer können durch Rollenspiele neue Verhaltensmuster ausprobieren und erlernen...
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Ernährungsberatung in Gruppen
2.2 Definition Rolle
2.3 Rollenspiel
2.3.1 Rollenspieltypen
2.3.2 Abgrenzung des Rollenspiels zu anderen Spielformen
2.3.4 Artefakte
2.3.5 Verlauf des Rollenspiels
2.3.6 Spielleiterqualifikationen und Funktion
3 Transfer der Anwendung von Rollenspielen auf die Ernährungsberatung von Gruppen
3.1 Parallelen der beiden Methoden
3.2 Diskussion der Vor- und Nachteile
4 Fazit
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- B.sc Kira Knechtel (Author), 2011, Rollenspiele als Element von Ernährungsberatung in Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202666