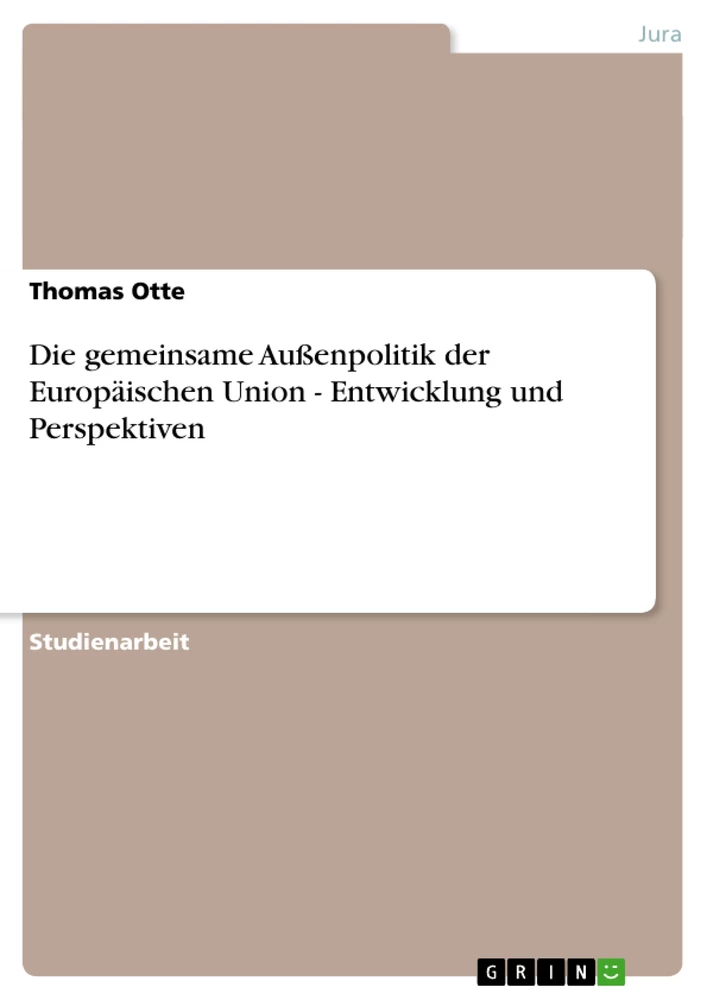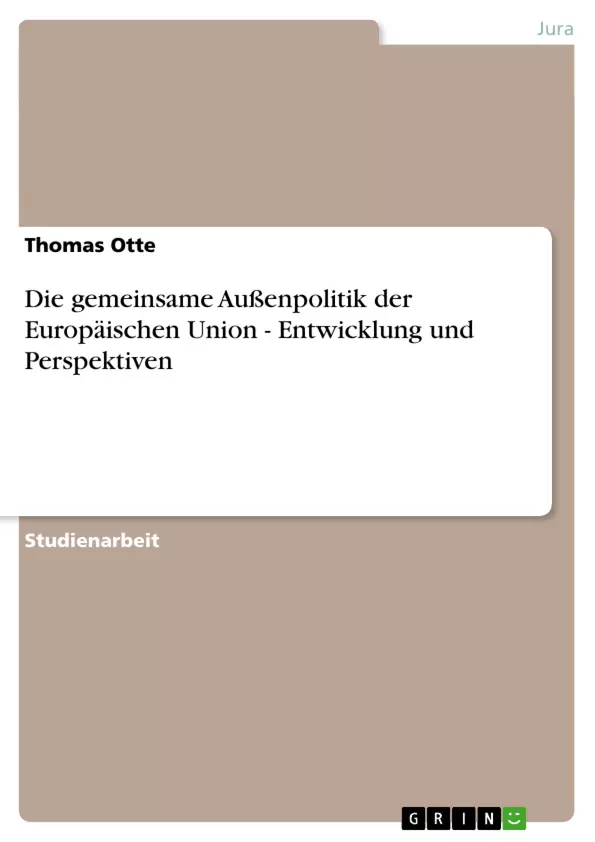Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) waren sich führende Kräfte in Europa darüber im Grundsatz einig, dass es notwendig sein würde, dass das Nachkriegseuropa die einfache Rekonstruktion der einzelstaatlichen Vorkriegsstrukturen vermeiden müsse.
Verschiedenste Personen und Gruppierungen forderten als Konsequenz aus teilweise Jahrhunderte währenden zwischenstaatlichen Feindschaften u.a. eine gemeinsame europäische Regierung, ein Parlament und eine Armee. Bereits 1946 sprach sich der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill dafür aus, dass ein „Europarat“ als Vorstufe zur Entstehung der „Vereinigten Staaten von Europa“ gebildet werden sollte.
Diese Ansätze führten 1949 zur Gründung des Europarates. Am 27.07.1952 trat der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS/Montanunion) in Kraft. Die Römischen Verträge, welche die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) umfassen, traten zum 1.1.1958 in Kraft. EWG, EURATOM und EGKS bildeten zusammen die Europäischen Gemeinschaften (EG). An diese supranationalen Organisationen traten die Mitgliedsstaaten Hoheitsrechte ab. Somit schlossen sich die europäischen Staaten, im Übrigen zumeist auf deutsch-französische Initiative hin, zumindest im wirtschaftlichen Bereich enger zusammen. Dies geschah auch unter dem Aspekt, den beträchtlichen Schaden des Krieges gemeinsam zu beheben.
Auf anderen Gebieten wurden jedoch weniger Fortschritte erreicht. So kam eine Zusammenarbeit auf außen- und verteidigungspolitischer Ebene nicht zustande. Die geplante Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) sowie die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) konnten (bis auf den Wirtschaftsbereich) nicht realisiert werden. Jedoch wurde auf verteidigungspolitischer Ebene 1954, hervorgehend aus der 1948 gegründeten Westunion, die Westeuropäische Union (WEU) gegründet. Ziel der WEU ist die Gewährleistung der Sicherheit der Mitgliedstaaten durch automatischen Beistand. Die WEU soll den europäischen Pfeiler der NATO bilden.7 De facto war die Bedeutung der WEU neben der NATO eher als gering einzuschätzen.
Inhaltsverzeichnis
- Europäische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Einheitliche Europäische Akte
- Der Vertrag von Maastricht
- Die Entstehung der GASP im Vertrag von Maastricht
- Inhalt und Ziel der GASP
- Der Vertrag von Amsterdam und der EU-Gipfel von Nizza
- Die ersten Bewährungsproben der GASP
- Gemeinsame Aktionen im Rahmen der GASP
- Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien
- Der Kosovo-Konflikt
- Die EU-Friedensmission in Mazedonien
- Das Scheitern der GASP - der Irak-Krieg 2003
- Perspektive für die Zukunft - der europäische Verfassungskonvent
- Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union (EU) von ihren Anfängen bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie untersucht die wichtigsten Meilensteine, wie die Einheitliche Europäische Akte, den Vertrag von Maastricht und die ersten Bewährungsproben der GASP in internationalen Krisen. Darüber hinaus wird auf die Herausforderungen und das Scheitern der GASP im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg 2003 eingegangen und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der europäischen Außenpolitik gegeben.
- Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Wichtige Meilensteine der GASP
- Bewährungsproben der GASP in internationalen Krisen
- Herausforderungen und das Scheitern der GASP im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg 2003
- Zukünftige Entwicklung der europäischen Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der europäischen Außenpolitik im Kontext des Zweiten Weltkriegs und der darauf folgenden Integrationsprozesse. Es werden wichtige Meilensteine wie die Gründung des Europarates, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die Römischen Verträge erwähnt, die zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) führten. Das Kapitel betont die Herausforderungen, die mit der Koordinierung der europäischen Außenpolitik in dieser frühen Phase verbunden waren.
Im zweiten Kapitel wird die Einheitliche Europäische Akte (EEA) als ein entscheidender Schritt hin zu einer stärkeren politischen Integration Europas vorgestellt. Es wird die Bedeutung der EEA für die Entwicklung der GASP hervorgehoben, insbesondere die völkerrechtliche Basis für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in außenpolitischen Fragen.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Vertrag von Maastricht und der Entstehung der GASP als zweite „Säule“ der Europäischen Union. Es wird die Bedeutung der GASP für die gemeinsame Außenpolitik der EU und die Ziele, die mit ihrer Einführung verfolgt wurden, beschrieben. Die Rolle des Vertrags von Amsterdam und des EU-Gipfels von Nizza für die Weiterentwicklung der GASP werden ebenfalls erwähnt.
Das vierte Kapitel behandelt die ersten Bewährungsproben der GASP im Rahmen der internationalen Krisen der 1990er Jahre. Es werden konkrete Beispiele für gemeinsame Aktionen der EU im Rahmen der GASP, wie den Krieg im ehemaligen Jugoslawien und den Kosovo-Konflikt, analysiert. Die EU-Friedensmission in Mazedonien wird ebenfalls erwähnt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Scheitern der GASP im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg 2003. Die Gründe für das Scheitern und die Auswirkungen auf die europäische Außenpolitik werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Einheitliche Europäische Akte (EEA), Vertrag von Maastricht, internationale Krisen, Irak-Krieg 2003, europäische Integration, politische Zusammenarbeit, völkerrechtliche Basis, gemeinsame Aktionen, Bewährungsproben, Herausforderungen.
- Quote paper
- Thomas Otte (Author), 2003, Die gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union - Entwicklung und Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20256