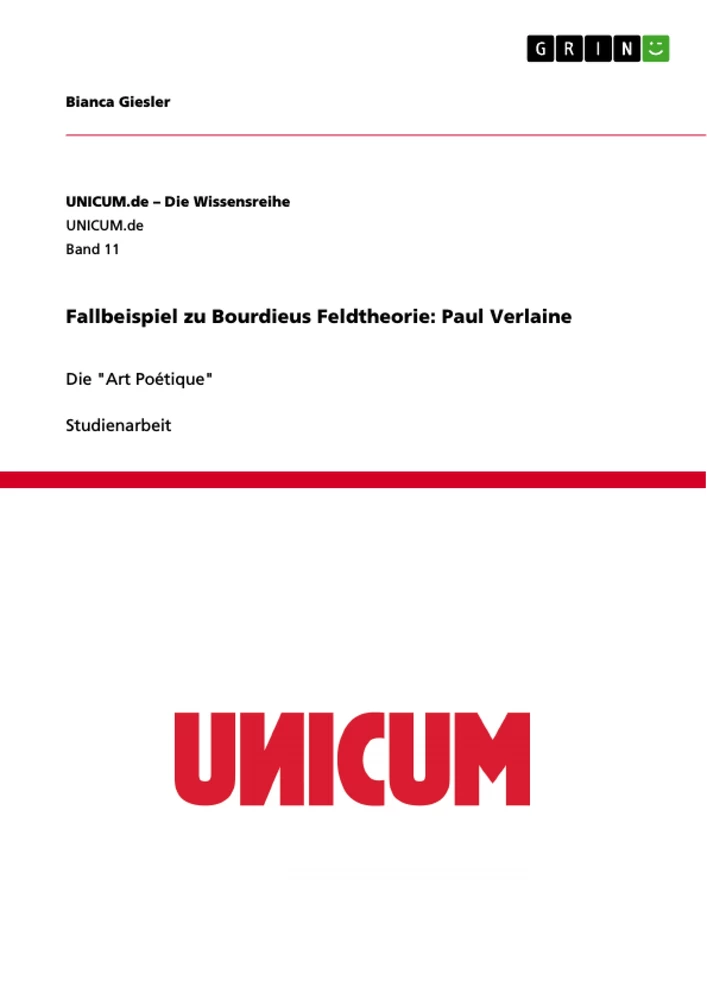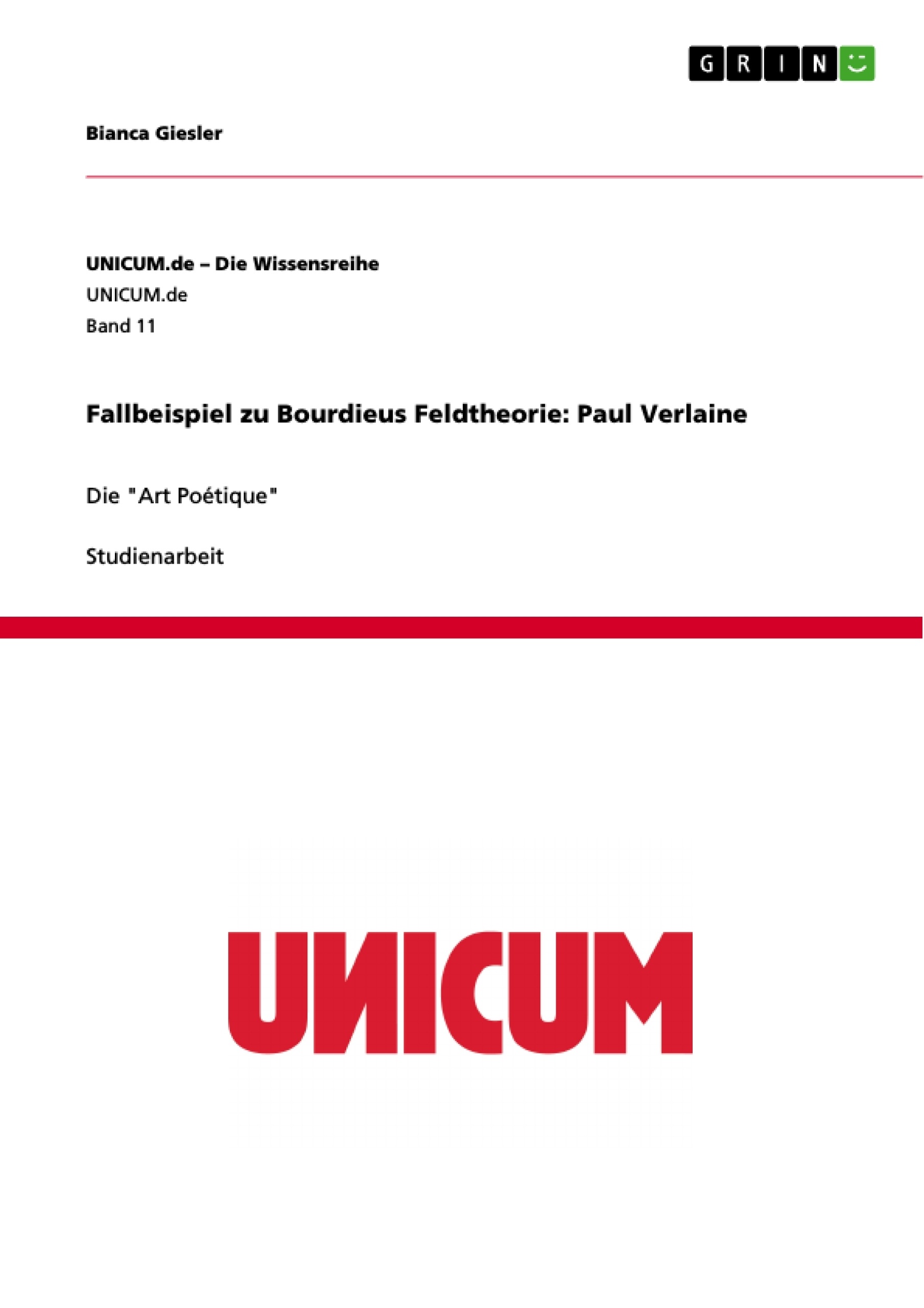Inhaltsverzeichnis
Einleitung…………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Die Symbolisten…………………………………………………………………………………………………………………. 4
Das Werk im Detail………………………………………………………………………………………………………….... 6
Fazit…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Bibliographie……………………………………………………………………………………………………………………… 10
Anhang: Gedicht inkl. Übersetzung und Interpretation.…………………………………………………….. 11
Einleitung
Die traditionelle Literaturwissenschaft hat sich lange Zeit auf die ideographische Analyse von Einzelfällen beschränkt, die Werke sozusagen als Ausdruck einer „kreativen“ Individualität in ihrer Einzigartigkeit angesehen. Der daraus resultierende kritische Ansatz konzentrierte sich einzig auf das Werk als Untersuchungsgegenstand – gemäß einer internen Ästhetik, die vorschreibt das Werk als System zu sehen, das in sich selbst, in seiner Kohärenz, die für das Verständnis nötigen Prinzipien und Normen enthält. Dabei wird allerdings das soziokulturelle System, von dem das Werk umgeben ist, ausgeschlossen. Die Literatursoziologie versucht genau diese Lücke zu schließen und die Werke im Zusammenhang mit den ökonomischen, sozialen und kulturellen Umständen ihrer Entstehung zu sehen. Dieser non-dialektische Ansatz, der im Werk eine direkte Spiegelung von gegebenen sozio-ökonomischen Umständen sieht, vernachlässigt jedoch die Existenz der zahlreichen Zwischenstufen zwischen der Infrastruktur und dem eigentlichen kulturellen Produkt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Symbolisten
Das Werk im Detail
Fazit
Bibliographie
Anhang: Gedicht inkl Übersetzung und Interpretation
Einleitung
Die traditionelle Literaturwissenschaft hat sich lange Zeit auf die ideographische Analyse von Einzelfällen beschränkt, die Werke sozusagen als Ausdruck einer „kreativen“ Individualität in ihrer Einzigartigkeit angesehen. Der daraus resultierende kritische Ansatz konzentrierte sich einzig auf das Werk als Untersuchungsgegenstand – gemäß einer internen Ästhetik, die vorschreibt das Werk als System zu sehen, das in sich selbst, in seiner Kohärenz, die für das Verständnis nötigen Prinzipien und Normen enthält. Dabei wird allerdings das soziokulturelle System, von dem das Werk umgeben ist, ausgeschlossen. Die Literatursoziologie versucht genau diese Lücke zu schließen und die Werke im Zusammenhang mit den ökonomischen, sozialen und kulturellen Umständen ihrer Entstehung zu sehen. Dieser non-dialektische Ansatz, der im Werk eine direkte Spiegelung von gegebenen sozio-ökonomischen Umständen sieht, vernachlässigt jedoch die Existenz der zahlreichen Zwischenstufen zwischen der Infrastruktur und dem eigentlichen kulturellen Produkt.
Erst eine kritische Systematisierung von Wissen erlaubt eine mögliche Kontinuität oder Brüche zu erkennen. Der Begriff ‚Feld‘ soll dabei die Existenz sozialer Mikrokosmen, getrennter und relativ autonomer Räume in Erinnerung rufen. Zwischen allen Feldern, auch dem bisher als Sonderfall behandelten ökomischen Feld, herrschen strukturale und funktionale Homologien. Die vielfältigen Verknüpfungen, die so zum Untersuchungsgegenstand werden, beschreibt Bourdieu selbst als „maßlos“. Es müsse bei jeder Analyse nach seiner Theorie ein mehr oder weniger willkürlicher Schlusspunkt gesetzt werden, auch wenn die provisorischen Ergebnisse so nur eine Richtung vorgeben können. Relativ ist diese Autonomie im Verhältnis zum Feld der Macht wegen des (zumindest von Seiten des literarischen Feldes) unbeabsichtigten Ausgleichs von Angebot und Nachfrage. Das literarische Feld produziert eigentlich zum Selbstzweck und sucht nicht eine bewusste Anpassung an Käuferinteressen. Diese Koinzidenz verschiebt jedoch temporär die Beziehung des literarischen Feldes und dem Feld der Macht.
Bourdieu kritisiert, dass Literaturwissenschaft sich dogmatisch auf literarische Theorien und Traditionen beruft, von denen keine den Blick über den eigenen Tellerrand wagt; das Produktionsfeld und die Beziehungen, d.h. die gesellschaftlichen Bedingungen der Produktion, werden schlicht ignoriert. Gesellschaftliche Formationen finden aber sehr wohl einen indirekten, ästhetisch übersetzen Ausdruck in der kulturellen Produktion. Um diesen neuen Code richtig zu verstehen und einzuordnen, ist ein weiterer Blick unabdingbar. Mit anderen Worten: Erst wenn man das literarische Feld im System objektiver Beziehungen begreift, also in der Interdependenz und Konkurrenz zu anderen Feldern, lassen sich wirklich Erkenntnisse darüber gewinnen. Interne, d.h. werkimmanente und externe, d.h. sozialwissenschaftliche Interpretation eines Werkes stehen sich so nicht mehr alternativ gegenüber, sondern ergänzen sich zu einer Gesamtanalyse. Der soziale Determinismus, dessen Spuren am Kunstwerk offenbar werden, entsteht nach dieser Konzeption auf zweierlei Weise: Zum einen durch den Habitus des Produzenten, der auf die gesellschaftlichen Umstände seiner Kreation sowohl als soziales Subjekt (Familie etc.) als auch als Produzent (Schule, berufliche Kontakte etc.) verweist, zum anderen durch die Anforderungen und sozialen Zwänge, die mit der eingenommenen Position innerhalb des Feldes verbunden sind.
Das literarische Feld ist gleichsam die Kampfstätte für die Position eines Autors; über Anerkennung bzw. Ablehnung wird definiert, wer sich als ‚Schriftsteller‘ bezeichnen darf. Das liegt daran, das ‚Dichter‘, ‚Schriftsteller‘ etc. abstrakte Begriffe sind, die selbst Bestandteil der zu interpretierenden Wirklichkeit sind. Ähnlich wie bei Platons Höhlengleichnis sind sie nur Schatten und somit als Werkzeug der Klassifizierung ungeeignet. Das Resultat sind hierarchische Strukturen und Konkurrenzkämpfe, die in einer globalen Analyse zu berücksichtigen sind. Diejenigen, die ein spezifisches symbolisches Kapital inne haben und somit die Grundlage von Macht bzw. Autorität innerhalb des Feldes sind gezwungen Strategien der Konservierung zu entwickeln und die Orthodoxie zu verteidigen; auf der anderen Seite sind diejenigen, die über weniger symbolisches Kapital verfügen gezwungen, subversive Strategien zu entwickeln und eine häretische Position einzunehmen. Der Nichterfolg eines Autors bleibt dennoch ambivalent: Wenig Publikum kann als Gütesiegel für die Qualität des Werks inszeniert werden oder tatsächlich Ausdruck von Talentlosigkeit sein (poète maudit vs. poète raté). Für die Beurteilung des Autors ist der Begriff des ‚Habitus‘ von zentraler Bedeutung. Bourdieu definiert den Habitus als „etwas Erworbenes und zugleich ein ‚Haben‘ […], das manchmal als Kapital funktionieren kann“. Das bedeutet, dass alles, was zu der aktuellen Position eines Autors innerhalb des literarischen Feldes geführt hat, eventuell Ausdruck in seinen Werken findet und gesondert zu untersuchen ist. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang von Positionierung, d.h. dem kulturellen Ausdruck der eigenen Position. Der Autor ist nicht mehr nur als charismatischer Kulturproduzent zu sehen, sondern auch als Kulturrezipient, der selbst einen Einfluss erlebt hat. Erst in diesem Bewusstsein kann man als Literaturwissenschaftler die verschiedenen Standpunkte eines Werkes bzw. seines Autors nachvollziehen.
Zusammengefasst definiert Bourdieu das ‚Feld‘ also als Projektionsfläche mit einer literarischen Vorgeschichte und kodifizierten Spielregeln, an denen auch gesellschaftliche Einflüsse gebrochen werden und ästhetisch übersetzt wieder Ausdruck in kulturellen Werken finden. Eine fundierte Analyse kultureller Werke setzt daher drei Schritte voraus:
1. Die Untersuchung der Position des literarischen Feldes innerhalb des Feldes der Macht und deren Entwicklung
2. Die Analyse der inneren Struktur des literarischen Feldes (Positionen und Beziehungen von Autoren, Gruppen etc.)
3. Die Untersuchung der Genese des Habitus der Inhaber dieser Position (Ergebnis des gesellschaftlichen Werdegangs)
Diese Punkte sollen exemplarisch an Paul Verlaines Gedicht Art poétique und dessen Bedeutung für die Gruppe der Symbolisten zur Zeit der Jahrhundertwende untersucht werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Bianca Giesler (Autor:in), 2008, Fallbeispiel zu Bourdieus Feldtheorie: Paul Verlaine, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202022