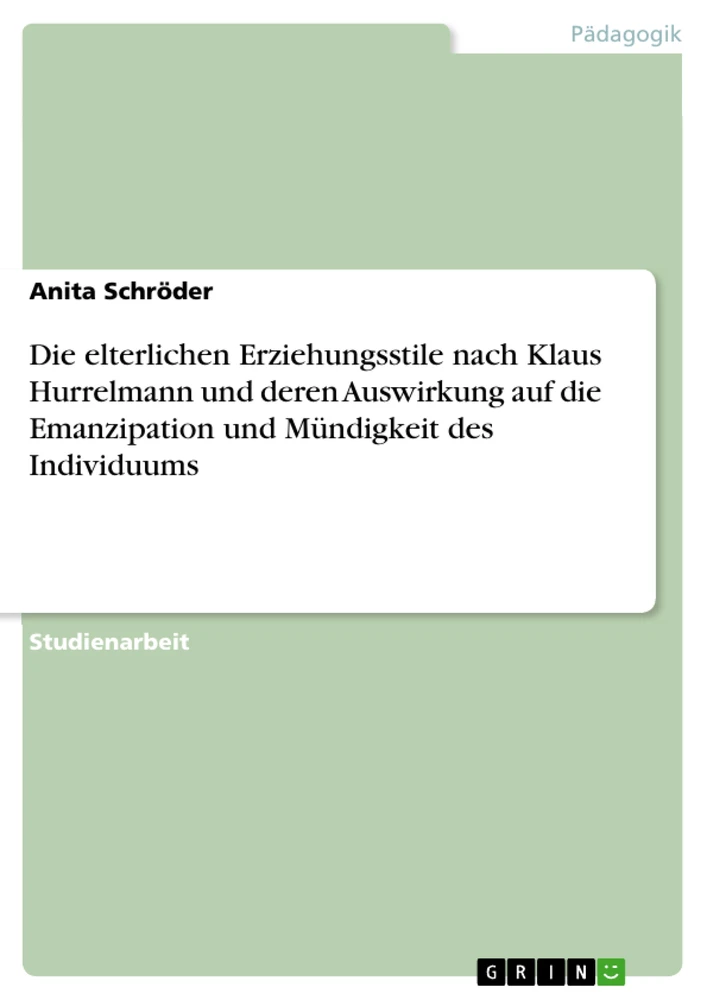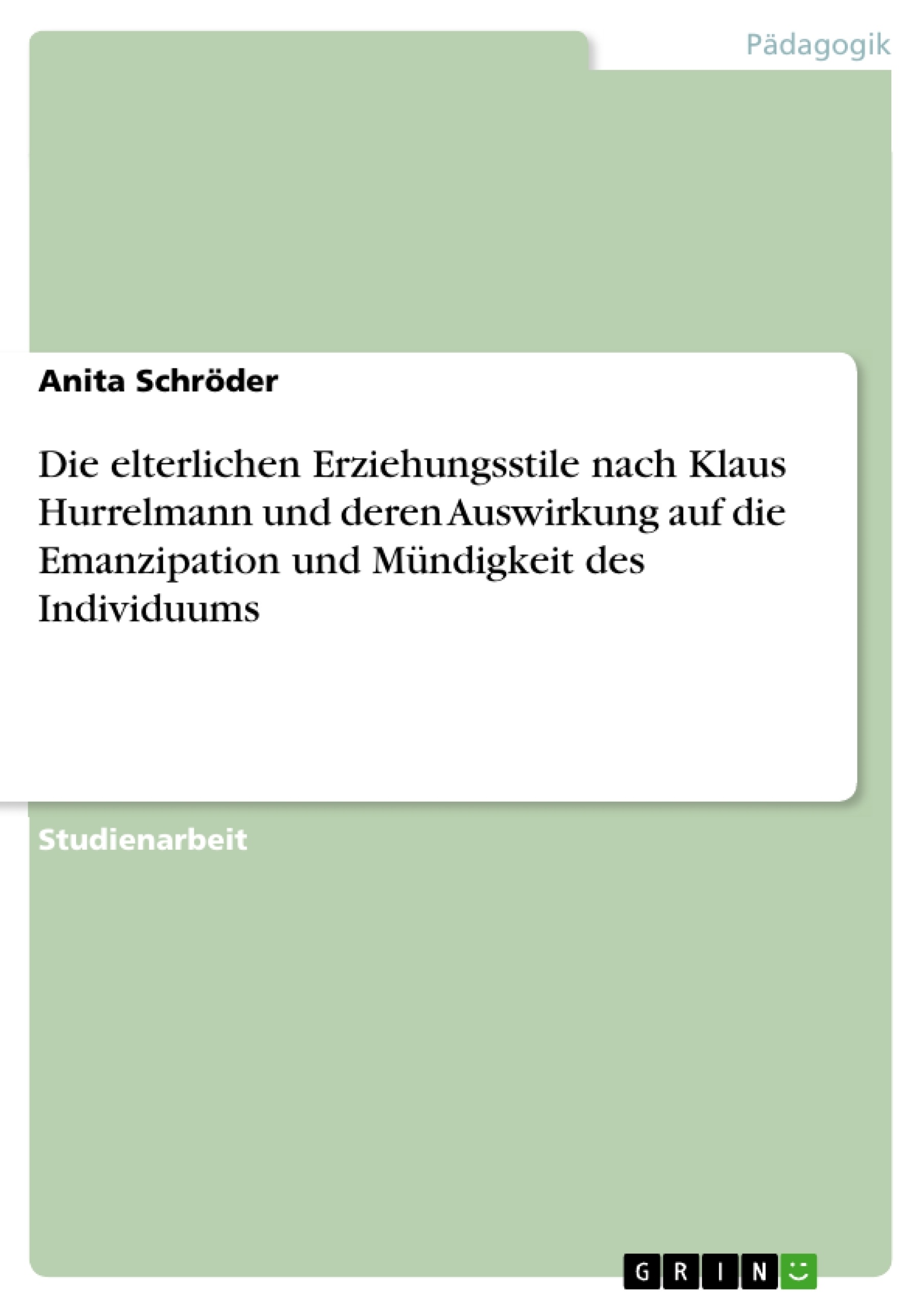Welcher Erziehungsstil bzw. welche Erziehungsmethode ist die beste für mein Kind? Wie viele Grenzen sollte man seinem Kind setzen? Hat die Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse nicht oberste Priorität? Diese Fragen stellen sich viele Eltern, die ihr Kind zu einem selbstständig lebensfähigen Menschen heranziehen wollen.
Mit dem Wandel der Zeit haben sich auch die Erziehungsstile verändert. Während früher vermehrt auf einen sehr autoritären Stil gepocht wurde mit Strenge und Disziplin, werden heutzutage meist weniger Grenzen gesetzt und eher auf die Selbstentfaltung und die Bedürfnisse des Kindes geachtet. Viele Eltern wollen das Beste für ihr Kind, dass es gehegt und geliebt wird. Jedoch stellt sich die Frage, wie viel Bedürfnisbefriedigung nötig ist und wie viel elterliche Autorität vielleicht doch angebracht wäre, um sein Kind zu einem emanzipierten und mündigen Menschen zu erziehen. Denn Emanzipation und Mündigkeit sind die primären Erziehungsziele in der heutigen Zeit.
Diese wissenschaftlich begründete Hausarbeit soll nun die Auswirkungen der Erziehungsstile auf die Emanzipation und Mündigkeit des Menschen aufzeigen. Um das weitläufige Thema einzugrenzen, wird hierbei nur auf die elterlichen Erziehungsmaßnahmen eingegangen anhand der von Klaus Hurrelmann fünf definierten Erziehungsstile.
Es wird unter anderem auf die Problemstellung eingegangen, ob geringe Einmischung seitens der Eltern in die Erziehung des Kindes zu mehr Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein führt oder, ob Kinder doch eher ein führendes Vorbild brauchen. Außerdem wird erörtert, ob der nach Hurrelmann als Mittelweg aller Erziehungsstile definierte autoritativ-partizipative Erziehungsstil wirklich der am besten geeignete ist. Ziel ist es herauszufinden, welcher Erziehungsstil am ehesten zu einem emanzipierten und mündigen Menschen führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zum Thema
- Problemstellung und Untersuchungsziele der Arbeit
- Vorgehensweise
- Begriffliche und theoretische Grundlagen
- Definition der elterlichen Erziehungsstile nach Klaus Hurrelmann
- Der autoritäre Erziehungsstil
- Der überbehütende Erziehungsstil
- Der vernachlässigende Erziehungsstil
- Der permissive Erziehungsstil
- Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil
- Definition der Begriffe Emanzipation und Mündigkeit
- Emanzipation
- Mündigkeit
- Auswirkungen der Erziehungsstile auf die Emanzipation und Mündigkeit des Individuums – Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse vs. elterliche Autorität
- Geringes eingreifen der Eltern in die Erziehung – der bessere Weg zur Selbstständigkeit?
- Der autoritäre Erziehungsstil und Emanzipation und Mündigkeit - ein Paradoxon?
- Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil als Mittelweg – die beste Lösung?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener elterlicher Erziehungsstile auf die Entwicklung von Emanzipation und Mündigkeit beim Individuum. Dabei werden die fünf von Klaus Hurrelmann definierten Erziehungsstile betrachtet und in Bezug auf ihre potenziellen Einflüsse auf die Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung des Kindes analysiert.
- Definition und Analyse der elterlichen Erziehungsstile nach Klaus Hurrelmann
- Begriffliche Klärung von Emanzipation und Mündigkeit
- Beziehung zwischen den Erziehungsstilen und der Entwicklung von Emanzipation und Mündigkeit
- Bewertung der verschiedenen Erziehungsstile im Hinblick auf ihre Förderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung
- Diskussion des autoritativ-partizipativen Erziehungsstils als potenzieller Mittelweg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der elterlichen Erziehungsstile und deren Einfluss auf die Entwicklung von Emanzipation und Mündigkeit ein. Es werden zentrale Fragen und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die begrifflichen und theoretischen Grundlagen, indem es die verschiedenen Erziehungsstile nach Klaus Hurrelmann sowie die Begriffe Emanzipation und Mündigkeit definiert. In Kapitel 3 werden die Auswirkungen der Erziehungsstile auf die Emanzipation und Mündigkeit des Individuums untersucht, wobei die Rolle elterlicher Autorität und die Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Dabei werden die jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen Erziehungsstile beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Erziehungsstile, Emanzipation, Mündigkeit, elterliche Autorität, kindliche Bedürfnisse, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstbestimmung, und dem autoritativ-partizipativen Erziehungsstil.
- Quote paper
- Anita Schröder (Author), 2012, Die elterlichen Erziehungsstile nach Klaus Hurrelmann und deren Auswirkung auf die Emanzipation und Mündigkeit des Individuums, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/201723