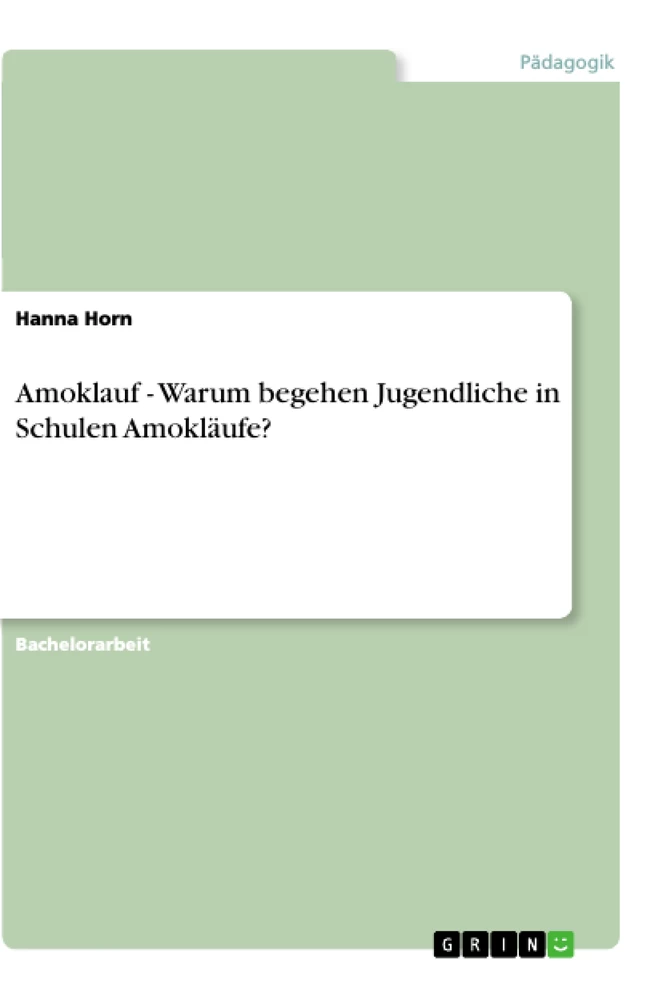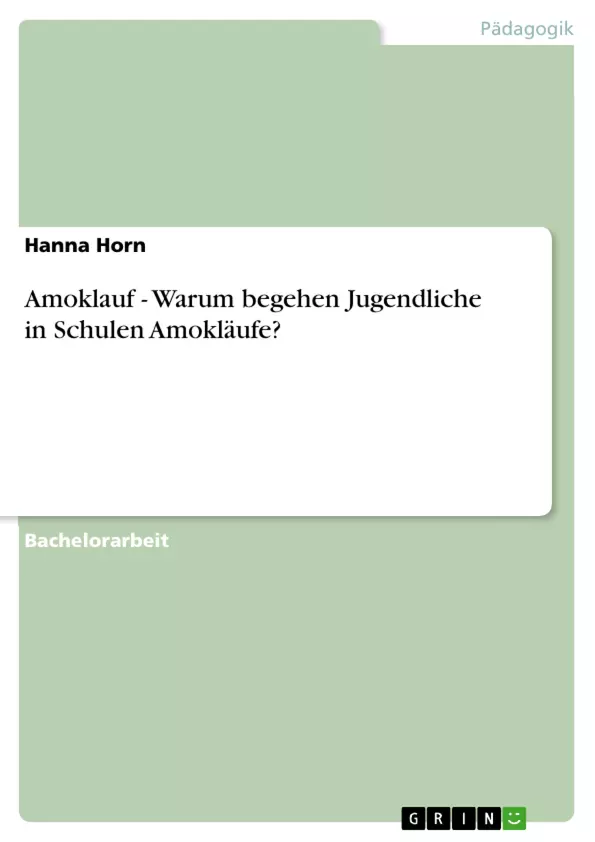1 Einleitung
„Am Vormittag des 16. April 2002 ereignet sich während der schriftlichen Abiturprüfungen im Erfurter Gutenberg-Gymnasium eine bis dahin unfass- und unvorstellbare Tat: Der 19-jährige ehemalige Schüler Robert S. betritt mit einer Sporttasche das Schulgebäude. In der Toilette im Erdgeschoss zieht er sich schwarze Kleidung an sowie eine Maske über den Kopf und bewaffnet sich. Danach bewegt er sich zielsicher und systematisch durch das Schulgebäude und tötet in nur zehn Minuten zwölf Lehrer, zwei Schüler und jeweils eine Sekretärin und einen Polizisten. Am Ende tötet er sich selbst.“
Ähnliche Nachrichten von derartigen Taten sind bisher nur durch die Medien bekannt und erscheinen eher weit entfernt. Es gilt vielmehr als ein spezifisches Problem der USA, wie beispielsweise die weltweit aufsehenerregendste Tat an der Columbine High School. Nachdem jedoch mit den Städten Erfurt, Emsdetten und Winnenden erschreckende Ereignisse mit blutigen Spuren assoziiert werden, steht fest, dass auch in Deutschland Taten dieser Art möglich sind. Obwohl solche krisenhafte Ereignisse nur selten vorkommen, ist ihre Anzahl in den letzten Jahren stetig gestiegen. Diese grausamen Taten, über die immer wieder in den Medien berichtet wird, haben großes Entsetzen und Ratlosigkeit allerorts ausgelöst und sich dauerhaft in das Gedächtnis der Gesellschaft eingebrannt. Es ist also von Bedeutung sich mit der Thematik des School Shootings auseinander zu setzten und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Wenn die Medien von grausamen, brutalen und furchtbaren Taten sprechen, beschreiben diese Worte ausschließlich das Handeln, nicht die Gründe. Die öffentlichen Diskussionen fokussieren den psychischen Zustand, der zumeist männlichen Täter, konzentrieren sich auf deren Medienkonsum, insbesondere die gewalthaltigen Videospiele, und thematisieren den Zugang sowie den Gebrauch von Waffen. Es erweckt den Anschein, als würden die sozialen Voraussetzungen sowie die tatauslösenden Beweggründe der Täter eher außer Acht gelassen werden. Darüber hinaus gewinnt zunehmend die Frage an Bedeutung, warum Jugendliche gerade an Schulen solch tödliche Gewalttaten ausüben. So werden solche Taten im Englischen als School Shootings bezeichnet, womit im Deutschen der Begriff der Schulschießerei gemeint ist.
Die nachstehende fachwissenschaftliche Bachelorarbeit thematisiert diese Frage und beschäftigt sich demnach ausschließlich mit Taten, die sich an Schulen ereignen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Amoklauf
- 2.2 School Shootings
- 3 Taten
- 3.1 Das Ausmaß von School Shootings - Internationaler Kontext
- 3.1.1 Zeitliche Verteilung der School Shootings
- 3.1.2 Opfer von School Shootings
- 3.1.3 Tatausgang von School Shootings
- 3.2 Täter
- 3.2.1 Männliche School Shooter
- 3.2.2 Anzahl der School Shooter
- 3.2.3 Alter der School Shooter
- 3.2.4 Waffen
- 3.3 School Shootings in Deutschland
- 4 Die Lebensphase Jugend
- 4.1 Das Jugendalter
- 4.2 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 4.3 Psychosoziale Entwicklung
- 4.4 Identitätsentwicklung
- 4.4.1 Die Familie
- 4.4.2 Schulen und Ausbildungsinstitutionen
- 4.4.3 Die Peer-Group
- 5 Ursachen, Hintergründe und Entstehung
- 5.1 Gesellschaftliche, familiäre und soziale Hintergründe
- 5.1.1 Gesellschaftliche Aspekte
- 5.1.2 Familiäres Umfeld
- 5.1.3 Soziales Umfeld
- 5.2 Unauffälliges Erscheinungsbild des School Shooters
- 5.3 Psychopathologische Auffälligkeiten
- 6 Tatort Schule
- 6.1 Schulen als Bedingungsrahmen
- 6.1.1 Der Selektions- und Leistungsdruck der Schule
- 6.1.2 Soziale Kontrolle durch die Schule
- 6.1.3 Mitschüler
- 7 Medien
- 7.1 Bedeutung gewalthaltiger Medien
- 7.2 Gesteigertes mediales Interesse
- 8 Prävention
- 8.1 Ansätze zur Prävention und Intervention
- 8.2 Präventionsmöglichkeiten in der Schule
- 8.2.1 Primärprävention
- 8.2.2 Sekundärprävention
- 8.2.3 Tertiärprävention
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Ursachen von Amokläufen an Schulen, insbesondere School Shootings. Ziel ist es, das Phänomen zu beleuchten und mögliche Hintergründe zu analysieren, ohne jedoch pauschale Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Arbeit vermeidet eine vereinfachte Zuweisung der Schuld an einzelne Faktoren.
- Das Ausmaß und die zeitliche Verteilung von School Shootings im internationalen und deutschen Kontext.
- Charakteristika der Täter (Profil, Alter, Motive).
- Die Rolle sozialer, familiärer und gesellschaftlicher Faktoren.
- Der Einfluss der Schule als sozialer und institutioneller Rahmen.
- Die Bedeutung von Medien und gewalthaltigen Inhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit dem Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium als drastisches Beispiel und stellt die Frage nach den Ursachen von School Shootings in den Mittelpunkt. Sie hebt die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Thema hervor und kritisiert die einseitige Fokussierung öffentlicher Diskussionen auf den psychischen Zustand der Täter und den Medienkonsum, während soziale und tatauslösende Beweggründe oft vernachlässigt werden.
2 Begriffserklärung: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Amoklauf“ und „School Shootings“, differenziert zwischen beiden und legt den Fokus auf die spezifischen Merkmale von School Shootings im Kontext der Arbeit.
3 Taten: Dieses Kapitel analysiert das Ausmaß von School Shootings international und in Deutschland. Es beleuchtet die zeitliche Verteilung, die Opferzahlen und den Tatausgang. Es beschreibt auch das Profil der Täter (Alter, Geschlecht, verwendete Waffen) und skizziert typische Merkmale der Taten.
4 Die Lebensphase Jugend: Dieses Kapitel befasst sich mit der Lebensphase Jugend und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben. Es beleuchtet die psychosoziale Entwicklung, die Identitätsfindung und den Einfluss von Familie, Schule und Peergroup auf die Jugendlichen.
5 Ursachen, Hintergründe und Entstehung: Hier werden die gesellschaftlichen, familiären und sozialen Hintergründe von School Shootings untersucht. Es werden sowohl makrosoziale als auch mikrosoziale Faktoren berücksichtigt, darunter gesellschaftliche Aspekte, familiäres Umfeld und das soziale Umfeld der Täter. Das Kapitel geht auch auf das oft unauffällige Erscheinungsbild der Täter und mögliche psychopathologische Auffälligkeiten ein.
6 Tatort Schule: Dieser Abschnitt analysiert die Schule als Bedingungsrahmen für School Shootings. Es untersucht den Selektions- und Leistungsdruck, die soziale Kontrolle und die Beziehungen zu Mitschülern als potentielle Auslöser oder Mitwirkende an solchen Ereignissen.
7 Medien: Dieses Kapitel thematisiert den Einfluss von Medien, insbesondere gewalthaltiger Medien, und das gesteigerte mediale Interesse an School Shootings.
8 Prävention: Der Fokus liegt auf Ansätzen zur Prävention und Intervention sowie Möglichkeiten der Prävention in Schulen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ursachen von Amokläufen an Schulen - Insbesondere School Shootings
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Ursachen von Amokläufen an Schulen, insbesondere School Shootings. Ziel ist die Beleuchtung des Phänomens und die Analyse möglicher Hintergründe, ohne pauschale Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Arbeit vermeidet eine vereinfachte Schuldzuweisung an einzelne Faktoren.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt das Ausmaß und die zeitliche Verteilung von School Shootings international und in Deutschland, die Charakteristika der Täter (Profil, Alter, Motive), die Rolle sozialer, familiärer und gesellschaftlicher Faktoren, den Einfluss der Schule als sozialer und institutioneller Rahmen sowie die Bedeutung von Medien und gewalthaltigen Inhalten.
Wie wird der Begriff "School Shooting" definiert?
Das Kapitel "Begriffserklärung" klärt die Begriffe „Amoklauf“ und „School Shootings“, differenziert zwischen beiden und legt den Fokus auf die spezifischen Merkmale von School Shootings im Kontext der Arbeit.
Welche Daten werden zur Analyse des Ausmaßes von School Shootings verwendet?
Das Kapitel "Taten" analysiert das Ausmaß von School Shootings international und in Deutschland. Es beleuchtet die zeitliche Verteilung, die Opferzahlen und den Tatausgang und beschreibt das Profil der Täter (Alter, Geschlecht, verwendete Waffen) sowie typische Merkmale der Taten.
Wie wird die Rolle der Jugendphase in der Entstehung von School Shootings betrachtet?
Das Kapitel "Die Lebensphase Jugend" befasst sich mit der Lebensphase Jugend und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben. Es beleuchtet die psychosoziale Entwicklung, die Identitätsfindung und den Einfluss von Familie, Schule und Peergroup auf die Jugendlichen.
Welche gesellschaftlichen, familiären und sozialen Faktoren werden untersucht?
Das Kapitel "Ursachen, Hintergründe und Entstehung" untersucht die gesellschaftlichen, familiären und sozialen Hintergründe von School Shootings. Es berücksichtigt sowohl makrosoziale als auch mikrosoziale Faktoren, darunter gesellschaftliche Aspekte, familiäres Umfeld und das soziale Umfeld der Täter. Es wird auch auf das oft unauffällige Erscheinungsbild der Täter und mögliche psychopathologische Auffälligkeiten eingegangen.
Welche Rolle spielt die Schule als Tatort?
Das Kapitel "Tatort Schule" analysiert die Schule als Bedingungsrahmen für School Shootings. Es untersucht den Selektions- und Leistungsdruck, die soziale Kontrolle und die Beziehungen zu Mitschülern als potentielle Auslöser oder Mitwirkende an solchen Ereignissen.
Wie wird der Einfluss der Medien behandelt?
Das Kapitel "Medien" thematisiert den Einfluss von Medien, insbesondere gewalthaltiger Medien, und das gesteigerte mediale Interesse an School Shootings.
Welche Präventionsansätze werden vorgestellt?
Das Kapitel "Prävention" konzentriert sich auf Ansätze zur Prävention und Intervention sowie Möglichkeiten der Prävention in Schulen (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Kapitel "Fazit" fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus der Untersuchung.
- Quote paper
- Hanna Horn (Author), 2012, Amoklauf - Warum begehen Jugendliche in Schulen Amokläufe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/201236