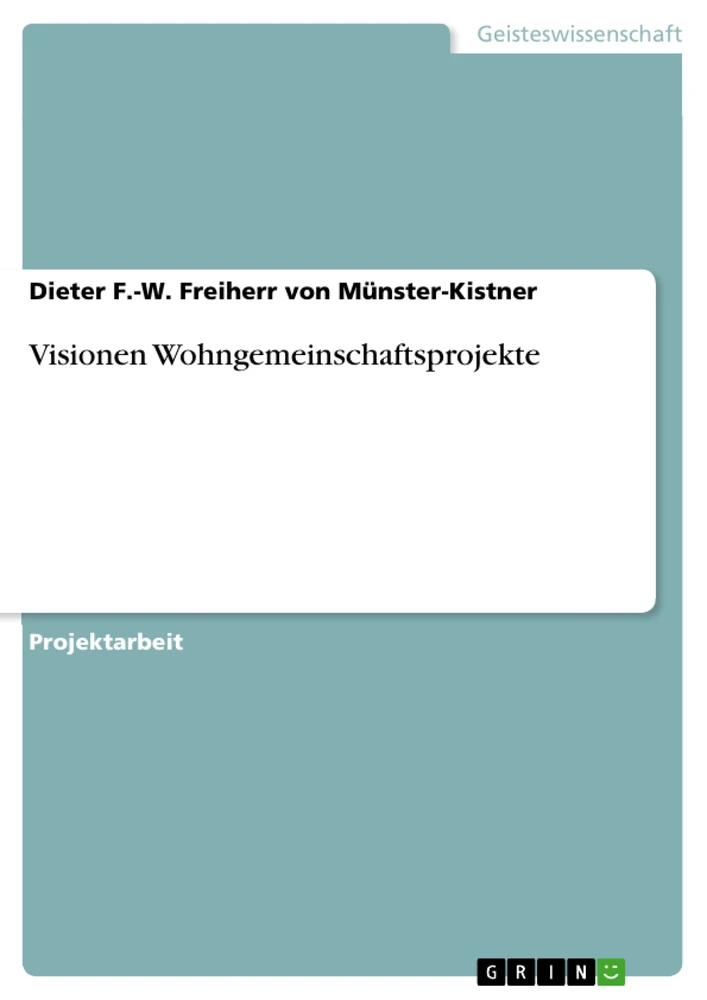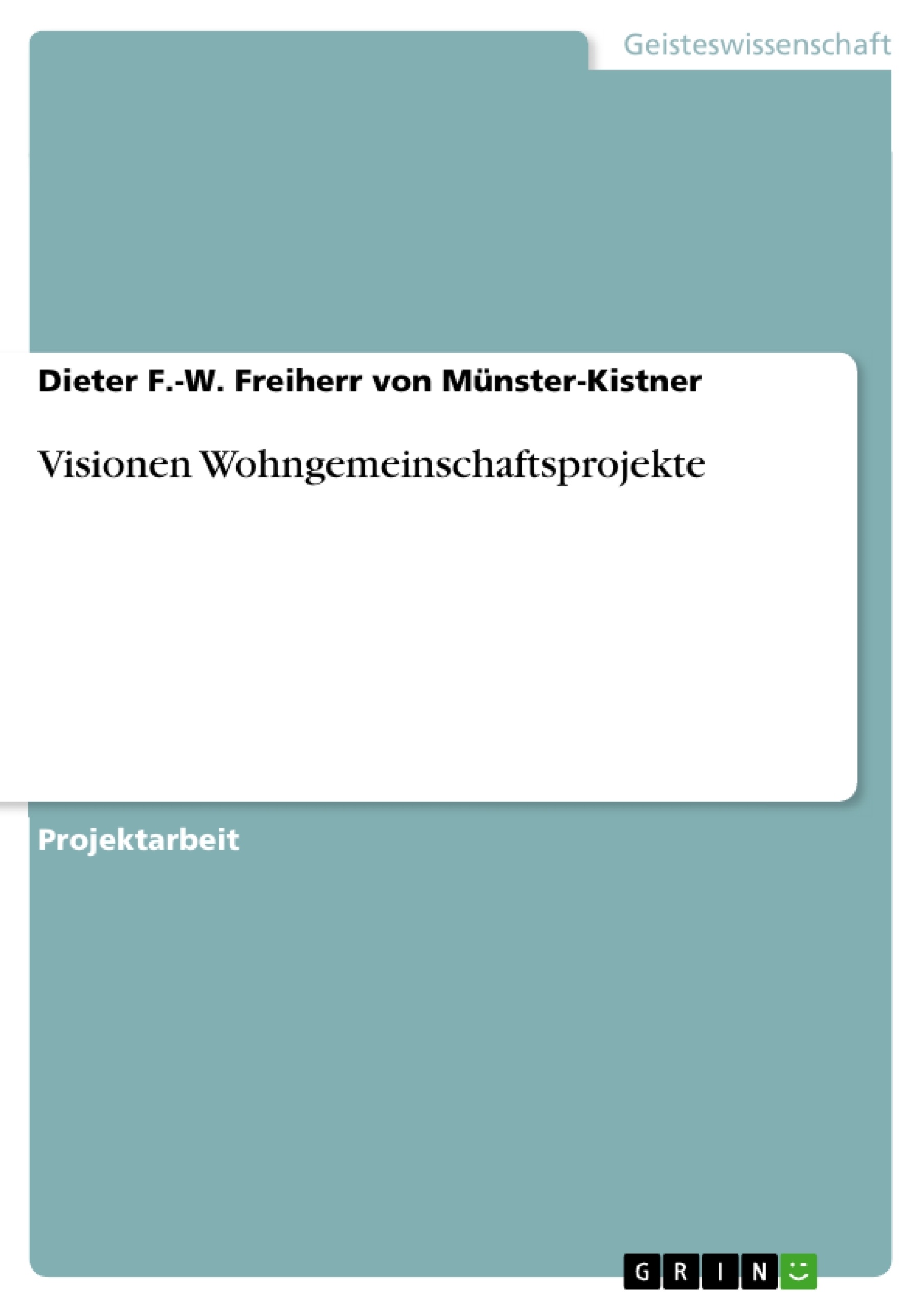Der demografische Wandel wird unsere Gesellschaftsstruktur und unser derzeitiges Wirtschaftssystem wesentlich stärker verändern und beeinflussen, als es derzeit noch dargestellt wird. Dies hat weitreichende Konsequenzen für unsere Gesellschaft, die Politik und natürlich auch für das Wirtschaftssystem.
Die heutige Seniorengeneration befindet sich nicht mehr im dritten Lebensabschnitt, dies war früher, sondern im „vierten“ Lebensabschnitt. Immer mehr ältere Menschen haben im wahrsten Sinne des Wortes Spaß am Leben und genießen das bzw. ihr „Alter“ in vollen Zügen. Sie sind aktiv, initiativ und auch innovativ „unterwegs“.
Die bisherigen Wohnformen im Alter wie sie derzeit noch üblich sind wie z. B. Seniorenheime, Pflegeheime, Betreutes Wohnen usw. sind sicherlich sehr wichtig, aber nicht geeignet, langfristig den Bedarf zu decken, den Anforderungen und Ansprüchen an die neu heranwachsende Seniorengeneration zu entsprechen. In solch eine Einrichtung zu gehen, ist für viele der Betroffenen im Moment schlichtweg einfach auch noch nicht vorstellbar.
Die Wohnform in der gelebt werden soll und will muss anders sein, sich unterscheiden. Daher soll das nachfolgende Projektkonzept bzw. -studie mögliche alternative Wohn-formen darstellen. „Visionen Wohnkonzept“ beschäftigt sich mit deren Umsetzungsmöglichkeiten, Kosten für die Erstellung. Bewusst als „Visionen“, „Wünsche“ oder „Träume“, den leider lassen sich nicht alle Wünsche umsetzen oder sind wirtschaftlich realisierbar. Visionen, Wünsche und Träume sind aber wichtig, denn sie können Denkanstöße und Befruchtung für andere Ideen sein.
Wenn mit dieser Studie es gelungen sein sollte Interessierte zu begeistern, habe ich mein Ziel erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. ALLGEMEINES
- 1.1 Warum ausgerechnet ...,,Projekt Wohngemeinschaft“?
- 1.2 Visionen für ein Wohnkonzept
- 1.3 Drei Ebenen des Wirkens
- 1.4 Was ist das Ziel (Wunsch)
- 1.5 Was nicht gewolt ist
- 2. FORDERUNGEN AN DIE MENSCHEN DER WOHNGEMEINSCHAFT
- 3. ÜBERSICHT MÖGLICHER PROJEKTTYPEN
- 3.1. Allgemeine Auswahlkriterien für eine Wohngemeinschaft
- 3.1.1.Überblick einiger Entscheidungssituationen, die es den zukünftigen Bewohnern erleichtern sollte ihre Wunschvorstellungen zu realisieren
- 4. PROJEKT,,Integrierte WOHNGEMEINSCHAFT“
- 4.1 Anforderungsprofile
- 4.1.1 Bewohner
- 4.1.2 Standortqualität
- 4.1.3 Qualität der Gebäudestruktur
- 4.1.4 Gebäudequalität
- 4.1.5 Grundrissqualität
- 4.1.6 Energieversorgung
- 4.2 Primäre Anforderungen an die Wohnanlage
- 4.2.1 Barrierefreiheiten
- 4.2.2 Grundrissformen
- 4.2.3 Einbindung in das Wohnquartier-Umfeld der Wohngemeinschaft
- 4.2.4 Gemeinschaftsbereiche
- 4.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 4.1 Anforderungsprofile
- 5. PROJEKT,,Visionen WOHNGEMEINSCHAFT“
- 5.1 Mögliche Wohnformen Zusammenfassung von schematischen Konzeptansätzen
- 5.1.1 Quartierkonzept
- 5.1.2 Pionierprojekt
- 5.1.3 Wohnen in ländlicher Umgebung
- 5.1.4 Wohnen in der Stadt
- 5.2 Projekt einer Hausgemeinschaft und/oder Wohngemeinschaft, in Stadtnähe\" (Wunschbild1)
- 5.2.1 Bewohner
- 5.2.2 Standort und Infrastruktur
- 5.2.3 Gebäude und Konstruktion
- 5.2.4 Energieversorgung
- 5.2.5. Baustoffe
- 5.2.6 Sonstiges
- 5.3 Projekt einer Hausgemeinschaft und/oder Wohn-Gemeinschaft „, im Dorf\" oder „, am Stadtrand\"\n(Wunschbild 2)
- 5.3.1 Bewohner
- 5.3.2 Standort und Infrastruktur
- 5.3.3 Gebäude und Konstruktion
- 5.3.4 Energieversorgung
- 5.3.5 Baustoffe
- 5.3.6 Sonstiges
- 5.4 Quartierprojekt (Wunschbild 3)
- 5.4.1 Vernetzung auf kleinem Raum
- 5.4.2,, Miteinander Wohnen\" in Berlin... ein gelebtes Beispiel ...
- 5.4.2.1 Angebote im Quartier
- 5.4.2.2 Finanzierung
- 5.5 Kostenrahmen der einzelnen Projekte
- 5.5.1 Allgemeine Grundlagen
- 5.5.2 Kostenrahmen für das Projekt Hausgemeinschaft und/oder Wohngemeinschaft,, in Stadtnähe "
- 5.5.3 Kostenrahmen für das Projekt Hausgemeinschaft und/oder Wohngemeinschaft „, im Dorf“ oder,, am Stadtrand”
- 5.1 Mögliche Wohnformen Zusammenfassung von schematischen Konzeptansätzen
- 6. Modellprojekt Ausbildung und/oder Umschulung
- 6.1 Modul Kommunikation
- 6.2 Modul Hauswirtschaft
- 6.3 Modul Betreuung
- 6.4 ModulPsychologie
- 6.5 Modul Recht
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Projektkonzept widmet sich der Visionierung von Wohnformen für eine alternde Gesellschaft und stellt die Frage nach alternativen Wohnkonzepten, die den Bedürfnissen der zukünftigen Generationen gerecht werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Wohngemeinschaften, die ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben im Alter ermöglichen sollen.
- Der demografische Wandel und die damit einhergehende Überalterung der Gesellschaft
- Die Suche nach geeigneten Wohnformen für ältere Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen möchten
- Die Herausforderungen der Finanzierung und Gestaltung von Wohnprojekten für die ältere Generation
- Die Bedeutung von Gemeinschaft und Vernetzung im Alter
- Die Rolle von Architektur und Infrastruktur bei der Gestaltung barrierefreier und lebenswerter Wohngebiete
Zusammenfassung der Kapitel
Das Konzept beleuchtet die Herausforderungen des demografischen Wandels und die Bedeutung von neuen Wohnformen für ältere Menschen. Es analysiert bestehende Wohnmodelle und entwickelt Visionen für innovative Wohngemeinschaften, die auf die Bedürfnisse und Ansprüche der neuen Generationen im Alter zugeschnitten sind. Die Kapitel befassen sich mit den Anforderungen an Bewohner, Standortqualität, Gebäude- und Grundrissgestaltung, Energieversorgung und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es werden verschiedene Projekttypen vorgestellt und die Umsetzungsmöglichkeiten sowie Kostenrahmen diskutiert. Auch die Bedeutung von Ausbildung und Umschulung für die Mitarbeiter in solchen Wohngemeinschaften wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Demografischer Wandel, Alter, Wohnen, Wohngemeinschaft, Vision, Projekt, Konzept, Lebensqualität, selbstbestimmt, selbständig, barrierefrei, Infrastruktur, Kosten, Finanzierung, Ausbildung, Umschulung, Gemeinschaft, Vernetzung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind neue Wohnformen für Senioren notwendig?
Der demografische Wandel führt zu einer aktiven Seniorengeneration im „vierten Lebensabschnitt“, die herkömmliche Heime oft ablehnt und selbstbestimmtere Wohnformen sucht.
Was ist das Ziel des Projekts „Visionen Wohngemeinschaft“?
Das Ziel ist die Darstellung alternativer Wohnkonzepte, die Gemeinschaft, Barrierefreiheit und Selbstständigkeit im Alter fördern und wirtschaftlich realisierbar sind.
Welche Projekttypen werden unterschieden?
Die Studie unterscheidet u.a. Quartierkonzepte, Pionierprojekte sowie Wohngemeinschaften in ländlicher Umgebung oder in der Stadt.
Was sind die primären Anforderungen an die Wohnanlagen?
Zentrale Kriterien sind Barrierefreiheit, flexible Grundrissformen, Gemeinschaftsbereiche und eine gute Einbindung in das soziale Umfeld des Wohnquartiers.
Welche Rolle spielt die Ausbildung in diesem Konzept?
Es wird ein Modellprojekt für die Ausbildung oder Umschulung von Personal in den Bereichen Kommunikation, Hauswirtschaft, Betreuung, Psychologie und Recht vorgeschlagen.
- Arbeit zitieren
- Ph.D., MBA , BBA Dieter F.-W. Freiherr von Münster-Kistner (Autor:in), 2012, Visionen Wohngemeinschaftsprojekte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199361