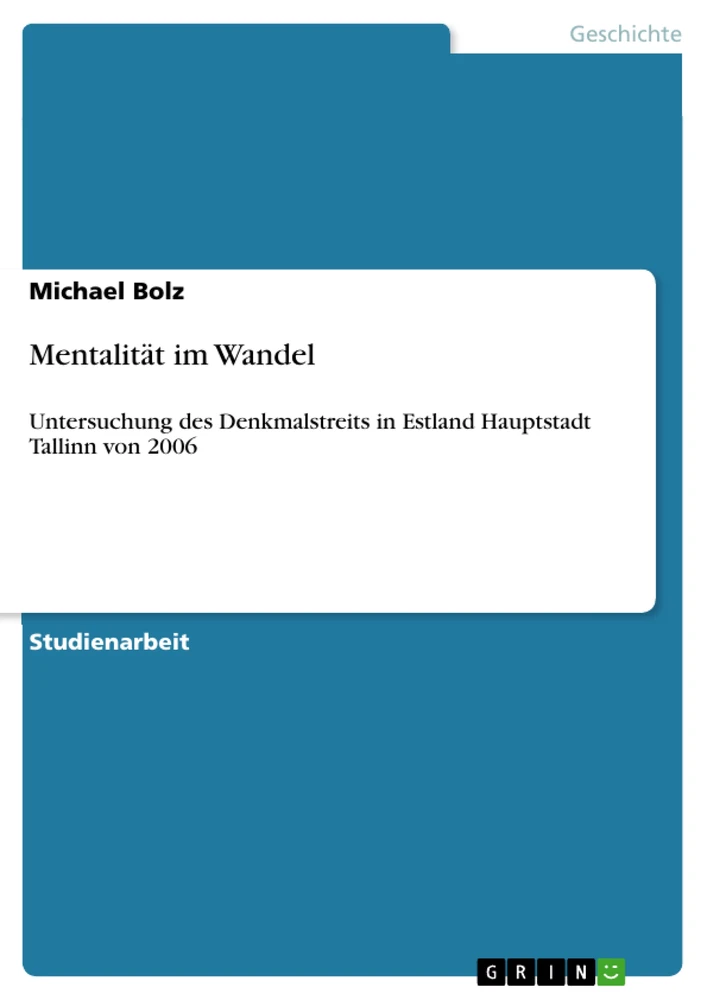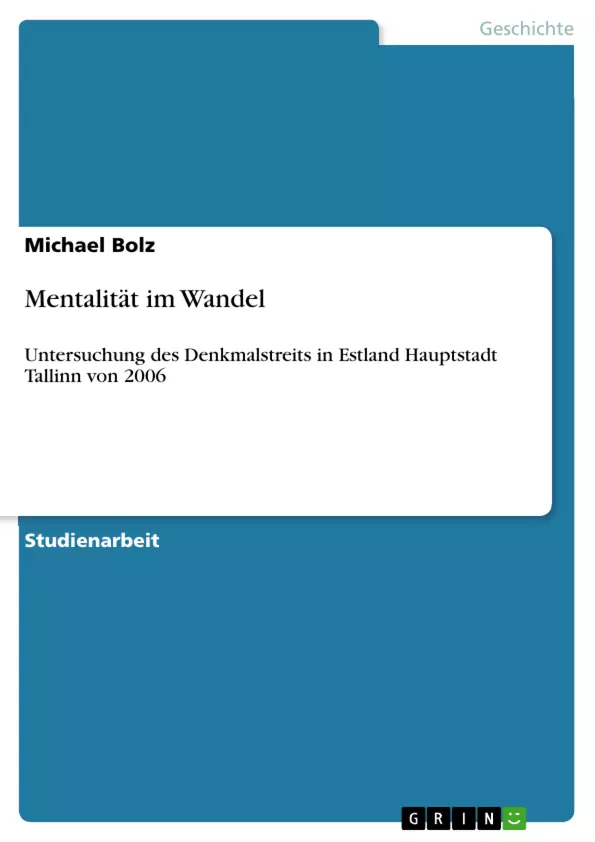Die Arbeit kümmert sich am Beispiel des Denkmalstreits von Talin 2006 um die Funktionsweise von Zuschreibungen und Zuschreibungsphänomenen und wie sie unterschiedliche - beispielsweise - politische Prozesse auslösen und beeinflussen und selbst wiederum davon beeinflusst werden.
Es wird in Folge genauer untersucht, ob es sich bei dem Denkmalstreit 2006 tatsächlich um einen "Selbstreinigungsprozess" der estnischen Mentalität von den Überbleibseln der kommunistischen gehandelt haben könnte, inwiefern dieser Vorgang ein bewusster Vorgang war und ob dieser Streit insofern ermöglicht, überhaupt so etwas wie Mentalität und einen Mentalitätswandel der Esten zu belegen.
Zweitens, ob über den Denkmalstreit als Auseinandersetzung um die nationale Autonomie der Esten unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Herrschaftsvorstellungen und unterschiedliche Zuschreibungen im Ring miteinander ablesbar sind – die sowjetisch- kommunistische und die estnisch-nationalistische.
Drittens: Wie die estnische Mentalität entworfen wurde und was sie im Gegensatz zur kommunistischen und was wiederum diese entgegen der estnischen aussagt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Mentalitäten, widersprüchliche Mentalität
- Denkmäler und ihre Sprachfähigkeit
- Zuschreibung und Zuschreibungsphänomene: Denkmäler als Artefakte datensetzender Macht
- Der Denkmalstreit
- Folgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung widmet sich dem Denkmalstreit in Tallinn im Jahr 2006, welcher sich 15 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung Estlands ereignete. Das Ziel ist es, den Denkmalstreit als Ausdruck eines möglichen Selbstreinigungsprozesses der estnischen Mentalität von den Überbleibseln der kommunistischen Vergangenheit zu analysieren. Dabei werden die folgenden Themenschwerpunkte betrachtet:
- Die Frage, ob der Denkmalstreit als ein bewusster Prozess der Überwindung der kommunistisch geprägten Mentalität verstanden werden kann.
- Die Analyse, ob der Streit auf unterschiedliche Mentalitäten, Herrschaftsvorstellungen und Zuschreibungen in Bezug auf die sowjetisch-kommunistische und die estnisch-nationalistische Vergangenheit hinweist.
- Die Erörterung, wie die estnische Mentalität im Vergleich zur kommunistischen und umgekehrt gestaltet wurde und welche Aussagen diese Mentalitäten treffen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in den Denkmalstreit von 2006 in Tallinn ein und stellt die zentrale Frage, ob dieser Streit einen Mentalitätswandel in Estland widerspiegelt. Die Untersuchung fokussiert sich auf die Analyse der Selbstreinigung der estnischen Mentalität von den Überbleibseln der kommunistischen Herrschaft.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Mentalität und ihrer dialektisch widersprüchlichen Natur. Das Beispiel des Denkmals des trauernden Soldaten in Tallinn wird verwendet, um zu verdeutlichen, wie Denkmäler als Sprachrohr der herrschenden Mentalität fungieren und welche Zuschreibungen diese Funktion ermöglichen.
- Der Denkmalstreit: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des Denkmalstreits in Tallinn. Es analysiert die verschiedenen Perspektiven und Argumente, die im Zusammenhang mit der Debatte um die sowjetischen Denkmäler in Estland diskutiert wurden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Untersuchung sind: Mentalität, Denkmalstreit, sowjetische Besatzung, estnische Identität, Selbstreinigungsprozess, kommunistische Herrschaft, Herrschaftsvorstellungen, Zuschreibung, Sprachfähigkeit, datensetzende Macht.
- Arbeit zitieren
- Michael Bolz (Autor:in), 2012, Mentalität im Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199117