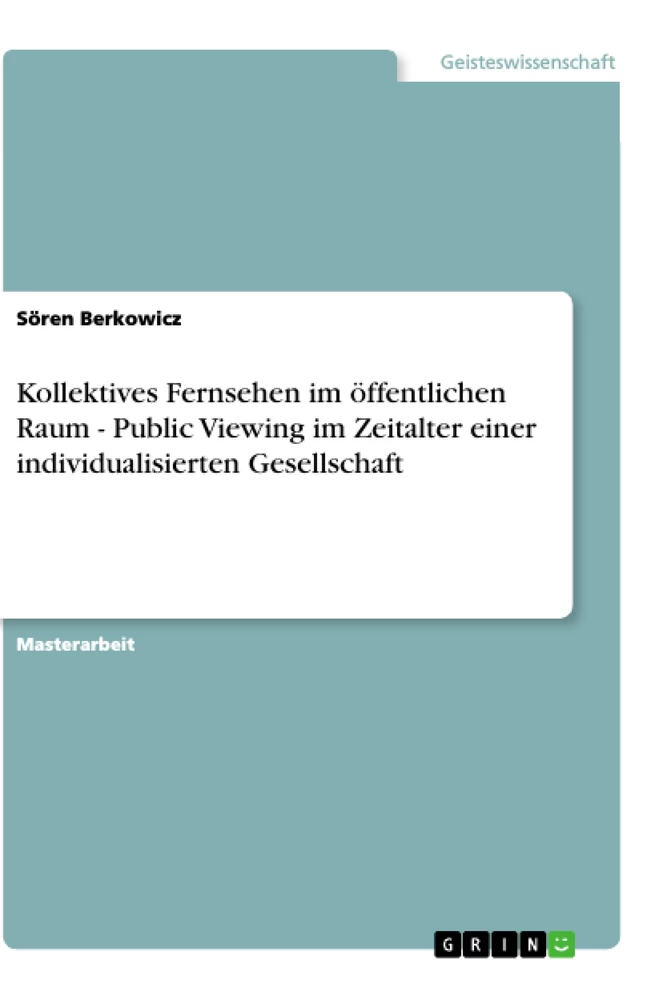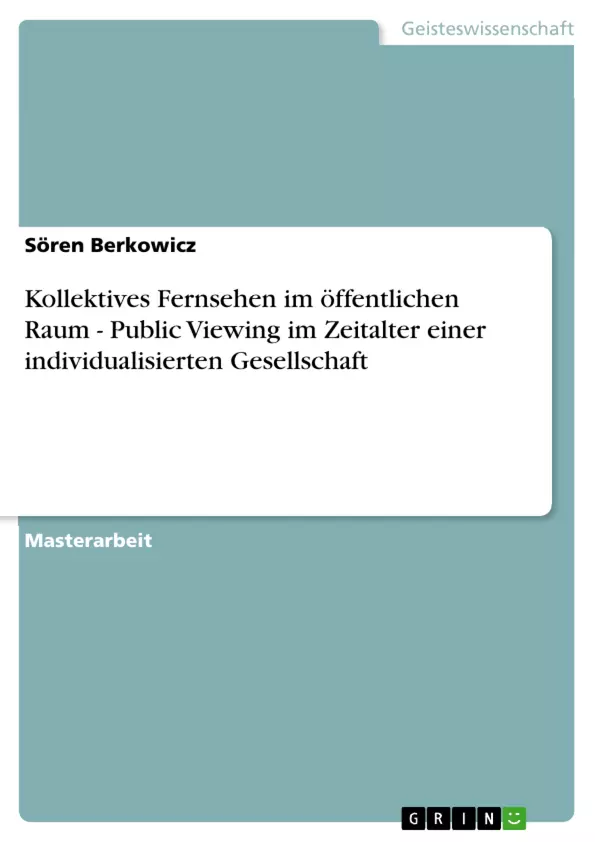Sören Berkowicz widmet sich in seiner Master-Arbeit einem genuin soziologischen Thema, welches er an einem aktuellen Beispiel diskutiert: Wieso gehen Menschen kollektiv zum Fernseh-schauen, obwohl sie alle einen Fernseher besitzen und die Gesellschaft eher durch Individualisierung gekennzeichnet ist, denn durch kollektive, gemeinschaftliche Formen von Sozialität? In einer Mischung aus Zeitdiagnose, mediensoziologischer Herangehensweise und soziologischer Theorie beleuchtet der Autor das Thema in seiner Breite und Tiefe.
Die Arbeit folgt einer sehr übersichtlichen und nachvollziehbaren Struktur, von der gut ausgeführten Problemstellung (Teil I), über die Entwicklungen des Fernsehkonsums (Teil II), der Figur des kollektiven Zuschauers im öffentlichen Raum (Teil III) bis hin zur Analyse und theoretischen Ansätzen zur Erklärung des Phänomens in Teil IV. Die Schlussfolgerungen sind eine Zusammenfassung der Arbeit, in der noch einmal die zentralen Fragen und Erkenntnisse auf den Punkt gebracht werden, nämlich, dass "das Public-Viewing eine Reaktion auf die Sehnsucht nach emotional fundierter Gemeinschaftsbildung ist" (S. 86).
Während Teil II vor allem beschreibend ist, versucht sich der Autor in Teil III an einer Typologisierung des Public-Viewing-Zuschauers, u.a. unter Rückgriff auf die Sekundäranalyse von empirischen Daten sowie eine eigene Erhebung, die er an sogenannten Tatort-Abenden in Kneipen durchgeführt hat. Teil IV präsentiert dann eine intelligente Analyse unter Rückgriff auf theoretische Ansätze der Soziologie - u.a. Tönnies, Weber, Simmel, Joußen, Hitzler - mit denen die Problematik der Vergemeinschaftung im öffentlichen Raum erörtert werden. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Diskussion der Bedeutung von Emotionen in der Soziologie, welche eine Grundlage der Möglichkeiten von Gemeinschaft und kollektiver Identität ist.
Der Autor zeigt, dass er sich in der soziologischen Theorie gut auskennt, dass er eine konkrete und zunächst banale Fragestellung als Problem formulieren und daran eine mit viel wissenschaftlicher Fantasie geführte Diskussion entwickeln kann.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I - Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Vorgehensweise
- 1.2 Methodik
- 1.3 Forschungsstand
- Teil II – Entwicklung des Fernsehkonsums und Individualisierungstendenzen
- 2.1 Der TV Konsument als individueller und solistischer Zuschauer - Definition individuell und kollektiv
- 2.1.1 Gründe für den individuellen TV Konsum und den Erfolg des Fernsehens - Die Veränderung der Produktionsweise, der Arbeits- und Freizeitzeiten
- 2.1.2 Gründe für den Erfolg des Fernsehens – das Produkt-Lebenszyklus-Modell
- 2.1.3 Die Veränderung des TV-Programmes
- 2.3 Die Fernsehzuschauerstruktur
- 2.4 Die ,,MedienNutzertypologie”
- 2.5 Die Fernsehzuschauer nach sozialen Milieus
- 2.6 TV-Motivationen der individuellen Fernsehzuschauer
- 2.7 Resümee
- Teil III – Die kollektiven Zuschauer im öffentlichen Raum
- 3.1 Public Viewing – Begriffsdefinition
- 3.2 Public Viewing von Großveranstaltungen
- 3.2.1 Public Viewing während der Fußball WM/EM
- 3.2.2 Entwicklung und Verbreitung des sportlichen
- 3.3 Public Viewing von TV-Sendungen - eine Fortführung der Großveranstaltungen?
- 3.3.1 Der ARD Tatort
- 3.3.2 Das Tatort Viewing
- 3.3.3 Ideenursprung des Tatort-Viewings und Einfluss des Fußballendrunden Public Viewings
- 3.3.4 Charakteristische Merkmale des Tatort Viewings
- 3.3.5 Charakteristische Merkmale des Sport-Public-Viewings
- 3.3.6 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 3.4 Charakterisierung der kollektiven Zuschauer
- 3.4.1 Tatort-Viewing Zuschauer
- 3.4.2 Sport-Public-Viewing Zuschauer
- 3.5 Gibt es ein kollektives Publikum?
- 3.6 Vergleich der individuellen und kollektiven Zuschauer
- 3.7 Resümee
- Teil IV - Theoretische Erklärungsansätze der Nutzungsmotive
- 4.1 Gründe und Motive der Mediennutzung – die Uses-and-Gratification-Approach
- 4.1.1 Bedürfnisse und Motive des Sportpublikums
- 4.1.2 Bedürfnisse und Motive der Tatort Zuschauer
- 4.1.3 Gemeinsamkeiten und Differenzen der Nutzungsmotive
- 4.2 Die Bedeutung von Emotionen innerhalb der Soziologie
- 4.2.1 Definition und Eingrenzung des Begriffs der Emotionen
- 4.2.2 Der soziale Einfluss von Emotionen
- 4.2.3 Kollektive Emotionen
- 4.3 Identität und Gemeinschaft
- 4.3.1 Das Verhalten des Individuums in der Gemeinschaft
- 4.3.2 Die Vergemeinschaftung
- 4.3.3 Die Vergesellschaftung
- 4.4 Public Viewing als Vergemeinschaftungsform
- 4.5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Entwicklung des Fernsehkonsums von kollektivem Sehen im öffentlichen Raum zu individueller Mediennutzung und den jüngsten Trend zum Public Viewing. Die Arbeit analysiert die Ursachen für diesen Wandel und beleuchtet die Motivationen der Zuschauer, sowohl im individuellen als auch im kollektiven Kontext.
- Wandel des Fernsehkonsums von kollektiv zu individuell und zurück
- Typologisierung der Fernsehzuschauer
- Motivationsanalyse des Public Viewings
- Soziologische Betrachtung kollektiver Emotionen und Identität
- Vergleich von Sport- und Tatort-Public-Viewing
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I - Einleitung und Problemstellung: Dieser einleitende Teil beschreibt die Problemstellung der Arbeit: den Wandel des Fernsehkonsums von kollektiven zu individuellen Betrachtungsweisen und die neuerliche Popularität von Public Viewing. Er skizziert die Vorgehensweise und Methodik der Untersuchung.
Teil II – Entwicklung des Fernsehkonsums und Individualisierungstendenzen: Dieser Teil beleuchtet die historische Entwicklung des Fernsehkonsums, vom kollektiven Fernsehen in den 1920er Jahren hin zum individuellen Konsum im eigenen Zuhause. Es werden die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren analysiert, die diesen Wandel vorangetrieben haben. Der Fokus liegt auf der Charakterisierung des individuellen TV-Konsumenten und der damit verbundenen Typologisierung verschiedener Zuschauergruppen.
Teil III – Die kollektiven Zuschauer im öffentlichen Raum: Dieser Teil konzentriert sich auf das Phänomen des Public Viewing, insbesondere im Kontext von Sportveranstaltungen und der Fernsehsendung "Tatort". Es werden die charakteristischen Merkmale dieser beiden Formen des kollektiven Fernsehens verglichen und die Motivationen der Zuschauer analysiert. Die Frage nach der Existenz eines "kollektiven Publikums" und die Unterscheidung zu individuellen Zuschauern steht im Mittelpunkt.
Teil IV - Theoretische Erklärungsansätze der Nutzungsmotive: Dieser Teil greift auf soziologische Theorien zurück, um die Motive der Mediennutzung zu erklären. Der Uses-and-Gratification-Ansatz dient als Grundlage für die Analyse der Bedürfnisse und Motive von Sport- und Tatort-Zuschauern. Zusätzlich wird die Rolle von Emotionen, Identität und Gemeinschaft im Kontext des Public Viewings untersucht.
Schlüsselwörter
Public Viewing, Fernsehkonsum, Individualisierung, Kollektivität, Mediennutzung, Uses-and-Gratification, Emotionen, Identität, Gemeinschaft, Soziologie, Sport, Tatort, Medienwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Entwicklung des Fernsehkonsums und Individualisierungstendenzen
Was ist der Hauptfokus dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Wandel des Fernsehkonsums von kollektivem Sehen im öffentlichen Raum zu individueller Mediennutzung und den jüngsten Trend zum Public Viewing. Sie analysiert die Ursachen dieses Wandels und beleuchtet die Motivationen der Zuschauer, sowohl im individuellen als auch im kollektiven Kontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Wandel des Fernsehkonsums von kollektiv zu individuell und zurück, die Typologisierung der Fernsehzuschauer, die Motivationsanalyse des Public Viewings, eine soziologische Betrachtung kollektiver Emotionen und Identität sowie einen Vergleich von Sport- und Tatort-Public-Viewing.
Welche Teile umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Teil I (Einleitung und Problemstellung), Teil II (Entwicklung des Fernsehkonsums und Individualisierungstendenzen), Teil III (Die kollektiven Zuschauer im öffentlichen Raum) und Teil IV (Theoretische Erklärungsansätze der Nutzungsmotive).
Was wird in Teil I behandelt?
Teil I beschreibt die Problemstellung der Arbeit: den Wandel des Fernsehkonsums und die Popularität von Public Viewing. Er skizziert die Vorgehensweise und Methodik der Untersuchung.
Was wird in Teil II behandelt?
Teil II beleuchtet die historische Entwicklung des Fernsehkonsums vom kollektiven Fernsehen zum individuellen Konsum. Er analysiert die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren dieses Wandels und charakterisiert den individuellen TV-Konsumenten sowie verschiedene Zuschauergruppen.
Was wird in Teil III behandelt?
Teil III konzentriert sich auf das Phänomen des Public Viewing, insbesondere bei Sportveranstaltungen und dem "Tatort". Es werden die Merkmale dieser Formen des kollektiven Fernsehens verglichen und die Zuschauermotivationen analysiert. Die Frage nach einem "kollektiven Publikum" und dessen Unterscheidung zu individuellen Zuschauern steht im Mittelpunkt.
Was wird in Teil IV behandelt?
Teil IV verwendet soziologische Theorien, um die Motive der Mediennutzung zu erklären. Der Uses-and-Gratification-Ansatz dient zur Analyse der Bedürfnisse und Motive von Sport- und Tatort-Zuschauern. Die Rolle von Emotionen, Identität und Gemeinschaft im Kontext des Public Viewings wird untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Methodik in Teil I. Genaueres zur konkreten Methodik ist aus dem gegebenen Auszug nicht ersichtlich.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Uses-and-Gratification-Ansatz, um die Nutzungsmotive zu analysieren. Zusätzlich werden soziologische Theorien zu Emotionen, Identität und Gemeinschaft herangezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Public Viewing, Fernsehkonsum, Individualisierung, Kollektivität, Mediennutzung, Uses-and-Gratification, Emotionen, Identität, Gemeinschaft, Soziologie, Sport, Tatort, Medienwandel.
Wie ist der Inhalt der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Sören Berkowicz (Author), 2012, Kollektives Fernsehen im öffentlichen Raum - Public Viewing im Zeitalter einer individualisierten Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196988