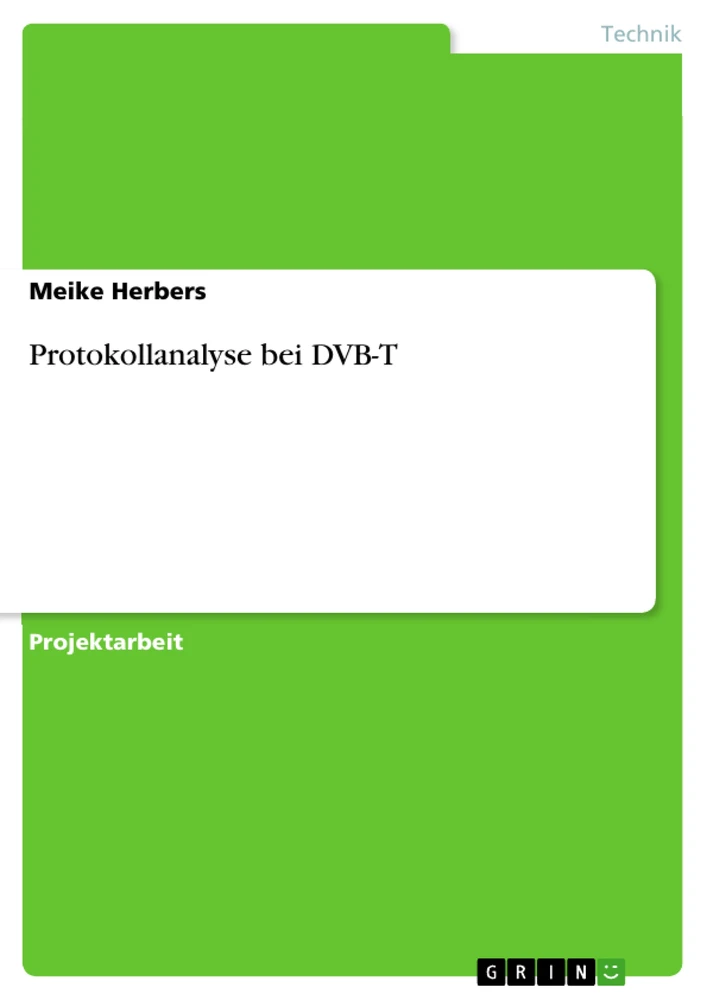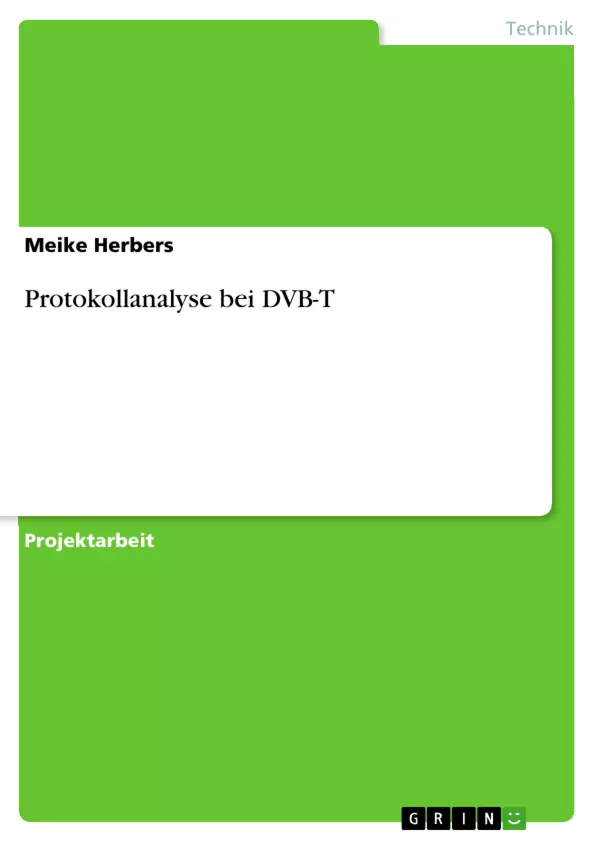Das erste regelmäßige Fernsehprogramm strahlte ein Berliner Sender 1935 aus. Auf der Funkausstellung 1932 wurde der dazugehörige erste Fernseher mit Bildröhre und einer Technik, die der heutigen gleicht, von Dénes von Mihály präsentiert. Durch den Krieg kam es zu einer Sendepause, da die Sender zerstört wurden. Erst 1950 wurde durch die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten wieder ein Fernsehprogramm ausgestrahlt. Als nächste Stufe in der Geschichte des Fernsehens ist die Entwicklung des Farbfernsehers zu nennen. 1961 stellte Walter Bruch das Phase Alternation Line (PAL) vor und damit die Möglichkeit Farbe in das Fernsehbild zu bringen. Bis 1984 wurde in Deutschland das Fernsehprogramm stets terrestrisch oder über Satellit übertragen. Nun aber wurde nach und nach die Übertragung über ein Kabelnetz immer populärer. Die terrestrische und die Satellitenübertragung bleiben weiter erhalten. [NTV Knowledge]
[...]
Bei diesem Projekt wird anhand von zwei Software-Tools eine Protokollanalyse des DVB-T Datenstroms durchgeführt. Dabei werden die erhaltenen Ergebnisse mit den gültigen Standard verglichen. Des Weiteren soll die Dynamik der Bandbreite der einzelnen Programme eines Bouquets untersucht werden. Werden unterschiedliche Sendungen mit unterschiedlichen Bandbreiten ausgestrahlt? Eine weitere interessante Frage ist, wie sich das Bouquet vom NDR während der Regionalprogramme verändert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Aufgabenstellung
- 2 Technik DVB-T
- 2.1 Übertragung von MPEG-Datenströmen (Kanalkodierung)
- 2.1.1 Paketierter Elementarstrom
- 2.1.2 Transportstrom
- 2.1.3 Multiplexbildung
- 2.2 Modulation bei DVB-T (Leitungskodierung)
- 3 Inbetriebnahme DVB-T Empfänger und Messsoftware
- 3.1 Installation PCI-Karte
- 3.2 Installation Software
- 4 Analyse des DVB-T Datenstroms
- 4.1 Struktur der Messumgebung
- 4.2 Untersuchungen mit der Software
- 4.2.1 TSReader
- 4.2.2 DVBStreamExplorer
- 4.2.3 Analyse dynamischer Bandbreiten
- 5 Fazit
- 6 Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Protokollanalyse von DVB-T Datenströmen. Ziel ist es, die Funktionsweise des DVB-T Standards anhand von Software-Tools zu untersuchen und die Ergebnisse mit den gültigen Standards zu vergleichen. Die Analyse soll sich insbesondere auf die Dynamik der Bandbreite verschiedener Programme innerhalb eines Bouquets konzentrieren.
- Übertragung von MPEG-Datenströmen im DVB-T Standard
- Analyse der Struktur und Funktionsweise des Datenstroms
- Untersuchung der Bandbreitendynamik verschiedener Programme
- Anwendung und Vergleich von Software-Tools für die Protokollanalyse
- Bewertung der Ergebnisse im Kontext des DVB-T Standards
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Aufgabenstellung der Projektarbeit vor und führt den Leser in die Geschichte des Fernsehens und die Entwicklung der digitalen Übertragungstechnik ein. Kapitel 2 beschreibt die Technik DVB-T und erläutert die wichtigsten Bestandteile, insbesondere die Übertragung von MPEG-Datenströmen und die Modulation des Signals. Kapitel 3 behandelt die Inbetriebnahme von DVB-T Empfängern und der verwendeten Messsoftware. Kapitel 4 analysiert den DVB-T Datenstrom anhand von Software-Tools und untersucht die Dynamik der Bandbreite verschiedener Programme.
Schlüsselwörter
Die Projektarbeit befasst sich mit dem DVB-T Standard, der Protokollanalyse, MPEG-Datenströmen, der Bandbreitendynamik, der Software-Tools TSReader und DVBStreamExplorer und der Untersuchung der regionalen Programmangebote. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise der DVB-T Übertragungstechnik und untersucht die Dynamik der Bandbreite verschiedener Programme.
- Quote paper
- Meike Herbers (Author), 2007, Protokollanalyse bei DVB-T , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196963