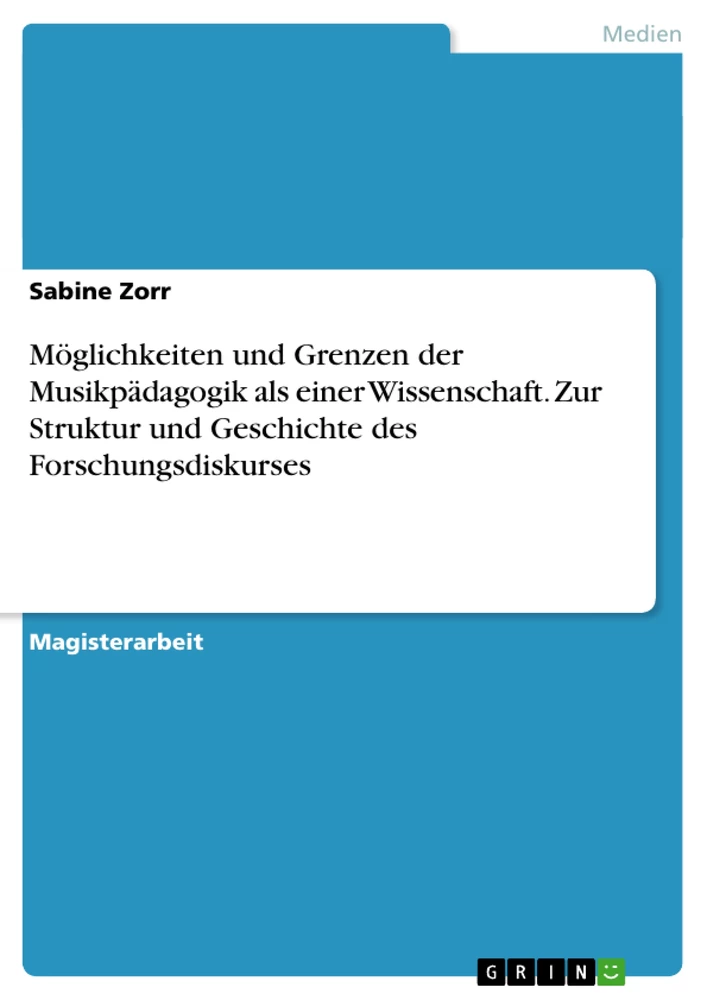Nach dem Zweiten Weltkrieg wird von Wissenschaftlern gefordert, die Musikpädagogik als Disziplin zu begreifen, deren Stellung innerhalb des Bildungskanons wissenschaftlich gefestigt werden muss. Bis heute gelingt es allerdings nicht ihrer Position als Wissenschaft Anerkennung zu verleihen. Diese Arbeit will belegen, dass die Ursache hierfür im historischen Rückblick zu finden ist. Sie wird aufzeigen, dass einer der Gründe für ein mangelndes Verständnis von Musikpädagogik als Wissenschaft in der bewußten oder unbewußten Adaption antiker Modelle sowohl der Musik als auch darüber hinaus der Musikpädagogik und des Wissenschaftsmodelles liegt.
Musikpädagogik besitzt seit der Antike innerhalb des Bildungskanons eine exponierte Stellung sowohl hinsichtlich ihrer Legitimation als auch hinsichtlich ihres Aufgabenbereiches. Keine andere Lehrdisziplin ist in ihrer Notwendigkeit und Zielsetzung derart hinterfragt worden, was insofern problematisch ist, als die Inhalte der Musikpädagogik sich durch die Zielsetzung der Lehre definieren:
Dies erklärt Intensität und Ausmaß des praxisbezogenen Ansatzes musikpädagogischer Ziel-Auseinandersetzungen. Denn die Ziele, zu denen musikalisches Lernen führen soll, bestimmen in der praktischen Musikpädagogik die Planung des Unterrichts, sind Maßstab aller Handlungen im Unterricht und entscheiden über Material, Arbeitsformen und Methoden.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. BEGRIFFSBESTIMMUNG
- II.1. "MUSIK"
- II.2. "PÄDAGOGIK"
- II.3. "MUSIKPÄDAGOGIK"
- II.4. ZUSAMMENFASSUNG
- III. MUSIKPÄDAGOGIK IN DER KLASSISCHEN ANTIKE
- III.1. PLATON
- III.1.1. Platons Verständnis von Musik
- III.1.2. Platons Ethoslehre
- III.2. DAS ARISTOTELISCHE MODELL DER MUSIKPÄDAGOGIK
- III.2.1. Allgemeines
- III.2.2. Aristoteles Modell der Musikpädagogik
- III.2.3. Erziehung als Staatssache
- III.2.4. Legitimation einer musikalischen Ausbildung
- III.2.5. Die Inhalte der aristotelischen Musikerziehung
- III.3. ZUSAMMENFASSUNG
- III.4. MUSIKPÄDAGOGIK IM WISSENSCHAFTSMODELL
- III.4.1. Das Platonische Wissenschaftsmodell
- III.4.2. Die Einzelwissenschaften des Aristoteles
- III.4.3. Theorie und Praxis der Musik in der Antike
- IV. REZEPTIONSMODELLE
- IV.1. REZEPTION IM 19. JAHRHUNDERT
- IV.1.1. Musikpädagogik im musikwissenschaftlichen System Guido Adlers
- IV.1.2. Rezeptionsgedanken
- IV.2. REZEPTION IM 20. JAHRHUNDERT: SELBSTÄNDIGKEIT DER MUSIKPÄDAGOGIK
- IV.2.1. Das Theorie-Praxis-Problem
- IV.2.3. Die Position der Musikpädagogik in der Wissenschaftsstruktur
- IV.2.3. Das Problem der Legitimation
- IV.3. ZUSAMMENFASSUNG
- V. MUSIKPÄDAGOGIK ALS EINZELWISSENSCHAFT
- V.1. MUSIKPÄDAGOGIK UND MUSIKWISSENSCHAFT
- V.2. PROBLEM DER LEGITIMATION VON MUSIKPÄDAGOGIK
- V.3. MUSIKPÄDAGOGIK IM WISSENSCHAFTSSYSTEM
- V.3.1. Der wissenschaftliche Gegenstandsbereich der Musikpädagogik
- V.3.2. Musikpädagogik und Musikpsychologie
- V.3.3. Die Rezeption des Theorie-Praxis-Problems
- VI. ZUSAMMENFASSUNG
- VII. LITERATUR
- VII.1. QUELLEN AUS DER KLASSISCHEN ANTIKE
- VII.2. QUELLEN AB DEM 19. JAHRHUNDERT
- VII.3. SEKUNDÄRLITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Musikpädagogik als Wissenschaft. Sie untersucht die historischen Wurzeln der Disziplin, insbesondere die Adaption antiker Modelle von Musik, Musikpädagogik und Wissenschaft. Ziel ist es, die Ursachen für die bisherige mangelnde Anerkennung der Musikpädagogik als eigenständige Wissenschaft aufzudecken.
- Die historische Entwicklung der Musikpädagogik als wissenschaftliche Disziplin
- Die Rezeption antiker Modelle und deren Einfluss auf die Entwicklung der Musikpädagogik
- Das Problem der Legitimation von Musikpädagogik im wissenschaftlichen Kontext
- Die Rolle der Musikpädagogik im Bildungssystem
- Die Beziehung zwischen Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Musikpsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Begriffsbestimmung von Musikpädagogik und beleuchtet die unterschiedlichen Verständnisformen des Begriffs im Laufe der Geschichte. Anschließend werden die musikpädagogischen Konzepte der klassischen Antike, insbesondere die Ansätze von Platon und Aristoteles, vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Integration der Musikpädagogik in das damalige Wissenschaftsmodell.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Rezeption antiker musikpädagogischer Modelle im 19. und 20. Jahrhundert. Der Einfluss von Guido Adler auf die Entwicklung der Musikwissenschaft und die Herausforderungen, die mit der Etablierung einer eigenständigen Musikpädagogik im 20. Jahrhundert verbunden waren, werden untersucht. Besonders behandelt werden die Debatten um das Theorie-Praxis-Problem, die Position der Musikpädagogik innerhalb des wissenschaftlichen Systems und die Frage der Legitimation.
Schließlich betrachtet die Arbeit die Aktualität bestimmter musikpädagogischer Fragestellungen und Problemfelder in der Gegenwart. Hierbei werden verschiedene Positionen und Ansichten von bekannten Musikpädagogen, Musikpsychologen und Musikwissenschaftlern vorgestellt, um ein umfassendes Bild der aktuellen Debatten zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Entwicklung, Legitimation und Positionierung der Musikpädagogik als Wissenschaft. Dabei spielen antike Konzepte von Musik und Musikpädagogik, die Rezeption dieser Modelle in der Neuzeit, das Theorie-Praxis-Problem sowie die Beziehung zwischen Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Musikpsychologie eine wichtige Rolle.
- Quote paper
- Sabine Zorr (Author), 2003, Möglichkeiten und Grenzen der Musikpädagogik als einer Wissenschaft. Zur Struktur und Geschichte des Forschungsdiskurses, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19686