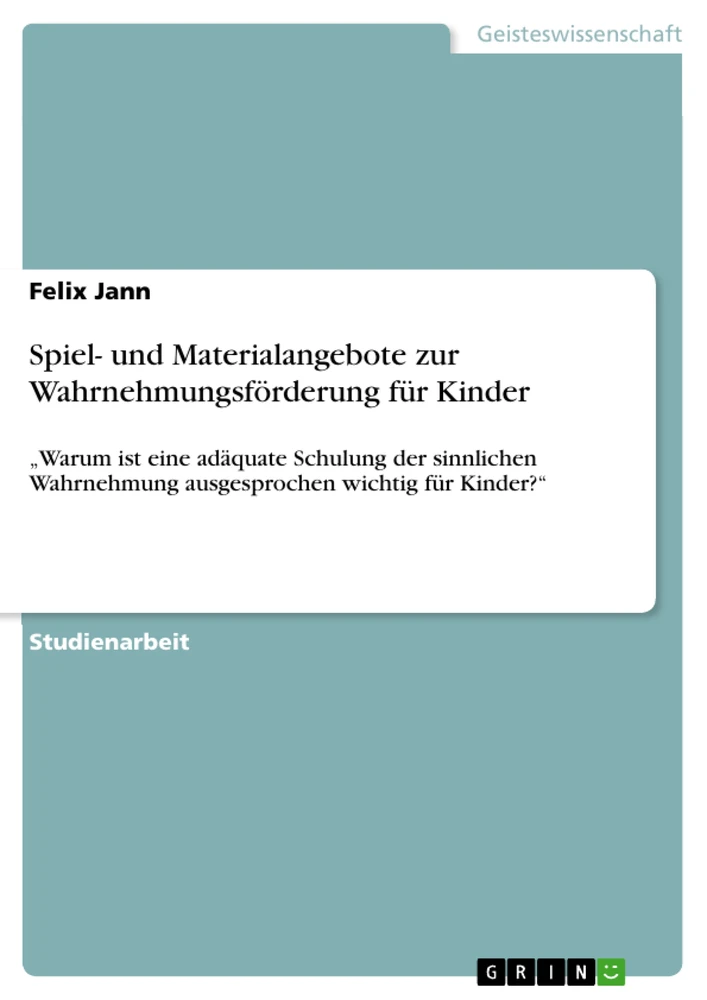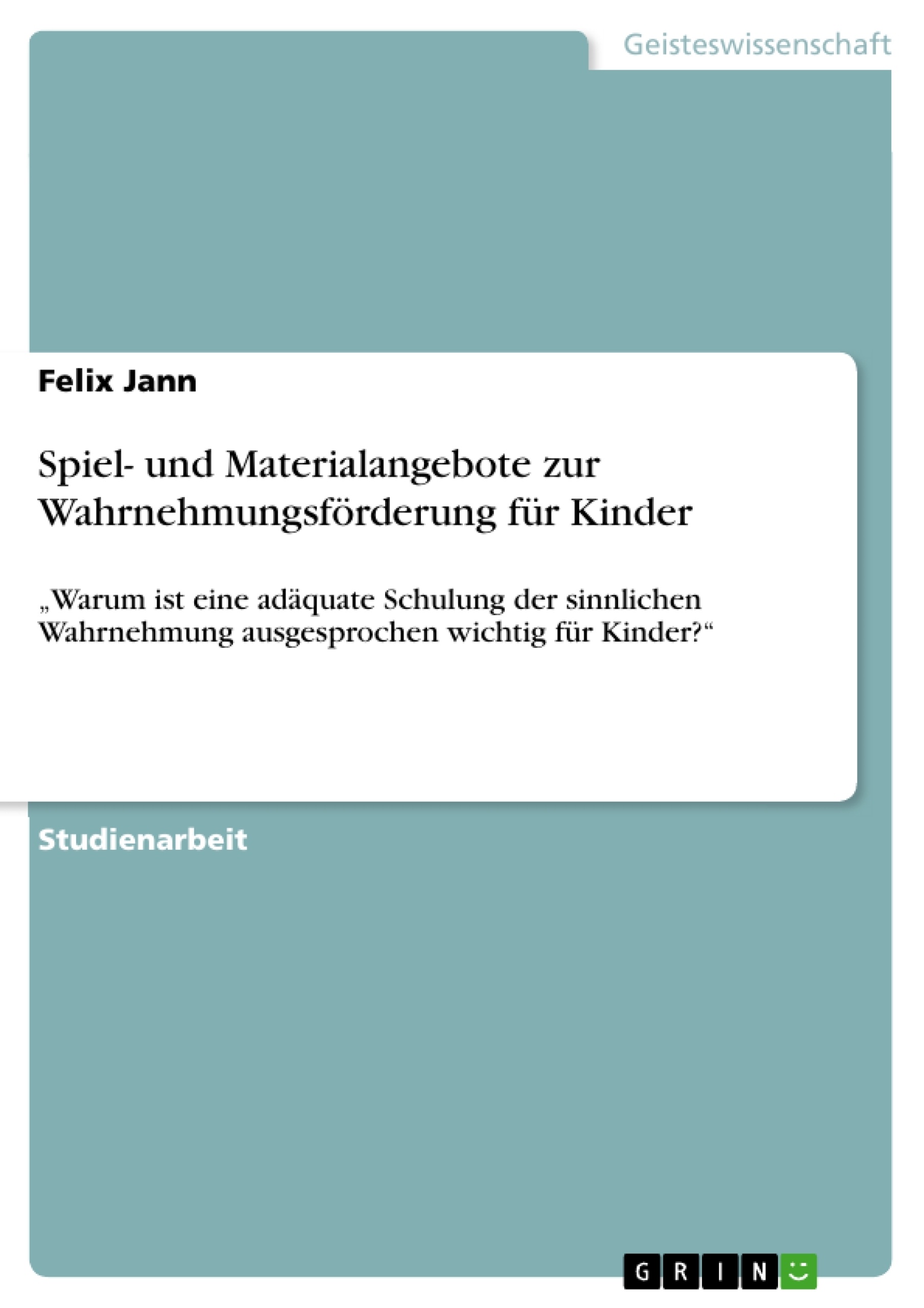In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich folgendem Thema zuwenden: Spiel- und
Materialangebote zur Wahrnehmungsförderung für Kinder. In diesem Kontext gehe
ich der Fragestellung nach: „Warum ist eine adäquate Schulung der sinnlichen Wahrnehmung
ausgesprochen wichtig für Kinder?“
Die Motivation meine Hausarbeit der Wahrnehmungsförderung zu widmen, entstand
aus meiner bisherigen praktischen Erfahrung mit Kindern. Ich bin seit über sieben
Jahren in einem Kinderheim tätig. Dort leben Kinder im Alter zwischen fünf und
dreizehn Jahren, die unterschiedliche Behinderungen aufweisen. Auf die einzelnen
Behinderungen möchte ich in dieser Arbeit nicht näher eingehen. Das Eingehen auf
die Behinderungen und den damit verbundenen Wahrnehmungsstörungen würde den
Rahmen dieser Hausarbeit überschreiten. Vielmehr möchte ich mich in dieser Arbeit
mit den allgemeinen Grundlagen der menschlichen Wahrnehmung auseinandersetzten
und erarbeiten, um mir ein gezieltes Wissen zur Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit
von Kindern anzueignen, welches ich dann in meine Arbeit mit Kindern übertragen
kann.
Die große Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung, der Pflege der Sinne für die Persönlichkeitsentwicklung
ist immer wieder und schon seit dem 16. Jahrhundert von
vielen Pädagogen und Denkern u.a. Comenius, Rousseau, Steiner und vielen mehr
betont wurden. In den letzten Jahren ist jedoch von einem Schwund der Sinneswahrnehmung,
von einseitiger Beanspruchung und Reizüberflutung die Rede. (vgl. Wilken
2001, S. 14)
Die vorliegende Arbeit nähert sich dem immer noch aktuellem Thema der sinnlichen
Wahrnehmung, indem sie zunächst eine Definition zur Wahrnehmung anführt, dann
die klassischen fünf Sinnesorgane beschreibt und anschließend praktische Spielangebote
zur Wahrnehmungsförderung für Kinder aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Wahrnehmung
- Die Sinnesorgane als Grundlage der Wahrnehmung
- Die taktile Wahrnehmung
- Die auditive Wahrnehmung
- Die visuelle Wahrnehmung
- Die gustatorische Wahrnehmung
- Die olfaktorische Wahrnehmung
- Einen Apfel wahrnehmen mit fünf Sinnen
- Spiel- und Materialangebote zur Förderung der Wahrnehmung
- Taktile Wahrnehmungsförderung
- Auditive Wahrnehmungsförderung
- Visuelle Wahrnehmungsförderung
- Gustatorische Wahrnehmungsförderung
- Olfaktorische Wahrnehmungsförderung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Spiel- und Materialangeboten zur Wahrnehmungsförderung für Kinder. Sie untersucht die Bedeutung einer adäquaten Schulung der sinnlichen Wahrnehmung für Kinder und erarbeitet ein gezieltes Wissen zur Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern, welches in die praktische Arbeit mit Kindern übertragen werden kann.
- Definition von Wahrnehmung und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Kindern
- Die fünf klassischen Sinnesorgane und ihre Rolle in der Wahrnehmung
- Praktische Spiel- und Materialangebote zur Förderung der verschiedenen Sinneswahrnehmungen
- Die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für die Persönlichkeitsentwicklung
- Der Einfluss von Wahrnehmung auf die Interaktion mit der Umwelt und die Bildung von subjektiven Vorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema der Wahrnehmungsförderung für Kinder vor und erläutert die Motivation und Zielsetzung des Autors.
- Definition von Wahrnehmung: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Wahrnehmung als aktiven Prozess, bei dem Kinder mit allen Sinnen ihre Umwelt erfassen und Informationen verarbeiten. Es wird betont, dass Wahrnehmung subjektiv ist und von persönlichen Erfahrungen und Eindrücken beeinflusst wird.
- Die Sinnesorgane als Grundlage der Wahrnehmung: Dieser Abschnitt beschreibt die fünf klassischen Sinnesorgane – Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken – und ihre Bedeutung für die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen. Es wird auch auf die Bedeutung der taktilen, auditiven, visuellen, gustatorischen und olfaktorischen Wahrnehmung eingegangen.
- Einen Apfel wahrnehmen mit fünf Sinnen: Dieses Kapitel demonstriert, wie die fünf Sinne zusammenarbeiten, um ein Objekt wie einen Apfel wahrzunehmen. Es verdeutlicht, dass die Wahrnehmung eines Objekts ein komplexer Prozess ist, der durch verschiedene Sinnesorgane und deren Interaktion geprägt ist.
- Spiel- und Materialangebote zur Förderung der Wahrnehmung: Dieser Abschnitt bietet praktische Beispiele für Spiel- und Materialangebote, die die verschiedenen Sinneswahrnehmungen bei Kindern fördern können. Es werden Beispiele für taktile, auditive, visuelle, gustatorische und olfaktorische Wahrnehmungsförderung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Wahrnehmung, Sinnesorgane, Wahrnehmungsförderung, Spiel, Material, Kinder, Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, subjektive Erfahrung, Umwelt, Sinneswahrnehmung, taktile Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, gustatorische Wahrnehmung, olfaktorische Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wahrnehmungsförderung für Kinder so wichtig?
Eine adäquate Schulung der Sinne ist die Basis für die Persönlichkeitsentwicklung und die Fähigkeit, Informationen aus der Umwelt korrekt zu verarbeiten.
Welche fünf klassischen Sinne werden unterschieden?
Man unterscheidet die taktile (Tasten), auditive (Hören), visuelle (Sehen), gustatorische (Schmecken) und olfaktorische (Riechen) Wahrnehmung.
Was versteht man unter "Reizüberflutung"?
In der modernen Welt leiden Kinder oft unter einer einseitigen Beanspruchung der Sinne, was zu einem Schwund der differenzierten Sinneswahrnehmung führen kann.
Wie kann man die taktile Wahrnehmung fördern?
Durch Fühlspiele, den Umgang mit verschiedenen Materialien (Sand, Wasser, Stoffe) und gezielte Tastübungen.
Ist Wahrnehmung subjektiv?
Ja, Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, der stark von persönlichen Erfahrungen und der individuellen Verarbeitung der Reize abhängt.
- Quote paper
- Felix Jann (Author), 2010, Spiel- und Materialangebote zur Wahrnehmungsförderung für Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196367