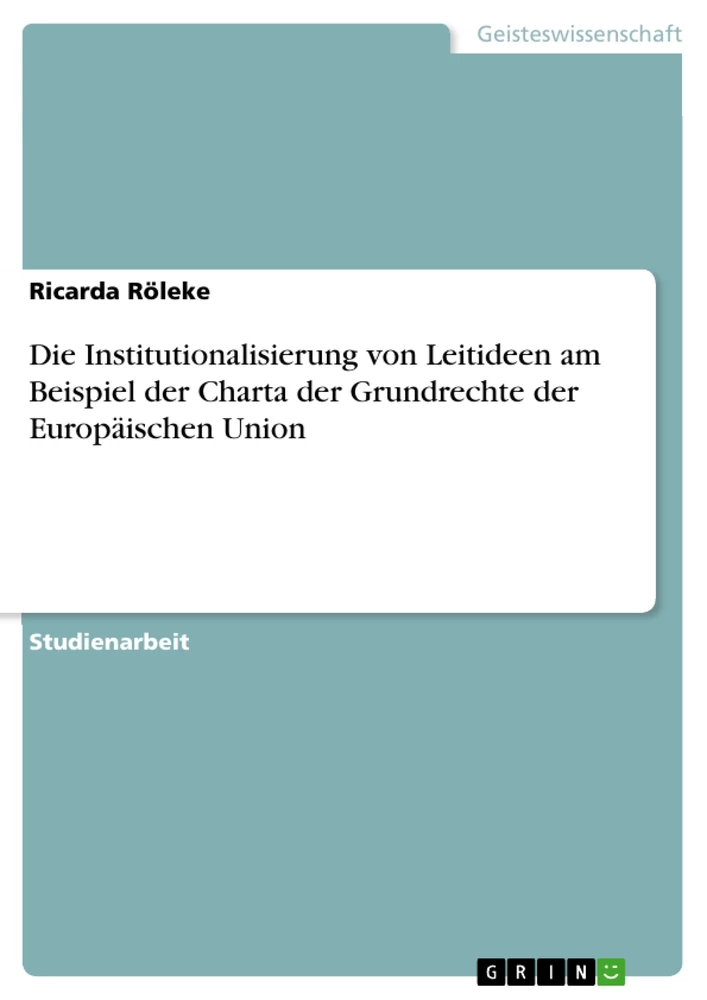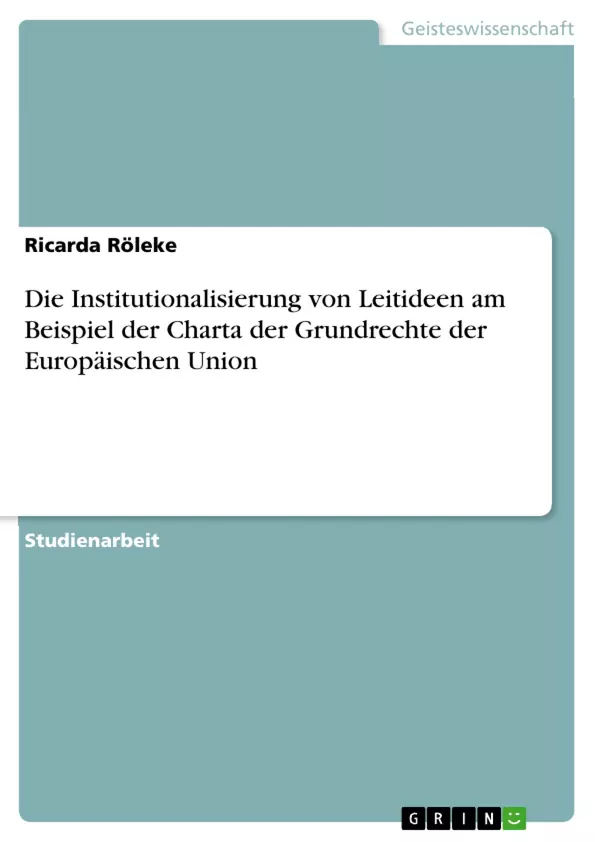Die Europäische Union hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte von einem reinen Wirtschaftsbündnis zu einer supranationalen Gemeinschaft weiterentwickelt. Sie ist ein in ihrer Struktur und Kompetenzfülle einzigartiges Gebilde, welches sich durch seine singuläre Stellung jedoch auch immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert sieht, für die vollkommen neue Lösungswege gefunden werden müssen. So haben die Mitgliedsstaaten im Zuge des europäischen Integrationsprozesses nicht nur zahlreiche Kompetenzen, sondern auch ein hohes Maß an Verantwortung an die EU abgegeben. Dies hat, so Kommissionspräsident Barroso, weitreichende Folgen für die Ausgestaltung der EU:
„In unserer globalisierten Welt von heute hat die Europäische Union die Aufgabe, den europäischen Bürgern zu mehr Wohlstand, Solidarität und Sicherheit zu verhelfen. Ohne einen gemeinsamen Bezugsrahmen, der uns hilft, die Vorgänge in unseren Gesellschaften zu interpretieren, [...] können wir das jedoch nicht in der geeigneten Weise leisten (Katsioulis/Maass 2007: 35).“
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist ein solcher potentieller gemeinsamer Bezugsrahmen, mit dessen Hilfe die EU dazu in der Lage sein könnte, zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Sie gilt als deutliches Indiz für den Wandel der Europäischen Union von einer Wirtschafts- zu einer Wertegemeinschaft. Um die Struktur und Wirkungsweise dieser neuen europäischen Institution besser zu verstehen, soll diese daher im Folgenden anhand des von Rainer Lepsius entwickelten Ansatzes der Institutionenanalyse genauer betrachtet werden. Eingangs wird dazu Lepsius' Theorie der Institutionalisierung von Leitideen kurz geschildert, bevor diese dann Anwendung auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union findet. Hierbei scheint eine Betrachtung der durch sie verursachten Folgen und möglicher Konflikte unerlässlich, um abschließend zu klären, welchen Stellenwert die Charta tatsächlich im Integrationsprozess der EU einnimmt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Institutionalisierung von Leitideen nach Rainer Lepsius
2.1 Institutionen als Verkörperungen von Leitideen
2.2 Der institutionelle Eigenschaftsraum
2.2.1 Die Konstituierung der Leitidee
2.2.2 Folgen der Institutionalisierung und Konfliktverarbeitung
3 Die Institutionalisierung von Leitideen am Beispiel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
3.1 Die Geschichte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
3.2 Menschenwürde als Leitidee der Grundrechte-Charta
3.3 Die Konstituierung der Leitidee in der Grundrechte-Charta
3.4 Die Grundrechte-Charta: Folgen und Konfliktpotential
4 Der Stellenwert der Charta im europäischen Integrationsprozess
5 Bibliografie
6 Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Charta der Grundrechte der EU?
Die Charta dient als gemeinsamer Bezugsrahmen für Werte und Grundrechte innerhalb der EU und markiert den Wandel von einer reinen Wirtschafts- zu einer Wertegemeinschaft.
Was versteht Rainer Lepsius unter der „Institutionalisierung von Leitideen“?
Nach Lepsius werden abstrakte Leitideen (wie Menschenwürde) durch Institutionen verkörpert und in einen strukturierten Handlungsrahmen übersetzt.
Welche Leitidee steht im Zentrum der Grundrechte-Charta?
Die Menschenwürde wird als die zentrale Leitidee analysiert, auf der die weiteren Bestimmungen der Charta aufbauen.
Welche Konflikte können durch die Charta entstehen?
Die Institutionalisierung kann zu Spannungen zwischen supranationalen Vorgaben und nationalen Rechtstraditionen der Mitgliedsstaaten führen.
Welchen Stellenwert hat die Charta im Integrationsprozess?
Sie gilt als wesentliches Instrument zur Stärkung der Identität und Solidarität der europäischen Bürger in einer globalisierten Welt.
- Arbeit zitieren
- MSc Ricarda Röleke (Autor:in), 2008, Die Institutionalisierung von Leitideen am Beispiel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196288