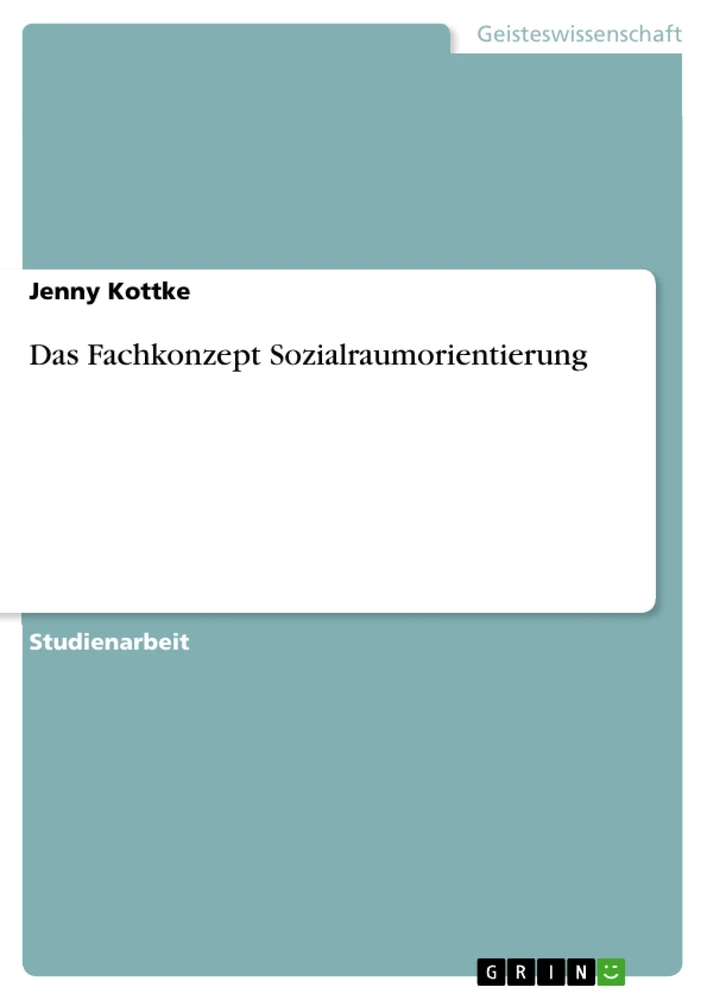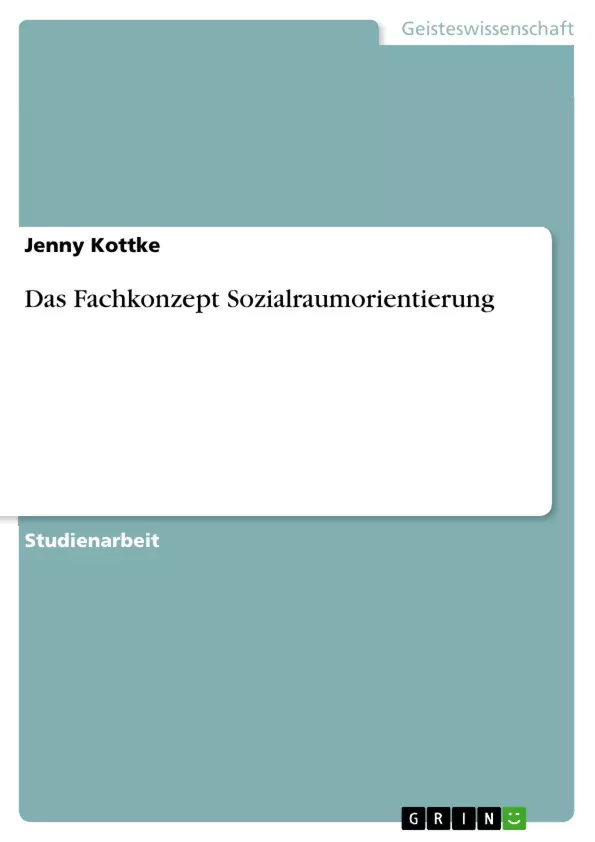Verändernde Lebensumstände, derzeitige Gesellschaftsstrukturen und neu entstandene Familiensituationen machen eine entsprechende Anpassung Sozialer Arbeit in allen Bereichen notwendig. Besonders die Segregation in einigen Teilen deutscher Städte macht den Kommunen und ihren Einwohnern zu schaffen. Seit mehreren Jahren wird zu diesem Thema in der Fachwelt diskutiert und es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, allerdings nicht ganz unumstritten. Die einen begrüßen die Sozialraumorientierung als sinnvolle Methode, die anderen bringen die Kritik hervor, dass der Begriff zunehmend inflationär und unscharf gebraucht wird. Zudem gibt es Vertreter der Position, die aufgrund der strengen Budgetierung eine Verminderung der Leistungsvielfalt sehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung
- Definitionen
- Sozialraum
- Lebenswelt
- Hilfen zur Erziehung
- Hilfeplan
- Geschichtlicher Hintergrund
- Elemente
- Kritik
- Definitionen
- Umsetzung im Bereich der Hilfen zur Erziehung
- Hilfen zur Erziehung in den nördlichen Stadtteilen Essens
- Darstellung des Problems
- Zielsetzung und konzeptionelle Vorstellung
- Umsetzung und Ergebnis
- Kurzer Vergleich zur sozialräumlichen Umsetzung in Cell
- Grenzen
- Hilfen zur Erziehung in den nördlichen Stadtteilen Essens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die konzeptionelle Umsetzung der Sozialraumorientierung im Kontext der Hilfen zur Erziehung gemäß §27 SGB VIII. Sie beleuchtet die Bedeutung dieses Ansatzes angesichts sich wandelnder Lebensbedingungen, gesellschaftlicher Strukturen und neuartigen Familiensituationen.
- Definition und Abgrenzung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung
- Relevante Begrifflichkeiten und ihre Bedeutung im Kontext der Sozialraumorientierung
- Historische Entwicklung und Ursprünge des Ansatzes
- Analyse der Umsetzung der Sozialraumorientierung in der Praxis anhand eines Beispiels
- Bewertung der Stärken, Schwächen und Grenzen der sozialräumlichen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sozialraumorientierung ein und erläutert die Relevanz dieses Ansatzes in der heutigen Zeit. Sie stellt die Problematik der Segregation in deutschen Städten heraus und beleuchtet die kontroverse Debatte um die Sozialraumorientierung in der Fachwelt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Fachkonzept der Sozialraumorientierung. Es werden relevante Begrifflichkeiten wie Sozialraum, Lebenswelt, Hilfen zur Erziehung und Hilfeplan definiert und deren Bedeutung im Kontext der Sozialraumorientierung erläutert. Zudem wird der geschichtliche Hintergrund des Ansatzes skizziert.
Das dritte Kapitel behandelt die Umsetzung der Sozialraumorientierung im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Es wird ein Beispiel aus den nördlichen Stadtteilen Essens vorgestellt, welches die Stärken und Grenzen der sozialräumlichen Arbeit aufzeigt. Ein kurzer Vergleich zur Umsetzung in der Stadt Celle soll die Darstellung abrunden.
Schlüsselwörter
Sozialraumorientierung, Hilfen zur Erziehung, Lebenswelt, Gemeinwesenarbeit, Segregation, Integration, Jugendhilfe, Sozialpädagogische Familienhilfe, Ressourcenaktivierung, Partizipation, Netzwerkbildung, Klientenzentrierung, Empowerment, Praxisbeispiel, EPSO-Projekt, Essener Stadtteile.
- Quote paper
- Jenny Kottke (Author), 2011, Das Fachkonzept Sozialraumorientierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196181