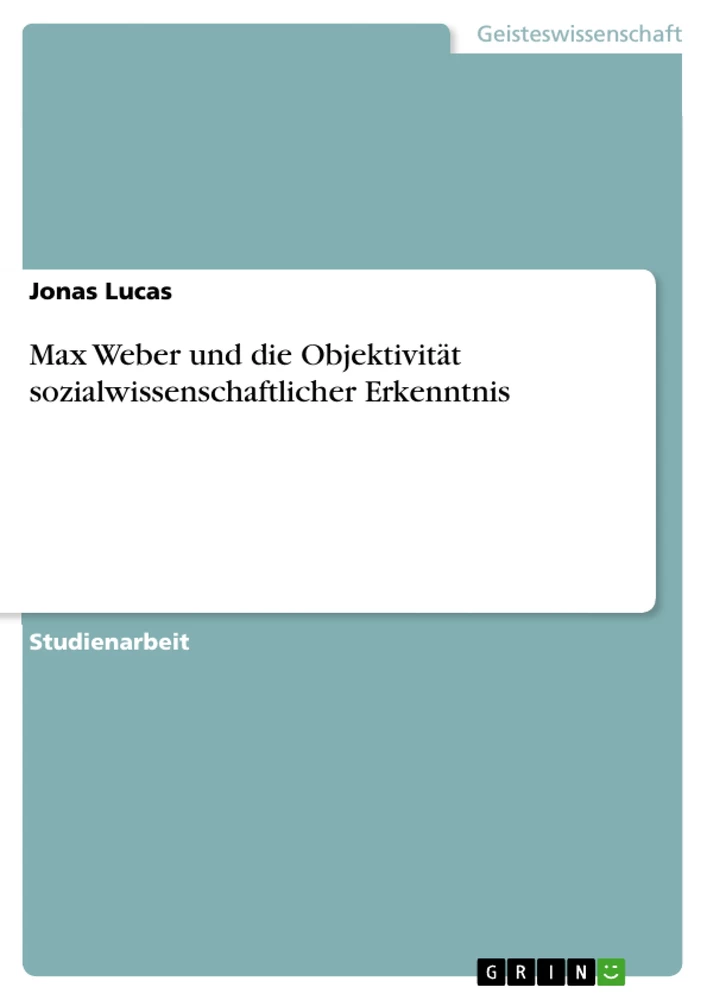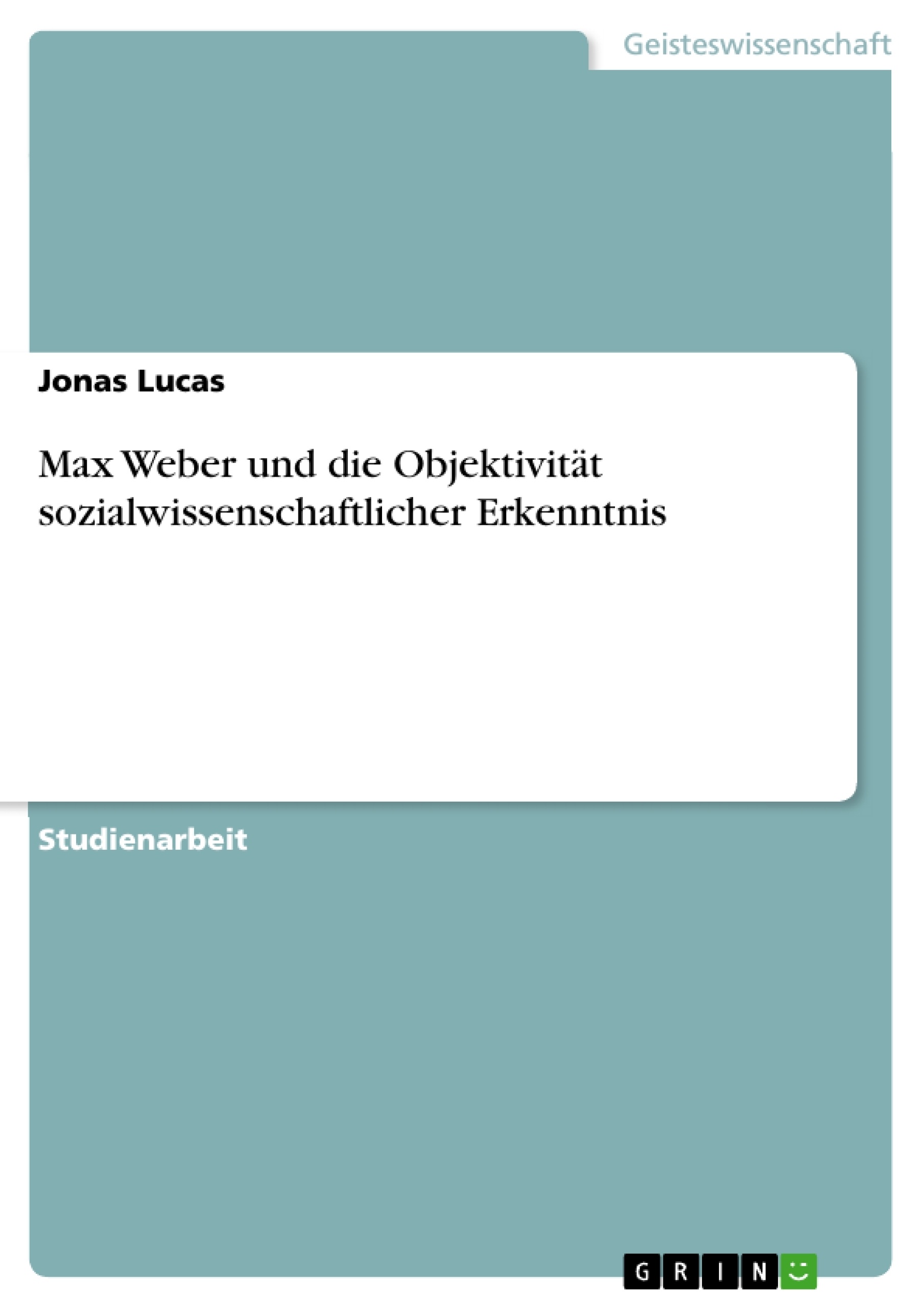Die Arbeit liefert einen Überblick über "die Objektivität der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis" von Max Weber und erklärt dessen Ansatz der Werturteilsfreiheit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Die Person Max Weber
3. Die Grundbegriffe
4. Analyse: „Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis“
4.1 Der Argumentationsgang
4.2 Webers Beispiel der „Interessen der Landwirtschaft“
5. Fazit
6. Literatur
1. Einführung
„Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis“ ist eines der berühmtesten Werke von Max Weber. Es stellte zu seiner Zeit eine große Neuerung für die Sozialwissenschaft dar und hat an seiner Wichtigkeit bis heute nichts eingebüßt. Diese Ausarbeitung erklärt die Argumentation und die wichtigsten Thesen Webers.
Dazu gibt Kapitel 2 zu Beginn einen knappen Überblick über das Leben Max Webers. Es wird gezeigt, wie vielseitig seine Interessen und wie groß sein Einfluss war. Kapitel 3 erklärt im Anschluss die für dieses Werk entscheidenden Grundbegriffe, den Idealtypus und die Werturteilsfreiheit. Im Folgenden geht Kapitel 4 direkt auf den Text ein. Es vollzieht Max Webers Gedanken- und Argumentationsgang nach und verdeutlich diese an einem Beispiel Webers.
Grundlage dieser Ausarbeitung ist der Text Webers, der durch zwei Standardwerke zu Person und Werk ergänzt wird um entscheidende Punkte detaillierter auszuführen.
2. Die Person Max Weber
Dieses Kapitel dient dazu Hintergrundinformationen zu Max Weber als Person bereitzustellen. Auf diesem Weg wird eine Grundlage zum besseren Verständnis seines Werkes geschaffen.
Weber wurde am 21.04.1862 als Karl Emil Maximilian Weber und ältester Sohn eines Juristen in Erfurt geboren. 1882 macht Max Weber sein Abitur in Charlottenburg. Anschließend studiert er, mit Unterbrechung durch seine Militärzeit in Straßburg, Jura, Nationalökonomie, Philosophie und Geschichte und macht seinen Abschluss in Jura.[1]
1889 promoviert er an der Friedrich- Wilhelms- Universität zu Berlin mit ‚magna cum laude’. Kurze Zeit später begann Weber als Rechtsanwalt zu arbeiten. 1894 übernahm er die Professur für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg. Dort hielt er auch seine berühmte Antrittsrede ‚Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik’ in der verschiedene Ausrichtungen der damaligen Wirtschaftswissenschaften kritisierte.[2]
In den folgenden Jahren litt Max Weber unter teilweise schweren Depressionen, die er ab 1900 behandeln ließ. Im Jahre 1903 tritt er vollständig von dem Tagesgeschäft an der Universität zurück.[3] 1904 veröffentlicht er die Schrift die Grundlage dieser Arbeit ist: ‚Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis’.
1909 gehörte er zu den Gründern des ‚Vereins für Sozialpolitik’, in dieser Zeit begann er auch erstmals sich als Soziologe zu bezeichnen. Daher kann davon gesprochen werden, dass Max Weber zu den Begründern der Soziologie gehört.[4] Als 1914 der 1. Weltkrieg ausbricht, wird Weber als Reserveoffizier eingezogen. Als Mitglied der Friedensdelegation nimmt er 1919 an den Verhandlungen in Versailles teil.[5] Im Jahre 1920 stirbt Max Weber in Folge einer Lungenentzündung in München.[6] Sein Werk kann in fünf große Bereiche unterteilt werden: in die Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Antike und des Mittelalters, die Arbeiten zur Sozial- und Wirtschaftsverfassung, die Religionssoziologie, die Methodik sowie die Wirtschaft, die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte.[7]
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Max Weber „wahrscheinlich der letzte Universalgelehrte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts [war und dank seiner vielfältigen Interessen] als Ökonom, Jurist, Historiker, Politikwissenschaftler und Soziologe“[8] gilt.
3. Die Grundbegriffe
Dieses Kapitel erklärt die Weberschen Grundbegriffe die in dem behandelten Text verwendet werden. Dabei werden sowohl der Idealtypus als auch die für Weber wichtige Werturteilsfreiheit erläutert.
Idealtypus
Der Idealtypus ist ein methodisches Mittel zur sozialwissenschaftlichen Analyse. Er hilft in der Analyse über die reine Definition hinauszukommen. Bei dem Bestimmen eines Idealtypus werden immer nur Teile der Wirklichkeit betrachtet, bestimmte Gesetzmäßigkeiten dieser Teile werden erarbeitet und dann anhand eines Modells dargestellt. Die Eigenschaften eines Idealtypus werden dabei immer überspitzt wiedergegeben. Sie stellen nicht die tatsächliche Wirklichkeit dar und diese kann auch nicht den Idealtypen zugeordnet werden, stattdessen wird die Wirklichkeit nur mit dem Idealtypus verglichen und anhand ihrer Unterschiede erklärt.[9] Die Wirklichkeit wird immer „nur indirekt, also im Modus der Abweichung von der als rein vorgestellten idealtypischen Begrifflichkeit“[10] erkannt. Daher kann der Idealtypus als „idealer Grenzbegriff“[11] bezeichnet werden, mit dem die Realität verglichen wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass es viele verschiedene Idealtypen gibt. Da für eine wissenschaftliche Analyse passende Begriffe benötigt werden, ist es entscheidend, dass möglichst viele Eigenschaften des zu untersuchenden Gegenstandes in dem Idealtypus enthalten sind. Hat der Idealtypus Lücken, hat auch die daraus folgende Analyse Lücken. Im Idealfall werden diese Lücken von dem Wissenschaftler erkannt und der Idealtypus dementsprechend angepasst. Diese Auseinandersetzung mit den vorhandenen Begriffen stellt den Fortschritt der sozialwissenschaftlichen Arbeit dar. Daraus ergibt sich, dass jede Zeit mit ihren eigenen Begriffen arbeitet.[12]
Werturteilsfreiheit
Max Weber sagt, dass Werturteilsfreiheit in der sozialwissenschaftlichen Arbeit unabdingbar ist, um eine rein wissenschaftliche Analyse zu ermöglichen. Allerdings geht er davon aus, dass eine Abbildung der Realität ohne Werturteile nicht möglich ist. Die sozialwissenschaftliche Arbeit bleibt daher immer Wertideen abhängig, auch wenn man sich dessen oft nicht bewusst ist. Dabei können diese Wertideen auch eine wichtige Rolle spielen, indem sie auf Probleme aufmerksam machen. Besonders Veränderungen der Wertvorstellungen nehmen Einfluss auf die wissenschaftliche Arbeit und treiben diese so voran. Die Werturteilsfreiheit ist aber das Ziel, nachdem in der sozialwissenschaftlichen Arbeit gestrebt werden sollte. Die ist besonders wichtig, wenn es zur Begriffs- und Theoriebildung sowie der Methodenauswahl und empirischen Analyse kommt.[13]
4. Analyse: „Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis“
Dieses Kapitel geht auf den vorliegenden Text, den eigentlichen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit genauer ein. Hierbei wird zuerst der Argumentationsgang Max Webers nachvollzogen und anschließend ein von ihm genanntes Beispiel zum besseren Verständnis genauer betrachtet.
4.1 Der Argumentationsgang
Max Weber beginnt seinen Artikel ‚Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis’ damit, dass er feststellt, dass es immer wieder Anläufe gibt Begriffe eindeutig festzulegen. Er betont jedoch, dass dies nicht möglich ist, weil kein Begriff die ganze Wirklichkeit darstellen kann.[14] Bei dem Versuch einer Begriffsbestimmung erhält man daher nur „relative Begriffe“ oder „abstrakte Idealtypen“. (OSE S.128). Daraus folgt, dass sich diese Begriffe mit den jeweils neuen Erkenntnissen ständig verändern, ein Weg wie sich, laut Weber, die sozialwissenschaftliche Arbeit weiter entwickelt. (OSE S.128)
[...]
[1] Vgl. Müller, Hans- Peter: Max Weber: Eine Einführung in sein Werk, Köln 2007, S. 27ff.
[2] Vgl. Kaesler, Dirk: Max Weber: Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung, Frankfurt 2003, S. 21f.
[3] Vgl. Müller: Max Weber, S. 32.
[4] Vgl. Kaesler: Max Weber, S. 29.
[5] Vgl. Müller: Max Weber, S. 33.
[6] Vgl. Kaesler: Max Weber, S. 39.
[7] Vgl. Müller: Max Weber, S. 36f.
[8] Vgl. ebd., S.11.
[9] Vgl. ebd., S. 64-67.
[10] Ebd., S. 67.
[11] Ebd., S. 65.
[12] Vgl. Müller. Max Weber, S. 66f.
[13] Vgl. ebd., S. 68-72.
[14] Weber, Max: Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, in: Wirth, Uwe: Kulturwissenschaft, Frankfurt 2008, S. 128. Im Folgenden wird dieses Werk im Fließtext unter der Abkürzung ‚OSE’ zitiert.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Max Weber unter "Werturteilsfreiheit"?
Weber fordert, dass Wissenschaftler ihre persönlichen Werte von der wissenschaftlichen Analyse trennen sollten, um objektive Erkenntnisse zu ermöglichen, auch wenn eine völlige Wertfreiheit in der Praxis schwer erreichbar ist.
Was ist ein "Idealtypus" in der Soziologie?
Ein Idealtypus ist ein methodisches Konstrukt, das bestimmte Merkmale der sozialen Wirklichkeit überspitzt zusammenfasst. Er dient als Vergleichsmaßstab, um die reale Welt und ihre Abweichungen besser zu verstehen.
Wann wurde das Werk "Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis" veröffentlicht?
Max Weber veröffentlichte diese bedeutende Schrift im Jahr 1904.
Warum gilt Max Weber als Mitbegründer der Soziologie?
Aufgrund seiner methodischen Arbeiten, der Gründung des Vereins für Sozialpolitik und seiner umfassenden Analysen zu Wirtschaft, Religion und Gesellschaft prägte er die Disziplin maßgeblich.
Können Begriffe laut Weber die ganze Wirklichkeit abbilden?
Nein, Weber argumentiert, dass Begriffe immer nur Teilaspekte der Realität erfassen können und sich mit neuen Erkenntnissen ständig weiterentwickeln müssen.
Welches Beispiel nutzt Weber zur Verdeutlichung seiner Thesen?
Er verwendet unter anderem das Beispiel der „Interessen der Landwirtschaft“, um den Argumentationsgang seiner Analyse zu veranschaulichen.
- Arbeit zitieren
- Jonas Lucas (Autor:in), 2012, Max Weber und die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196084