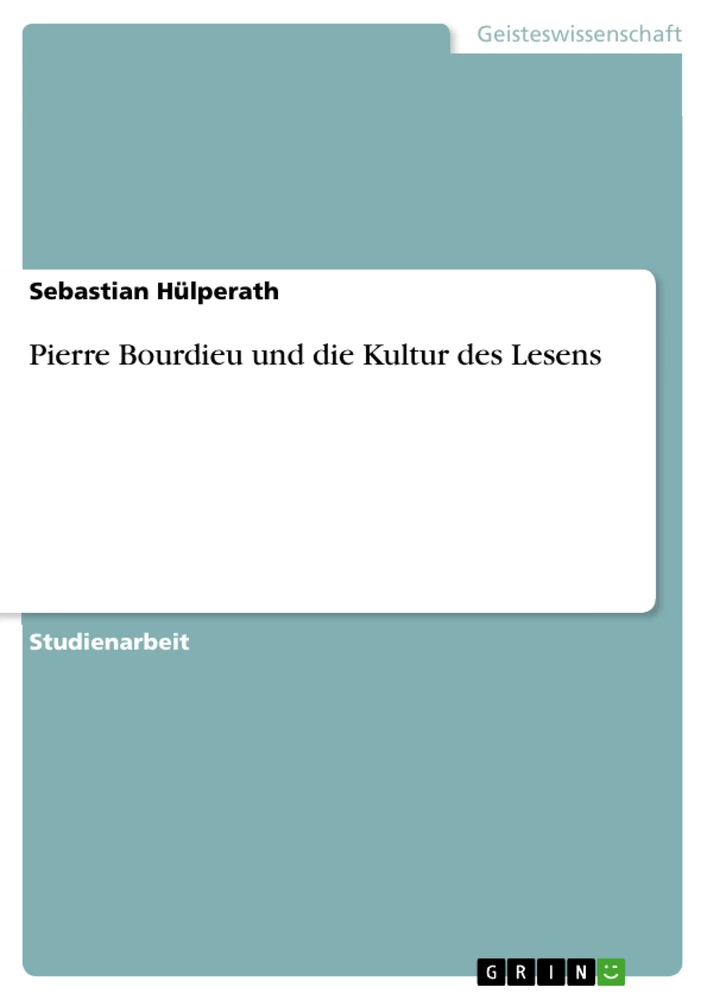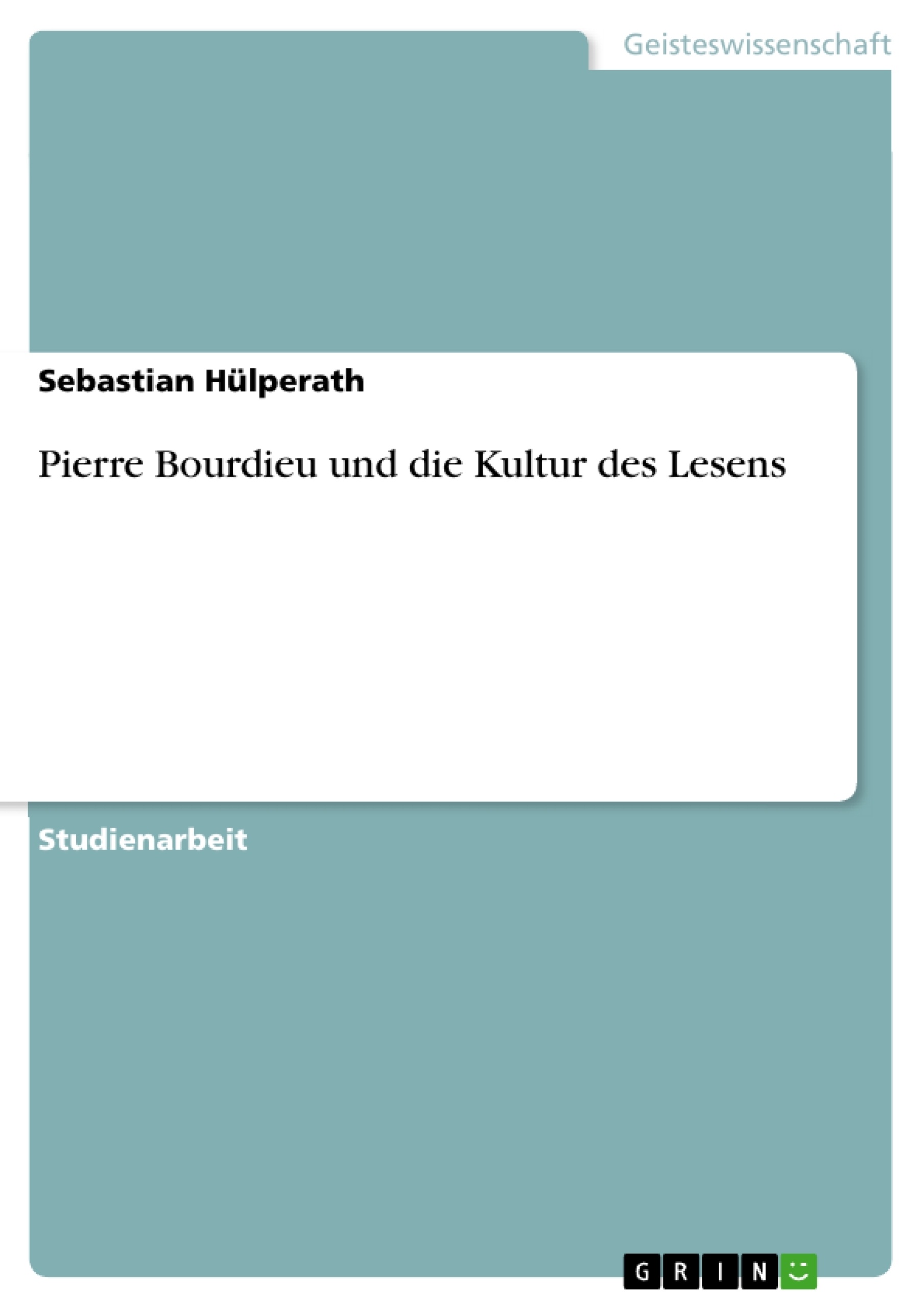Um die Lesekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler steht es eingedenk der Tatsache,
dass es in den vergangenen Jahren gelungen ist, selbige spürbar zu verbessern, nicht zum
Besten. Auch die vierte PISA-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (vgl. OECD), deren Schwerpunkt auf der Fähigkeit zu lesen lag, hat in ihrer
im Jahr 2009 durchgeführten Erhebung ergeben, dass sich Deutschland, im Vergleich zu den
anderen 34 OECD-Mitgliedsstaaten, nur im Mittelfeld befindet (vgl. OECD 2010). [...] Aus diesem vordergründig bildungspolitischen Thema lässt sich jedoch eine weitaus breitere
Tragweite extrahieren, welche nicht nur auf der Mikroebene zu einer gesellschaftlichen
Diversität hinsichtlich der Lesefähigkeit führt, sondern auch auf der Makroebene eine
Entwicklung vorauszeichnet, die eine Veränderung der intrinsischen Bedeutungszuweisung
zeigt. So sind wir alle in unserem Alltag ständig von Objekten umgeben, denen wir eine
symbolische Bedeutung zumessen, die über ihren bloßen Sachwert hinaus geht und die in uns
verinnerlichte Handlungs- und Denkmuster aktivieren (vgl. Bourdieu 1989, S. 172 f.). Für die
einen hat der überdimensionale Flachbildfernseher eine besondere Bedeutung, für die anderen
sind es Bücher, die nicht einfach in einer Schublade im Schrank verstaut werden, sondern als
Ausweis höherer Geistigkeit inszeniert werden und in Vitrinen eben diese repräsentieren
sollen. Neben dieser Darstellung des eigenen Lebensstils, bieten Bücher auch die Gelegenheit
der Lektüre des menschlichen Gegenübers – vorausgesetzt, die Bibliothek vergegenwärtigt
die Bildung ihres Inhabers und es wurden nicht nur Potemkin’sche Dörfer errichtet.
Auch aus dem hier nur kurz skizzierten Bedeutungsrahmen, welchen das Lesen einnehmen
kann, lässt sich die soziologische Relevanz dieses Lesens extrahieren. Die Kultur des Lesens
stellt daher auch in den von Pierre Bourdieu beschriebenen Vorgängen im sozialen Raum
einen nicht ignorierbaren Mikrokosmos dar, welcher in dieser Arbeit zunächst anhand des
kulturellen Kapitalbegriffs Bourdieus beschrieben wird. Sodann wird auf den Habitus-Begriff
eingegangen, bevor das Lesen als kulturelle Praxis sowie dessen Einfluss auf die
gesellschaftlichen Ordnungssysteme erläutert wird.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Kulturelles Kapital
1.1. Inkorporiertes Kulturkapital
1.2. Objektiviertes Kulturkapital
1.3. Institutionalisiertes Kulturkapital
2. Habitus
3. Lesen als kulturelle Praxis
4. Elitäre Codes
Schluss
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Sebastian Hülperath (Author), 2011, Pierre Bourdieu und die Kultur des Lesens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196046