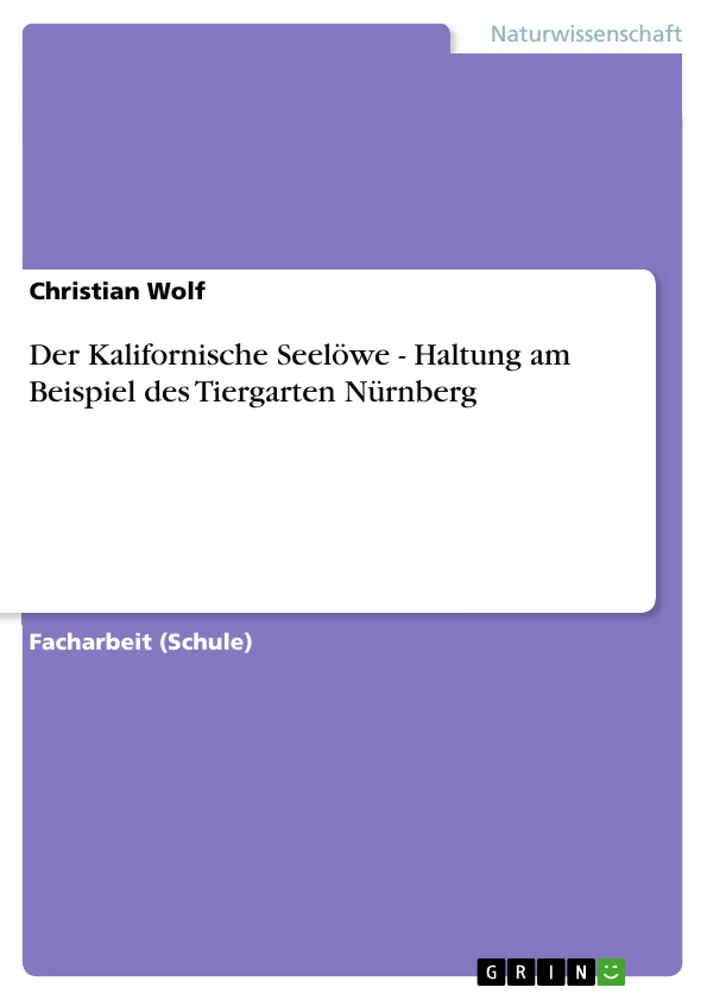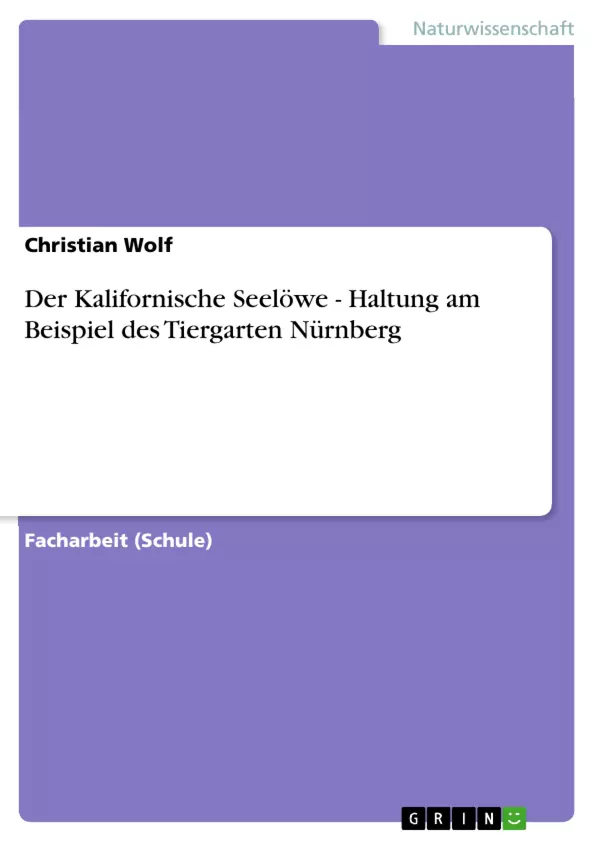Ziel der Seminararbeit war es, die Haltungsbedingungen des Kalifornischen Seelöwen anhand des Tiergarten Nürnberg darzustellen.
Meine Seminararbeit stellt zunächst das Tier im Allgemeinen dar. Der „Stammbaum“ des zu den Ohrenrobben gehörenden Raubtiers wird vorgestellt. Die Anatomie und sein äußeres Erscheinungsbild werden verdeutlicht. Es wird festgehalten, dass sich die Nahrungsgewinnung stark von einem in Freiheit lebenden Artgenossen unterscheidet. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Nahrung sind zwar keine Defizite erkennbar, jedoch wirft die „Verabreichung“ der Nahrung Fragen auf. Der tote Fisch wird bei den Fütterungen direkt ins Maul des Tieres geworfen, was in Kontrast zur Jagd der Nahrung in freier Wildbahn steht. Eine ausdrückliches gesetzliches Verbot einer Lebendfütterungen kann ich nicht bestätigen, vielmehr scheint dies im Konflikt zur artgerechten Haltung nach dem Tierschutzgesetz stehen. Die Heimat des Kalifornischen Seelöwen sind für gewöhnlich die Sandstrände an der Küste zwischen Kanada und Nordmexiko. Desweiteren werden die Paarung, die Fortpflanzung, sowie die Aufzucht der Jungtiere präsentiert. Kernthematik ist die Haltung in Gefangenschaft am Beispiel des Tiergarten in Nürnberg. Aktuell teilen sich sechs ausgewachsene Seelöwinnen mit ihren drei Jungtieren das Gehege im „Aquapark“ mit zwei Seehunddamen. Das Gehege und die Tiere werden genauer beschrieben. Eine gemeinsame Haltung der beiden Tierarten erweist sich laut dem Zoopersonal als unproblematisch.
Offen blieb leider weiterhin die Frage der Möglichkeit einer Lebendfütterung.
Im Gehege könnte die Insel vergrößert werden, um allen Seelöwen genügend Liegeflächen zu bieten. Eine Liegefläche aus Sand würde sich anbieten.
Abschließend möchte ich mich noch einmal bei Frau Krüger für die kompetente Betreuung und den angenehmen Kontakt bedanken. Der Zooleitung danke ich für die Möglichkeit eine praxisbezogenen Seminararbeit erstellen zu können.
Inhalt
1. Publikumsliebling „Kalifornischer Seelöwe“
2. Allgemeines zum Kalifornischen Seelöwen
2.1 Systematik
2.2 Anatomie
2.3 Ernährung
2.4 Verbreitungsgebiet
2.5 Lebensweise
3. Der Kalifornische Seelöwe im Tiergarten Nürnberg
3.1 Gehegebeschreibung
3.1.1 Blick auf das Gehege
3.1.2 Stall und Futterküche
3.1.3 Unterwassergang
3.2 Technische Informationen
3.3 Beschreibung der Tiere im Nürnberger Tiergarten
3.3.1 Der Seelöwenbulle „Patrick“ im Tiergarten Nürnberg
3.3.2 Seelöwenkühe mit ihren Seehundbabys im Tiergarten Nürnberg
3.4 Interaktion zwischen Mensch und Tier
4. Zusammenleben mit Seehunden
4.1 Informationen zu Seehunden im Tiergarten
4.2 Gründe für eine gemeinsame Haltung zusammen mit den Seelöwen
Literaturverzeichnis
1. Publikumsliebling „Kalifornischer Seelöwe“
Der Begriff „Zoo“, wie wir ihn heute kennen, erinnert fast immer zuerst an die Tiervorführungen „exotischer“ Tiere aus fremden Ländern. In diesen Vorführungen werden häufig Seelöwen gezeigt. Die schwarzen Wasserraubtiere begeistern durch Sprünge durch Reifen und durch das Jonglieren von Bällen. Sie springen auf Kommando scheinbar mühelos aus dem Wasser, folgen den Anweisungen des Pflegers und eilen durch das Wasser. Die Kalifornischen Seelöwen begeistern auch im Nürnberger Tiergarten sichtlich die Besucher, nicht selten verweilen hier größere Menschenmassen.
Im Folgenden werde ich die Faszination „Kalifornischer Seelöwen“ vorstellen und auf die Haltungsbedingungen in Gefangenschaft am Beispiel des Tiergartens Nürnberg eingehen.
2. Allgemeines zum Kalifornischen Seelöwen
2.1 Systematik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Systematik des Kalifornischen Seelöwen
Der Zalophus californianus, besser bekannt als „Kalifornischer Seelöwe“ gehört wie der Galápagos-Seelöwe (Zalophus wollebaeki) und der Japanische Seelöwe (Zalophus japonicus) zur Gattung der Seelöwen (Zalophus).[1] Da sich diese einzelnen Arten in Körperbau und Körpergröße stark voneinander unterscheiden ist eine Unterscheidung eher unproblematisch. Es wird jedoch erst seit einer aktuellen Einteilung nach WILSON und REEDER im Jahre 2005 von jeweils eigenständigen Arten ausgegangen.[2]
Diese Gattungen werden der Familie der Ohrenrobben zugerechnet, die „von den Schildkröteninseln an nach Norden hin bis zur Behringstraße die amerikanische und von der Behringstraße an bis zu den japanischen Gewässern die asiatische Küste des Stillen Ozeans und seiner Teile bevölkert“.[3] Die Pflegerin Stefanie Krüger erklärt, bei männlichen Seelöwen spreche man auch von Bullen, bei den weiblichen Tieren von Kühen.[4]
Die Seelöwen gehören zur Ordnung der Raubtiere. Der Bau des Gebisses und des Körpers zeigt, die Verwandtschaft zu anderen Raubtiere.
2.2 Anatomie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Kalifornische Seelöwe ist schlank gebaut und weniger untersetzt, als andere Robben.[5]
Abb. 2: Exemplare des Kalifornischen Seelöwen im Tiergarten Nürnberg
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Fell der Tiere erscheint im nassen Zustand dunkelbraun bis schwärzlich und scheint bei Trocknung heller. Die natürliche Färbung unterscheidet sich sowohl von Tier zu Tier, als auch zwischen den Geschlechtern, wobei die Bullen meist ein dunkleres Fell mit einer helleren Bauch- und Seitenfärbung haben. Bei ihnen ist das kurze Fell vereinzelt auch gefleckt oder rötlich glänzend. Bei den Kühen hingegen erscheint es in der Regel in einem bräunlichen Farbton.[6] Nach der Geburt ist das Fell der Jungtiere „schieferfarben“ oder „grauschwarz“ und nach einem Jahr „nussbraun“ gefärbt – man spricht jetzt von einem „Jährling“.[7]
Zwischen dem Fell und dem wärmeisolierenden Speckmantel im Unterhautbindegewebe haben die Tiere kein Unterfell, wie dies bei anderen Arten der Fall ist. Begründen ist dies schlichtweg am natürlichen Lebensraum.[8]
Ausgewachsene Seelöwen erreichen teilweise Längen von bis zu 5 Metern und ein maximalen Gewicht von über 500 kg, generell liegen die Durchschnittswerte jedoch deutlich darunter.[9] Die ausgewachsenen Männchen sind meist bei einer Größe von 250 cm etwas mehr als 200 kg schwer. Mit 175 cm Länge und weniger als 100 kg im Durchschnitt sind die Weibchen um einiges leichter und kleiner.[10]
Die Geschlechter unterscheiden sich also hinsichtlich Körperlänge und Gewicht stark voneinander. Man spricht hier von einem ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus, der evolutionär begründet ist.[11]
Die sonst für männliche Bullen typischen Barthaare, die Vibrissen, fehlen beim Kalifornischen Seelöwen.[12]
Tierforscher sehen große Ähnlichkeiten hinsichtlich des Aufbaus zwischen dem Schädel der Ohrenrobben und dem eines Bären, der ebenfalls zur Ordnung der Raubtiere gerechnet wird. „Das starke Gebiss ist typisch für Raubtiere“, zu denen die zutraulich scheinenden Robben gehören.[13]
Mit den spitzen Eckzähnen wird die Nahrung zerrissen und mit den Backenzähnen zermalmt.[14] Die starken mechanischen Belastungen haben zu Veränderungen im Gebiss geführt und eine Adaption der Wirbelsäule „im Hals- und Brustwirbelbereich bewirkt“.[15]
Ohrenrobben können sich an Land leichter fortbewegen, nachdem sich die Gruppe der Robben bereits zu Beginn des Tertiärs langsam aus einer im Wasser lebenden Raubtiergruppe entwickelt haben. Da „im Mitteltertiär […] die Hunds- und Ohrenrobben als eigenständige Entwicklungslinien vertreten [waren]“ haben sich bei dieser Art speziell die hinteren Extremitäten nicht so stark zurückgebildet, wie dies beispielweise bei den Seehunden der Fall ist. Dadurch können die Tiere diese unter ihren Körper bringen und sich auch an Land relativ flink und sicher fortbewegen.[16]
2.3 Ernährung
Zur bevorzugten Beute der Seeraubtiere zählen Kleinfische, aber auch Lachse, Tintenfische und Krebse.[17] Die Jagd macht in freier Wildbahn einen erheblichen Anteil des Tagesablaufs aus.[18] Im Zoo werden die Fütterungen zumeist mit Dressuren und Vorführungen kombiniert. Hierbei werden auch die Tiere auf Verletzungen am Körper und Veränderungen im Gebiss hin untersucht. Sie bekommen in Gefangenschaft zusätzlich zu den aufgetauten Seefischen, wie Heringe und Makrelen, Nahrungsergänzungsmittel. Die bei der Lagerung bei rund -40° C verlorenen Vitamine E, sowie Salze werden täglich, Vitamin B alle zwei Tage in Tablettenform verabreicht. An warmen Tagen liegt der Bedarf an Fisch bei rund 30- 35 kg Fisch, d.h. 5- 6 kg je Tier. Bei Seelöwenbullen und an kühleren Tagen ist der Bedarf wesentlich höher.[19]
Nach Aussage der Pflegerin ist eine Lebendfütterung aus Tierschutzgründen nach dem TierSchG nicht erlaubt. In §2 TierSchG scheint der Gesetzgeber dies nicht zu verbieten, vielmehr wird dies hier scheinbar explizit gefordert: Jeder der „ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat (in diesem Fall der Zoo), muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen“. Zu einer artgerechten Haltung gehört sicher nicht zuletzt ein „Enrichment“ durch eine raubtiergerechte Fütterung, da das Ziel „ eine möglichst an den ursprünglichen Verhaltensweisen und Lebensraumbedingungen der domestizierten Tiere orientierte Form der Tierhaltung [ist]“[20] Durch die Haltung „darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so [eingeschränkt werden], dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden“.[21] Durch eine adäquate Fütterung könnte man sicher den Instinkten des Tieres gerecht werden, die in freier Wildbahn durch die Jagd der Beutetiere zum Ausdruck kommen.
[...]
[1] Vgl. http://www.frontiersinzoology.com/content/4/1/20; 17.10.11
[2] Vgl. http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41666/0, 06.09.11
[3] Vgl. Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 476
[4] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 14
[5] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 15
[6] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 14
[7] wie 3, Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 476
[8] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 15
[9] wie 3, Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 476
[10] Vgl. http://www.zooschule-hannover.de/material/Tierinfos/seeloewe.pdf, 05.09.11
[11] Vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Geschlechtsdimorphismus.html, 05.09.11
[12] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 15
[13] Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 16
[14] wie ³, Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 477
[15] wie 13 , Vgl. Pflegergespräch am 26.08.11, Frage 16
[16] wie ³, Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 476
[17] wie 3, Der Große Brehm, Band 1, Säugetiere Teil 1, Safari Verlag, Berlin, 1964, S. 476
[18] wie 2, http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41666/0, 06.09.11
[19] Fütterungsplan, 26.09.11
[20] http://www.umweltlexikon-online.de/RUBnaturartenschutz/ArtgerechteTierhaltung.php, 26.10.11
[21] Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html, 26.10.11
- Arbeit zitieren
- Christian Wolf (Autor:in), 2011, Der Kalifornische Seelöwe - Haltung am Beispiel des Tiergarten Nürnberg, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196018