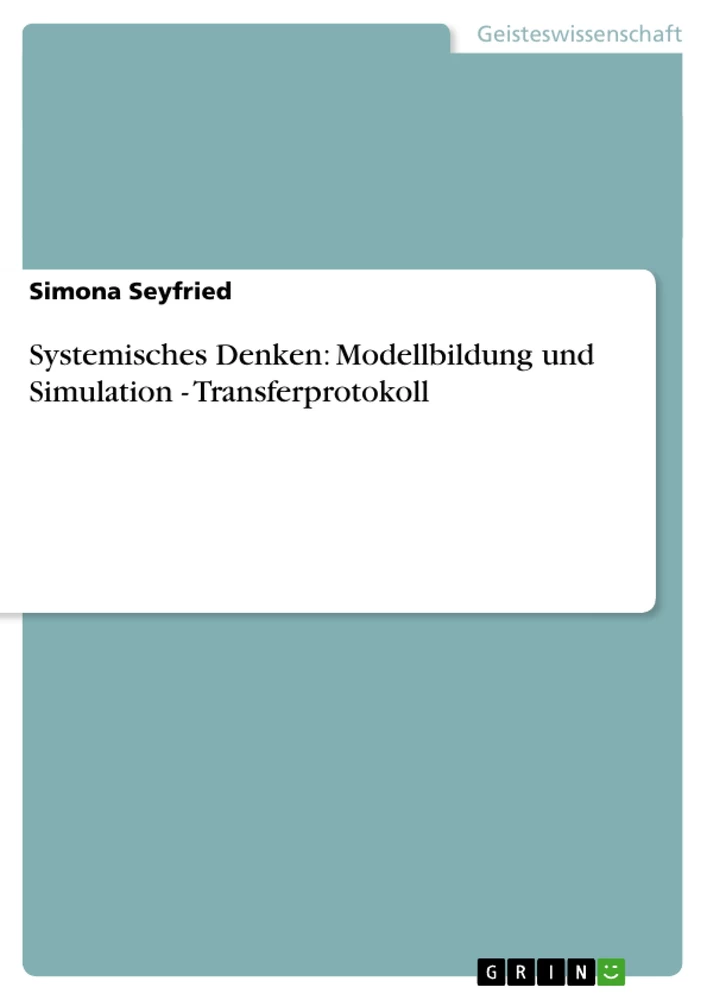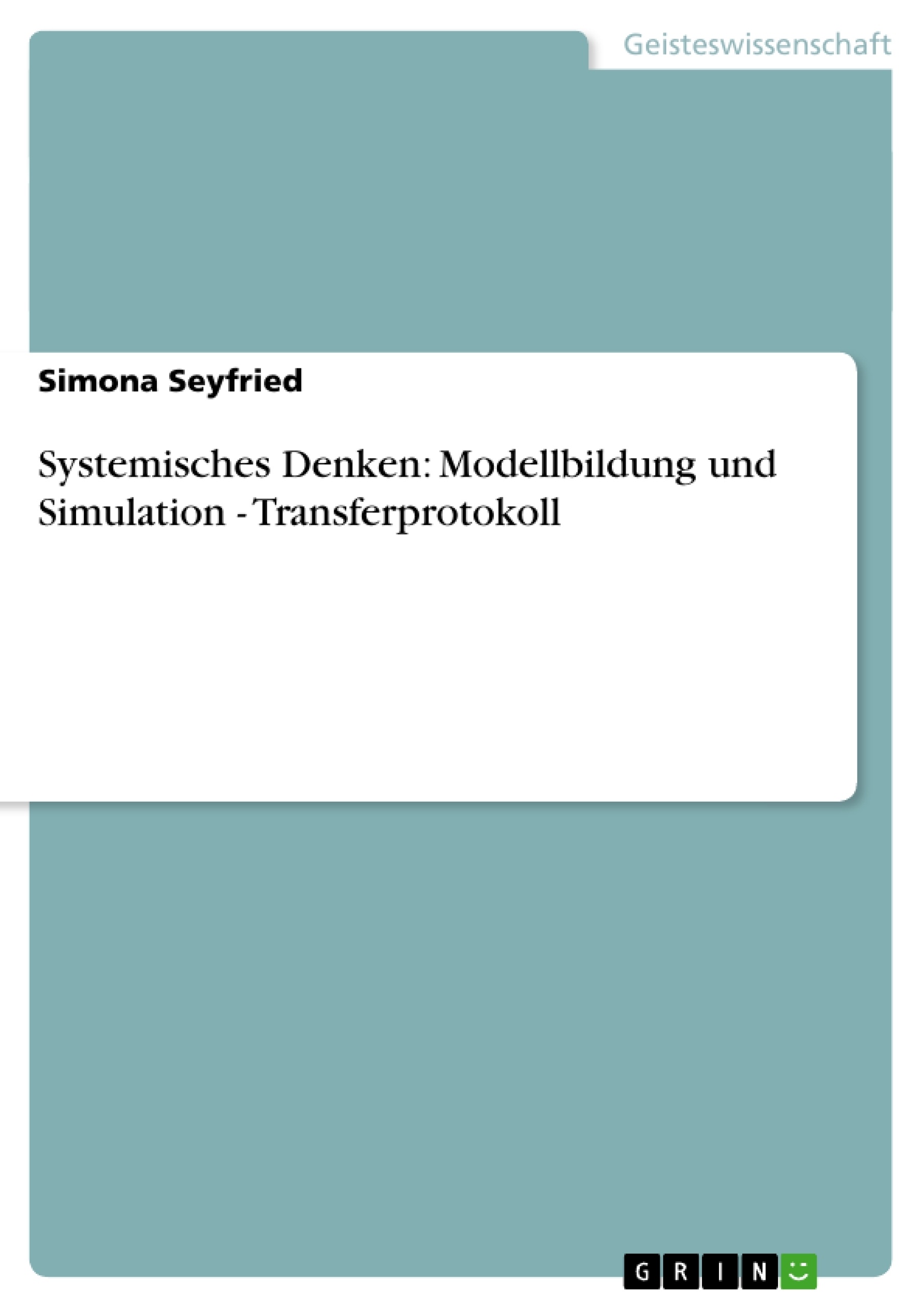Reflexion über den eigenen Wissenserwerb im Seminar:
Vor Beginn der Veranstaltung, hatte ich keine konkreten Ideen, darüber wie die kommenden drei Tage ablaufen werden. Bereits der Start in das Seminar, war erfrischend anders, als in anderen Kursen die ich im Laufe meines Studiums belegt hatte.
Eine Zusammenarbeit mit Kommilitonen, aus unterschiedlichen Fachrichtungen, war für mich neu, spannend und auch etwas anstrengend. Im Laufe der Studienzeit hat es sich ergeben, dass ich meistens mit den selben Personen aus meinem Studiengang, gemeinsame Referate oder Projekte realisierte. Zum einen aus organisatorischen,- und kursbedingten Gründen, zum anderen weil es eben „bequem“ ist möglichst mit den gleichen Leuten zusammen zu treffen. Ich wurde zum „Gewohnheitstier“, wählte die augenscheinlich bequemere Variante und hatte so keine „großen Überraschungen“ zu erwarten. Über das Für und Wider dieser Praxis habe ich schon oft reflektiert.
Persönliches Transferprotokoll
1. Reflexion über den eigenen Wissenserwerb im Seminar
Vor Beginn der Veranstaltung, hatte ich keine konkreten Ideen, darüber wie die kommenden drei Tage ablaufen werden. Bereits der Start in das Seminar, war erfrischend anders, als in anderen Kursen die ich im Laufe meines Studiums belegt hatte. Eine Zusammenarbeit mit Kommilitonen, aus unterschiedlichen Fachrichtungen, war für mich neu, spannend und auch etwas anstrengend. Im Laufe der Studienzeit hat es sich ergeben, dass ich meistens mit den selben Personen aus meinem Studiengang, gemeinsame Referate oder Projekte realisierte. Zum einen aus organisatorischen,- und kursbedingten Gründen, zum anderen weil es eben „bequem“ ist möglichst mit den gleichen Leuten zusammen zu treffen. Ich wurde zum „Gewohnheitstier“, wählte die augenscheinlich bequemere Variante und hatte so keine „großen Überraschungen“ zu erwarten. Über das Für und Wider dieser Praxis habe ich schon oft reflektiert. Nachteile wie z.B. mangelnde Flexibilität, eingefahrene Rollen oder immer gleich bleibende Lösungsansätze bzw. Arbeitstechniken der Gruppenmitglieder liegen auf der Hand. Die Hochschule ist durch ihren familiären Charakter in vielerlei Hinsicht eine „Oase“ des Wohlbefindens. Jedoch, sind die allermeisten Seminare1 im frontalen Unterrichtsstil gehalten und damit sehr verschult, was meiner Meinung nach alte Verhaltensmuster aus der Schulzeit hervorruft. Wie viele andere Studenten auch bemühte ich mich wenig, eigene Gedanken zu entwickeln. Dies hat zum Resultat, dass viele Dinge, die für den jeweiligen Studiengang und für die spätere Berufspraxis wichtig wären, nach der Klausur wieder vergessen werden.
In diesem Seminar ging es aber gerade nicht darum, nur zu „konsumieren“, sondern eigene Ideen, Fragen und Lösungsansätze im Team2 zu entwickeln. Für das spätere Arbeitsleben, mit all seinen unvorhersehbaren Herausforderungen, war dieser Kurs eine nachhaltig wirkende Erfahrung. Im Wesentlichen habe in diesem Seminar gelernt, dass es nicht immer nur darum geht, ein „astreines“ Ergebnis zu präsentieren, sondern Prozesse zu schätzen, die zu einem Ergebnis oder zu neuen Fragen führen. Vielfach ist es im Problemlösungsprozess sogar hilfreicher neue Fragestellungen zu entwickeln, als auf vorschnelle Ergebnisse zu vertrauen. Dieser Weg ist für mich ein Schlüssel, um mich persönlich, fachlich und im Team weiterzuentwickeln. Insbesondere fand ich die Einführung in die Systemtheorie sehr wertvoll, obwohl ich diese, zu Beginn der Veranstaltung, erwartet hätte. Systemische Ansätze haben in den letzten Jahrzehnten in der Sozialen Arbeit eine Aufwertung erfahren und ihnen wird zunehmend wissenschaftliche Bedeutung geschenkt z.B. Sylvia Staub- Bernasconi. Zum Leidwesen vieler angehenden Studenten, lernen wir nicht ausreichend, welchen Stellenwert Systemtheorien in der Sozialen Arbeit haben, obwohl wir als angehende Sozialarbeiter alle „systemisch“ denken sollten, um den größeren Zusammenhang und strukturelle Ursachen von einer sozialen Problemlage zu erfassen und entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln. Erst im 7. Semester habe ich einen kleinen Einblick in das systemisches Denken gewonnen, und bin nun motiviert mir die wissenschaftlichen Grundlagen3, die für meinen Fachbereich relevant sind, anzueignen. Es wäre peinlich und anmaßend, mit Begriffen um sich zu werfen, die man selbst nicht versteht.
2. „Modellbildung und Simulation“- eine eigene Beurteilung der Methoden
Da ich nur sehr wenig Erfahrungen mit diesen Methoden gesammelt habe, benötige ich noch vertiefendes Wissen bevor ich diesem Gebiet qualifizierte Aussagen treffen kann. Deshalb kann ich im Folgendem die Methoden der „Modellbildung und Simulation“ oberflächlich und laienhaft beurteilen.
2.1 Stärken der Methode
Ich denke, dass die Methode für erfahrene Praktiker ein nützliches Mittel ist, um. Probleme in Systemen zu erkennen. Zum Beispiel kann sie helfen in Krisengebieten, Schwierigkeiten in Systemen jeglicher Art zu erkennen und zu erforschen sowie dazu dienen vorsichtige Prognosen für die Zukunft zu formulieren. Die Methode der Modellbildung und Simulation ist anschaulich, nicht statisch und fördert Teamgeist, Kreativität und Ausdauer. Diese Arbeitsweise fordert den ganzen Menschen, mit all seinen fachlichen, geistigen und sozialen Eigenschaften der Mitarbeiter zum Vorschein und nutzt Synergieeffekte, die in der Zusammenarbeit entstehen.
2.2 Schwächen der Methode
Vermutlich ist die Methode der Modellbildung und Simulation für Laien, insbesondere aus nicht- technischen Berufen,4 schwerer zu bewerkstelligen als für versierte Computernutzer. Deshalb könnte ich mir Vorstellen, dass die Ausbildung lange Erfahrung und Praxis braucht. Erst nach dieser Phase können diese Personen, die dann inzwischen zu Experten in der Modellbildung und Simulation geworden sind, Modelle konstruieren welche die der Wirklichkeit5 so authentisch wie möglich wiedergeben. Es kann aber auch bei erfahrenen Wissenschaftlern vorkommen, dass die Modelle nicht stimmen oder falsch angelegt sind. Des Weitern kann aufgrund des Abstraktionsgrades, der Simulation bzw. des Sachverhaltes es schwierig sein, außenstehenden Personen zu vermitteln, wie man durch diese Methode auf die jeweiligen Ergebnisse kam. Dies könnte sich negativ auf eine transparente Arbeitsweise auswirken und befördert so eher Misstrauen.
2.3 Möglichkeiten
Herkömmliche Sichtweisen, Weltanschauungen und Glaubenssätze die zu „bewährten“ aber eigentlich ineffektiven Lösungsansätzen führen, können hinterfragt, entkräftet oder erweitert werden. Auf wirtschaftliche, soziale, technische. Fragen kann diese Methode neue Perspektiven und Handlungsstrategien eröffnen.
2.4 Risiken
Möglicherweise kann die Methode der Modellbildung und Simulation, Risiken in sich bergen, wenn das Modell falsch konstruiert worden ist z.B. aufgrund falscher Annahmen. Auch Berechnungsfehler könnten evtl. bei der Simulation auftreten, die zu weiteren Fehlern führen könnten, wenn der Fehler nicht frühzeitig entdeckt wird. Ich glaube, dass ein Modellbau6 lange Zeit braucht um fertig gestellt zu sein, bis dahin können sich aber die äußeren Gegebenheiten wieder verändert haben. Auch möchte ich an dieser Stelle, meine Befürchtung äußern, dass mit dieser Methode bestimmte Machtinteressen durchgesetzt werden können, sei es von Wissenschaftlern oder von Politikern. Ein weiteres Risiko besteht eventuell darin, dass man mit dieser Methode möglichst alle Dinge erklären möchte, wohingegen Kersten Reich anführt: „Kein Modell passt auf alles, keine Analyse ist vollständig(..)“ (vgl. Reich 2008, S.50). Demzufolge stelle ich mir eine Gruppe von Experten vor, die auf ihrem „Elfenbeinturm der Wissenschaft“ sitzen und nur noch diese Methode als einzige Lösung7 für alle Probleme betrachten. Dieser Habitus könnte dazu führen, dass andere Meinungen oder sogar Kritik nicht mehr zugelassen werden können.
[...]
1 In den meisten Fällen, handelt es sich dabei um die Pflichtveranstaltungen. Aufgrund von teilweise sehr hohen Teilnehmerzahlen, ist ein Frontalunterricht nicht immer zu vermeiden.
2 vgl. Richmond Paper o.J., S. 116
3 z.B. von Peter Lüssi oder Silvia Staub- Bernasconi
4 Für Menschen die nur eingeschränkte Computerkenntnisse haben oder nicht gerne am Computer arbeiten möchten, kann es schwer sein, sich mit dem Programm Heraklit o.ä. auseinanderzusetzen.
5 System, Phänomen, Faktoren exakt beschreiben, Fragestellungen exakt formulieren etc.
6 z.B. bei sehr komplexen Thematiken
7 vgl. Gespräch mit Prof. Bresinsky im Seminar
- Arbeit zitieren
- Simona Seyfried (Autor:in), 2012, Systemisches Denken: Modellbildung und Simulation - Transferprotokoll, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194800