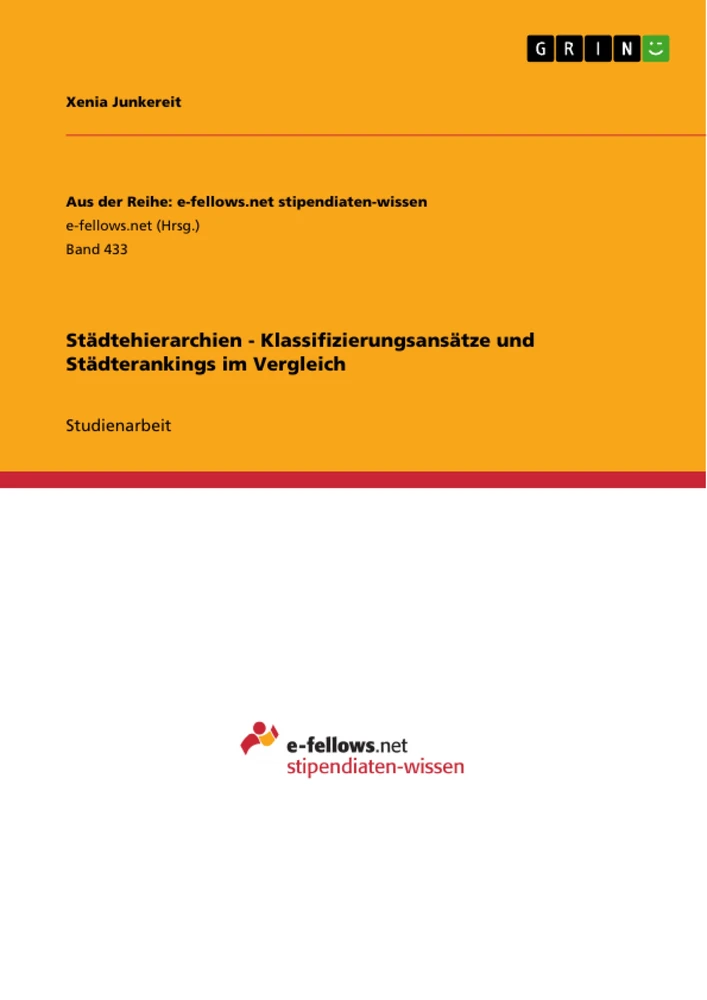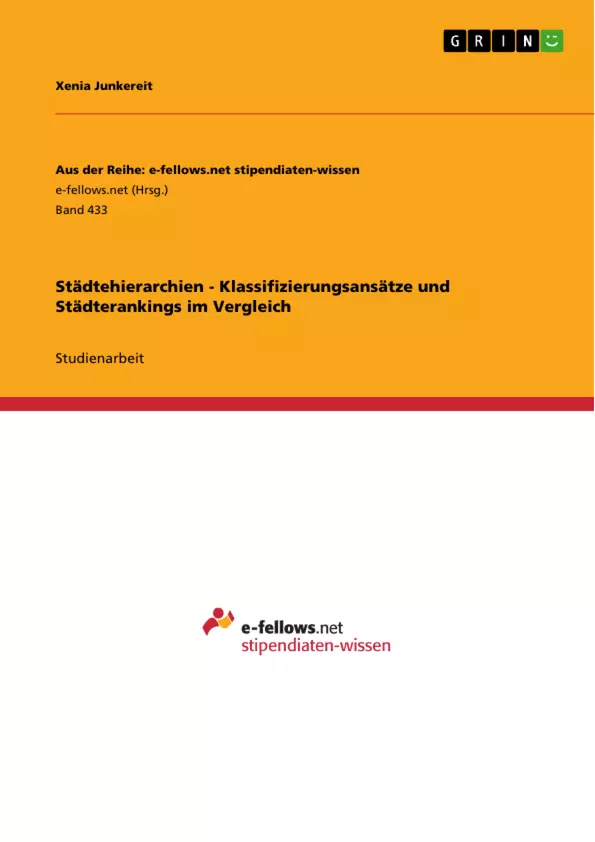Städte spielten schon immer eine wichtige geostrategische Rolle und solange es Städte gibt, gab es scheinbar auch immer die Unterscheidung zwischen bedeutenden und weniger bedeutenden Städten.
Beispielsweise hatte das antike Byzanz zu seiner Blütezeit um 500 n. Chr. sowohl im politischen, ökonomischen und kulturellen Bereich eine deutlich höhere Ausstrahlungskraft, als etwa Athen oder Rom, die zwar bedeutende Agglomerationen in ihrer Region darstellten, jedoch zu der Zeit ihren ursprünglichen Einfluss weitgehend eingebüßt hatten. Hier lässt sich deutlich erkennen, dass die Bedeutung, die man bestimmten Städten zuschreibt dem zeitlichen Wandel unterliegt.
Was lässt aber den Schluss zu, dass Byzanz um 500 n. Chr. einen solch hohen Bedeutungsüberschuss im Vergleich zu anderen Städten hatte? Welches sind die Kriterien und Parameter, nach denen ein solcher Bedeutungsüberschuss gemessen werden kann? Zu Zeiten des Byzantinischen Reiches ist dies noch relativ einfach zu beantworten: Byzanz war zu der Zeit Sitz der wichtigsten weltlichen und religiösen Herrscher, es war Handelsknotenpunkt und lag auf den bedeutendsten Pilgerrouten ins Heilige Land.
Nach welchen Maßstäben beurteilt man aber heutige Städte, um auf ihre Bedeutung im Vergleich zu anderen Agglomerationen zu schließen? Im welchem Umfang müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, um eine Stadt als bedeutend zu klassifizieren? Und auf welcher Maßstabsebene untersucht man die Beziehung von Städten untereinander?
Inhaltsverzeichnis
- PROLOG
- STÄDTEHIERARCHIEN
- attributive" versus „relationale“ Hierarchisierungsansätze
- Walter Christallers „System zentraler Orte“ ein Beispiel für „attributive“ Hierarchisierungsansätze
- Methodik
- Kritik
- Peter J. Taylors „World City Network“ ein Beispiel für „relationale“ Hierarchisierungsansätze
- Methodik
- Kritik
- GaWC- Globalization and World Cities Research Network
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Städte hierarchisch geordnet werden können. Sie analysiert verschiedene Ansätze zur Hierarchisierung von Städten, sowohl attributive als auch relationale. Ziel ist es, die Methodik und Wirkung dieser Ansätze zu beleuchten und eine Synthese über den möglichen Sinn und Zweck von Städtehierarchien zu wagen.
- Analyse verschiedener Hierarchisierungsansätze für Städte
- Unterscheidung zwischen attributiven und relationalen Ansätzen
- Bewertung der Methodik und Wirkung der verschiedenen Ansätze
- Diskussion des Sinns und Zwecks von Städtehierarchien
- Bedeutung von Städten im globalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Im Prolog wird die Bedeutung von Städten im historischen Kontext aufgezeigt und die Frage nach den Kriterien für die Bestimmung von Städtehierarchien gestellt. Kapitel 2 stellt verschiedene Hierarchisierungsansätze für Städte vor, darunter das „System zentraler Orte“ von Walter Christaller und das „World City Network“ von Peter J. Taylor. Es werden auch die methodischen Ansätze und die Kritik an den jeweiligen Theorien beleuchtet. Des Weiteren wird das GaWC- Globalization and World Cities Research Network vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Begriffe wie Städtehierarchien, attributive und relationale Hierarchisierungsansätze, System zentraler Orte, World City Network, GaWC, Megastadt, Global City und Weltstadt. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Klassifizierung von Städten und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Bewertung von Städten im globalen Kontext.
- Quote paper
- Xenia Junkereit (Author), 2011, Städtehierarchien - Klassifizierungsansätze und Städterankings im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194031