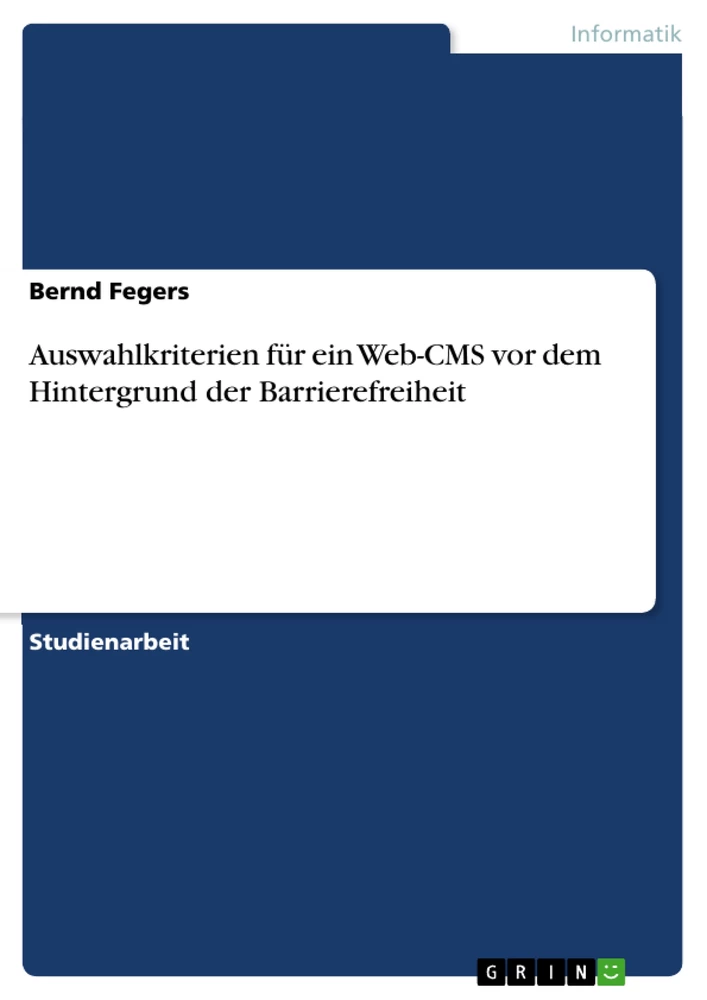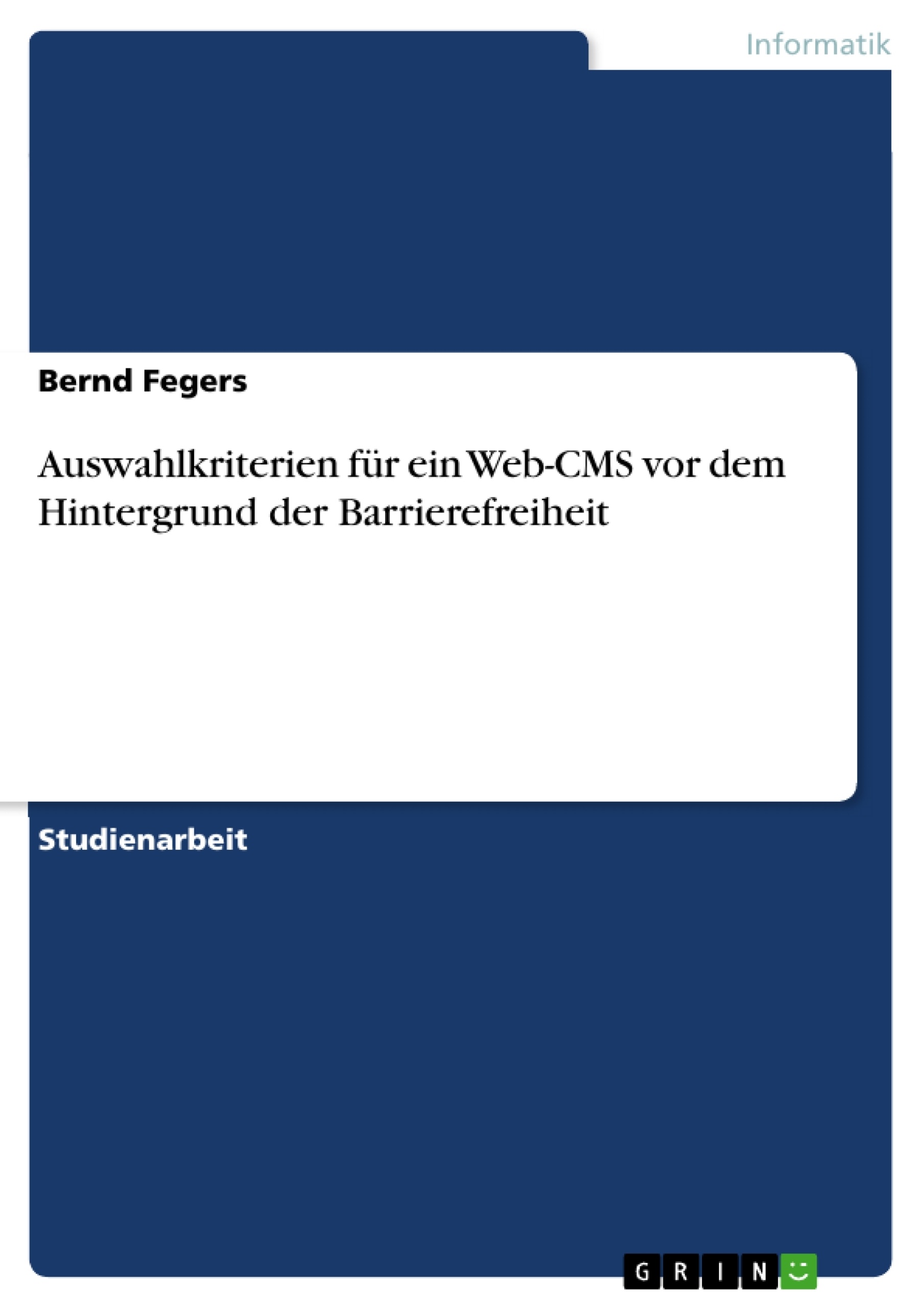Zur Pflege und Aktualisierung moderner Webangebote kommen verstärkt Web Content Management Systeme zum Einsatz. Sie unterstützen den Grundsatz der Trennung von Layout und Inhalt und bieten den Vorteil, dass quasi Jedermann Webseiteninhalte erstellen und aktualisieren kann, weil hierzu nicht mehr zwingend technische Kenntnisse erforderlich sind.
Gleichzeitig hat der Begriff der Barrierefreiheit in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen – für Bundesbehörden ist ein barrierefreies Webangebot seit dem Jahr 2002 sogar verpflichtend. Barrierefreiheit zielt darauf ab, das Internet mit seinen Angeboten und Möglichkeiten allen Nutzern gleichermaßen zugänglich zu machen, auch wenn diese körperlich eingeschränkt sind – beispielsweise durch Seh-, Bewegungs- oder kognitive Behinderungen – und unabhängig vom verwendeten Endgerät, Eingabegerät oder Browser.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, inwiefern Web Content Management Systeme bei der Erstellung barrierefreier Webseiten unterstützen können. Es werden die Anforderungen beleuchtet, die verschiedene Richtlinien zur Barrierefreiheit stellen und auf Auswahlkriterien eingegangen, die in diesem Zusammenhang bei der Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes WCMS-System hilfreich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Web Content Management
- Barrierefreiheit
- Richtlinien für barrierefreie Webseiten
- Umsetzung mittels eines Web Content Management Systems
- Barrierefreiheit des Content Management Systems selbst
- Unterstützung bei der Erstellung barrierefreier Webseiten
- Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Systems
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswahlkriterien für ein Web Content Management System (CMS) vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Sie beleuchtet die Bedeutung von barrierefreien Webangeboten und analysiert, wie ein CMS bei der Umsetzung dieser Richtlinien unterstützen kann.
- Definition und Bedeutung von Barrierefreiheit im Web
- Relevante Richtlinien und Normen für barrierefreie Webangebote
- Funktionsweise und Einsatzgebiete von Content Management Systemen
- Kriterien für die Auswahl eines barrierefreien CMS
- Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung durch ein CMS bei der Erstellung barrierefreier Webseiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel erläutert die Bedeutung von Web Content Management Systemen (CMS) und die steigende Bedeutung von Barrierefreiheit im Internet. Es werden die wichtigsten Richtlinien und Normen für barrierefreie Webangebote vorgestellt, darunter die WCAG und die BITV.
- Im zweiten Kapitel werden die zentralen Definitionen von Web Content Management und Barrierefreiheit erörtert. Es wird die Bedeutung von Barrierefreiheit für die Inklusion im Internet betont.
- Das dritte Kapitel geht auf die Umsetzung von Barrierefreiheit mittels eines CMS ein. Es werden die Vorteile und Herausforderungen bei der Nutzung eines CMS für die Erstellung barrierefreier Webseiten beleuchtet.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit den spezifischen Kriterien für die Auswahl eines geeigneten CMS im Hinblick auf Barrierefreiheit. Es werden wichtige Faktoren wie die Unterstützung von WCAG-konformen HTML-Code, die Integration von Barrierefreiheitstools und die Möglichkeit zur Anpassung durch Plugins betrachtet.
Schlüsselwörter
Barrierefreiheit, Web Content Management System (CMS), Web Accessibility Initiative (WAI), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), BITV, HTML, XHTML, CSS, Inklusion, Accessibility, Usability, Benutzerfreundlichkeit, Webdesign.
- Quote paper
- Bernd Fegers (Author), 2012, Auswahlkriterien für ein Web-CMS vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/193664