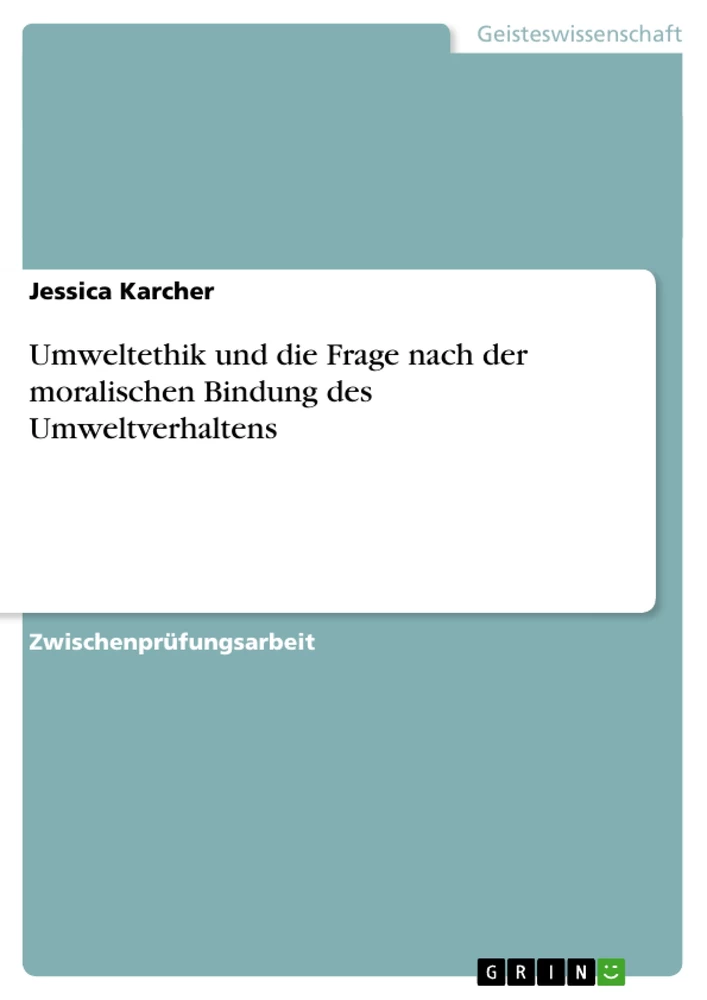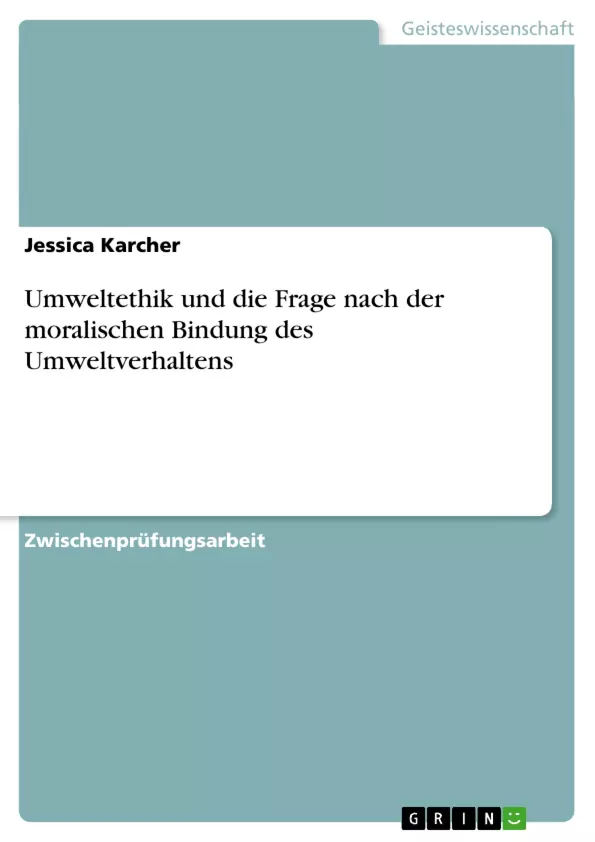Etwa 50 Jahre ist es her, seit die heile Welt einer modernen Gesellschaft aufgrund
wissenschaftlicher Publikationen ins Wanken gerat. Erkenntnisse über ein, durch den
Menschen verursachtes, beschleunigtes Artensterben brachten die notwendige Einsicht mit
sich, dass der Mensch sich ohne eine dringend nötige Verhaltensänderung seiner
Existenzgrundlagen berauben wird.
Trotz dessen hat sich bis heute in den Köpfen der meisten Menschen nicht viel verändert. Zu
schwer wiegen scheinbar die Anstrengungen eines umweltverantwortlichen Umgangs mit
Natur, den damit verbundenen finanziellen Aufwendungen und einem zukunftsorientierten
Konsumverhaltens. Oder ist der Mensch vielleicht kognitiv nicht in der Lage, Gefahren, die
nicht unmittelbar zu befürchten sind, auf sich zu beziehen und sein Handeln entsprechend
auszurichten?
So lebt der Mensch zwar seit seinen Anfängen als Konsument auf Kosten seiner Mitwelt,
doch vollzog sich im den letzten Jahrhunderten ein entscheidender Wandel in der Intensität
der Naturnutzung. Nicht nur der technische Fortschritt und die einhergehende Verschärfung
der Eingriffstiefe in den Naturhaushalt, auch die mentale Haltung zur natürlichen Umgebung
des Menschen veränderte sich. So erfolgte eine Dekradierung der Natur zur Ressource, so
dass sie zunehmend zum Gegenstand rationaler Kosten - Nutzen - Abwägungen des
Menschen wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mensch trotz zahlreicher massiver
Eingriffe in die Natur kaum Kenntnisse über die biologischen Zusammenhänge des ihn
umgebenden Ökosystems aufweisen kann. Daraus folgt, dass selbst wissenschaftliche
Forschungen keine verlässlichen Auskünfte über die Folgen unseres Handelns vorlegen
können.
In den folgenden Ausarbeitungen soll der Versuch unternommen werden das
Umweltverhalten des Menschen und dessen Ursachen darzulegen. Zunächst einmal lässt sich
menschliches Handeln unter drei Gesichtspunkten betrachten. So ist das Verhaltens des
Menschen a) ein Ergebnis seiner Stammesgeschichte, b) ein Produkt seiner Kulturgeschichte
und c) der Ausdruck eines individuellen Lebenslaufs. Im Folgenden werde ich näher auf die
beiden erstgenannten Aspekte des menschlichen Verhaltens eingehen und sie in Beziehung
zur gegenwärtigen ökologischen Krise setzen. Prof . Dr. Ortwin Renn beschrieb die
Erfordernisse anlässlich der Earth Days wie folgt: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Weltbilder des Menschen
- 2.1 Das Anthropozentrische Weltbild
- 2.2 Das Physiozentrische Weltbild
- 3. Evolutionäre Dispositionen des Menschen
- 3.1 Historischer Abriss menschlichen Umweltverhaltens
- 3.2 Bemerkungen
- 4. Umwelterziehung - Möglichkeiten und Grenzen
- 4.1 Moral theoretische Grundlegungen
- 4.2 Erziehung zum umweltverantwortlichen Handeln. Neue Werthaltungen und Moralische Anforderungen?
- 4.3 Die Beziehung zwischen Kultur und Natur
- 5. Ausblick: Die Lösung der Umweltkrise durch "neues" Denken im "neuen" Menschen?
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Umweltverhalten des Menschen und dessen Ursachen vor dem Hintergrund der ökologischen Krise. Sie beleuchtet die Einflüsse der Stammes- und Kulturgeschichte sowie die Rolle von Weltbildern und Umwelterziehung. Die Arbeit analysiert die Grenzen und Möglichkeiten eines umweltverantwortlichen Handelns.
- Anthropozentrisches vs. Physiozentrisches Weltbild
- Evolutionäre Einflüsse auf das Umweltverhalten
- Möglichkeiten und Grenzen der Umwelterziehung
- Der Mensch als Konsument auf Kosten der Natur
- Die Beziehung zwischen Kultur und Natur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Beginn des ökologischen Bewusstseins vor etwa 50 Jahren durch wissenschaftliche Erkenntnisse über das Artensterben. Sie stellt die Frage nach den Ursachen für das anhaltende, umweltschädliche Verhalten des Menschen und dessen kognitiver Fähigkeit, langfristige Gefahren zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Arbeit untersucht menschliches Handeln als Ergebnis von Stammesgeschichte, Kulturgeschichte und individuellem Lebenslauf, wobei die ersten beiden Aspekte im Fokus stehen. Sie skizziert die Struktur der Arbeit und betont den anthropozentrischen Charakter des Begriffs "Umwelt".
2. Die Weltbilder des Menschen: Dieses Kapitel erörtert kritisch anthropozentrische und physiozentrische Weltbilder. Das anthropozentrische Weltbild betrachtet den Menschen als Mittelpunkt der Welt, während das physiozentrische Weltbild die Natur als eigenwertig ansieht. Die Arbeit diskutiert, wie diese Weltbilder das Verhältnis des Menschen zur Natur und sein Umweltverhalten beeinflussen. Der Fokus liegt auf der durch den Menschen geformten und genutzten Natur, die für neue Gesellschaftsmitglieder bereits vermenschlicht erscheint, und auf der eingeschränkten menschlichen Wahrnehmung der Natur.
3. Evolutionäre Dispositionen des Menschen: Dieses Kapitel untersucht die evolutionären Grundlagen des menschlichen Umweltverhaltens. Es enthält einen historischen Abriss, der die Entwicklung des menschlichen Umgangs mit der Natur beleuchtet, und analysiert die Einflüsse der Stammesgeschichte auf das heutige Verhalten. Es wird herausgestellt, wie sich die Natur vom Eigenwert hin zur Ressource entwickelte und wie der Mangel an Wissen über biologische Zusammenhänge das Handeln beeinflusst.
4. Umwelterziehung - Möglichkeiten und Grenzen: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Moral und Ethik im Zusammenhang mit dem Umweltverhalten. Es untersucht, wie umweltrelevante Werte und Moralvorstellungen entstehen und wie diese durch Erziehung beeinflusst werden können. Darüber hinaus analysiert es die oft als antagonistisch empfundene Beziehung zwischen natürlicher und kultureller Umwelt. Psychologische Grundlagen der Umwelterziehung werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Umweltethik, Umweltverhalten, Anthropozentrismus, Physiozentrismus, Evolution, Umwelterziehung, ökologische Krise, nachhaltiges Verhalten, Mensch-Natur-Beziehung, Moral, Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Umweltverhalten des Menschen und seine Ursachen im Kontext der ökologischen Krise. Sie beleuchtet den Einfluss von Stammes- und Kulturgeschichte, Weltbildern und Umwelterziehung auf das menschliche Handeln und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen eines umweltverantwortlichen Verhaltens.
Welche Weltbilder werden betrachtet?
Die Arbeit vergleicht kritisch anthropozentrische und physiozentrische Weltbilder. Das anthropozentrische Weltbild stellt den Menschen in den Mittelpunkt, während das physiozentrische Weltbild der Natur einen Eigenwert zuordnet. Es wird analysiert, wie diese Weltbilder das Verhältnis des Menschen zur Natur und sein Umweltverhalten beeinflussen.
Welche Rolle spielt die Evolution?
Die Arbeit untersucht die evolutionären Grundlagen des menschlichen Umweltverhaltens. Ein historischer Abriss beleuchtet die Entwicklung des menschlichen Umgangs mit der Natur und analysiert den Einfluss der Stammesgeschichte auf das heutige Verhalten. Die Entwicklung der Natur von einem Eigenwert hin zu einer Ressource wird ebenso thematisiert wie der Einfluss von Wissensmängeln über biologische Zusammenhänge.
Welche Bedeutung hat die Umwelterziehung?
Das Kapitel zur Umwelterziehung behandelt die theoretischen Grundlagen der Moral und Ethik im Zusammenhang mit dem Umweltverhalten. Es untersucht die Entstehung umweltrelevanter Werte und Moralvorstellungen und deren Beeinflussung durch Erziehung. Die oft als antagonistisch empfundene Beziehung zwischen natürlicher und kultureller Umwelt wird ebenfalls analysiert. Psychologische Grundlagen der Umwelterziehung werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind: Anthropozentrismus, Physiozentrismus, Evolutionäre Einflüsse auf das Umweltverhalten, Möglichkeiten und Grenzen der Umwelterziehung, Der Mensch als Konsument auf Kosten der Natur, Die Beziehung zwischen Kultur und Natur, ökologische Krise und nachhaltiges Verhalten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Weltbildern des Menschen, zu evolutionären Dispositionen, zur Umwelterziehung und einen Ausblick. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die Arbeit schließt mit einer Gesamtübersicht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Umweltethik, Umweltverhalten, Anthropozentrismus, Physiozentrismus, Evolution, Umwelterziehung, ökologische Krise, nachhaltiges Verhalten, Mensch-Natur-Beziehung, Moral, Ethik.
Was ist das Hauptargument der Arbeit?
Das Hauptargument ist, dass das umweltschädliche Verhalten des Menschen auf eine Kombination aus anthropozentrischen Weltbildern, evolutionären Dispositionen und unzureichender Umwelterziehung zurückzuführen ist. Die Arbeit plädiert implizit für einen Wandel hin zu einem physiozentrischeren Weltbild und einer effektiveren Umwelterziehung.
- Quote paper
- Jessica Karcher (Author), 2002, Umweltethik und die Frage nach der moralischen Bindung des Umweltverhaltens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19232