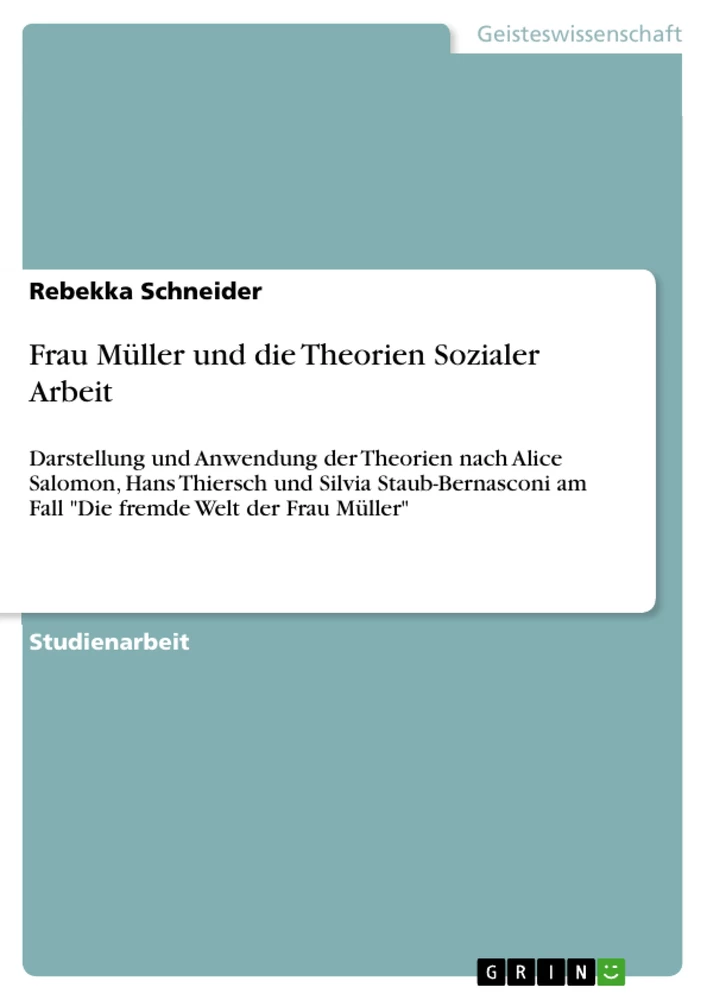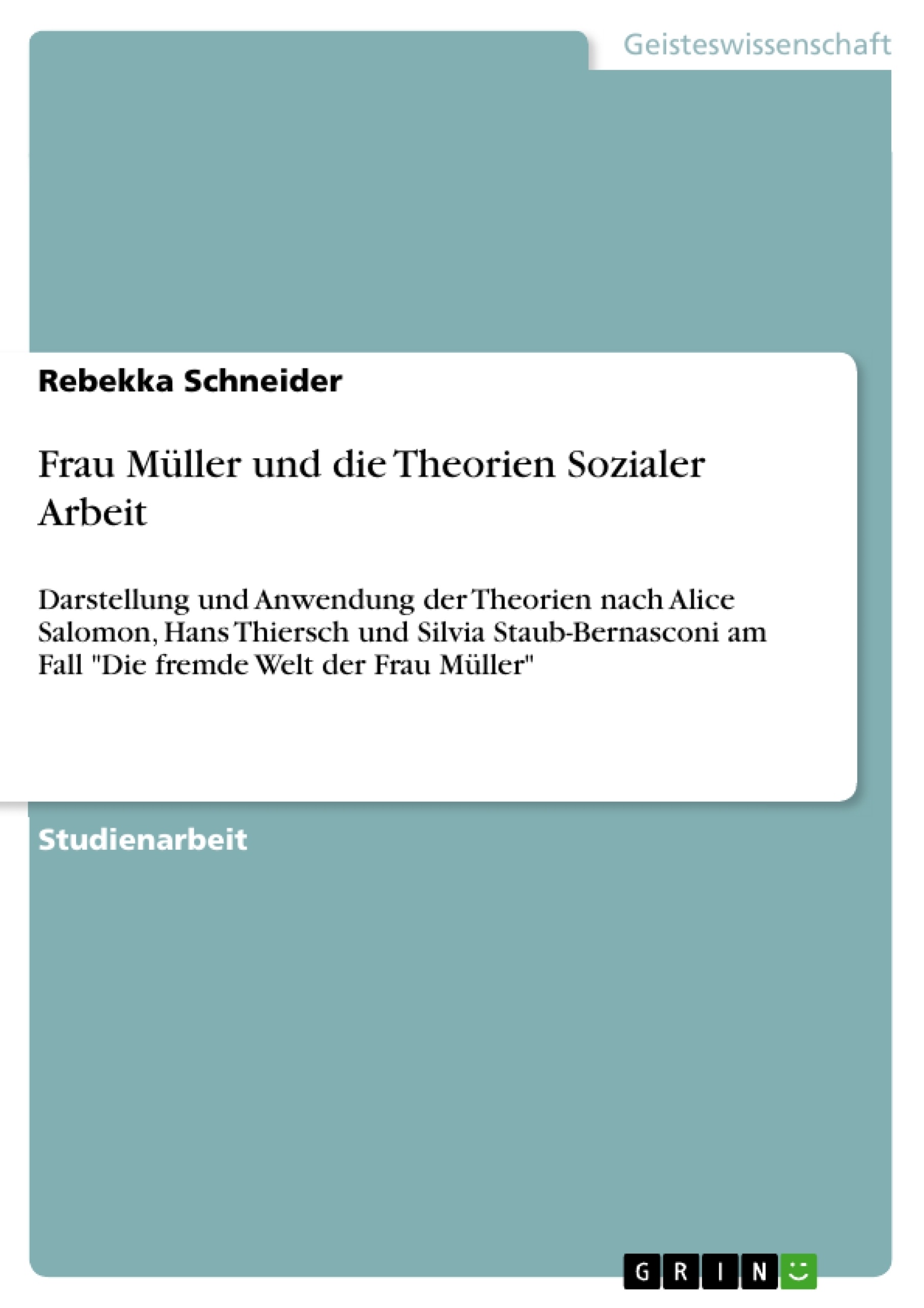In dieser Hausarbeit werden drei Theorien Sozialer Arbeit beschrieben und auf einen Fall angewendet. Hierfür wird zunächst der Fall „Die fremde Welt der Frau Müller“ vorgestellt, der dann unter Heranziehung verschiedener Theorien betrachten wird und für den im Blick der jeweiligen Theorie, Handlungsmöglichkeiten erarbeiten werden.
Anschließend werden die Theorien nach Alice Salomon, Hans Thiersch und Silvia Staub-Bernasconi vorgestellt. Jeweils im Anschluss an die inhaltliche Beschreibung der Theorie folgt die Anwendung auf den Fall. Im abschließenden Fazit werden die drei Theorien verglichen und auf ihre Anwendbarkeit auf den Fall hin verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeschreibung „Die fremde Welt der Frau Müller“
- Theorie nach Alice Salomon
- Anwendung der Theorie nach Alice Salomon
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
- Anwendung der Theorie nach Hans Thiersch
- Theorie nach Silvia Staub-Bernasconi
- Anwendung der Theorie nach Silvia Staub-Bernasconi
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Anwendung von drei Theorien der Sozialen Arbeit auf den Fall der demenzkranken Frau Müller. Ziel ist es, die theoretischen Konzepte auf die konkrete Lebenswelt von Frau Müller zu übertragen und Handlungsmöglichkeiten für die soziale Arbeit zu entwickeln.
- Klassische Theorien der Sozialen Arbeit
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- Systemische Theorie
- Demenz und die Herausforderungen für die Lebenswelt
- Handlungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Fall der Frau Müller vor und erläutert die gewählten Theorien und den Aufbau der Hausarbeit.
- Die Fallbeschreibung gibt einen detaillierten Einblick in die Lebenswelt der Frau Müller und ihre Erkrankung an Alzheimer.
- Das Kapitel über Alice Salomons Theorie beschreibt ihren Ansatz einer Handlungswissenschaft der Sozialen Arbeit und ihren Fokus auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung.
- Im Kapitel „Anwendung der Theorie nach Alice Salomon“ wird die Theorie auf den Fall der Frau Müller angewendet und Handlungsmöglichkeiten im Rahmen von Salomons Ansatz diskutiert.
- Das Kapitel über Hans Thierschs Theorie stellt die Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit dar und ihre Bedeutung für die praktische Arbeit.
- Das Kapitel „Anwendung der Theorie nach Hans Thiersch“ zeigt die Anwendung der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit auf den Fall der Frau Müller und entwickelt Handlungsmöglichkeiten.
- Das Kapitel über Silvia Staub-Bernasconis Theorie stellt die systemische Theorie vor und erklärt ihre wichtigsten Konzepte.
- Im Kapitel „Anwendung der Theorie nach Silvia Staub-Bernasconi“ wird die systemische Theorie auf den Fall der Frau Müller angewendet und Handlungsmöglichkeiten in diesem Rahmen erörtert.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Demenz, Alzheimer, Alice Salomon, Hans Thiersch, Silvia Staub-Bernasconi, Lebenswelt, Systemtheorie, Handlungsmöglichkeiten, Fallbeschreibung, Frau Müller.
- Quote paper
- Rebekka Schneider (Author), 2010, Frau Müller und die Theorien Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/191760