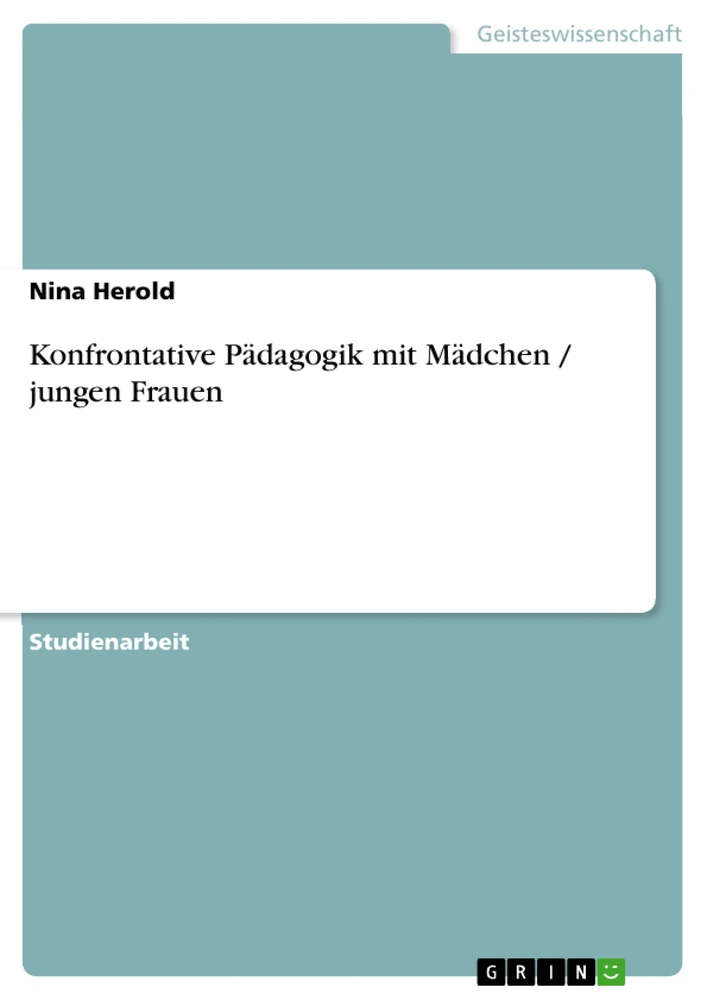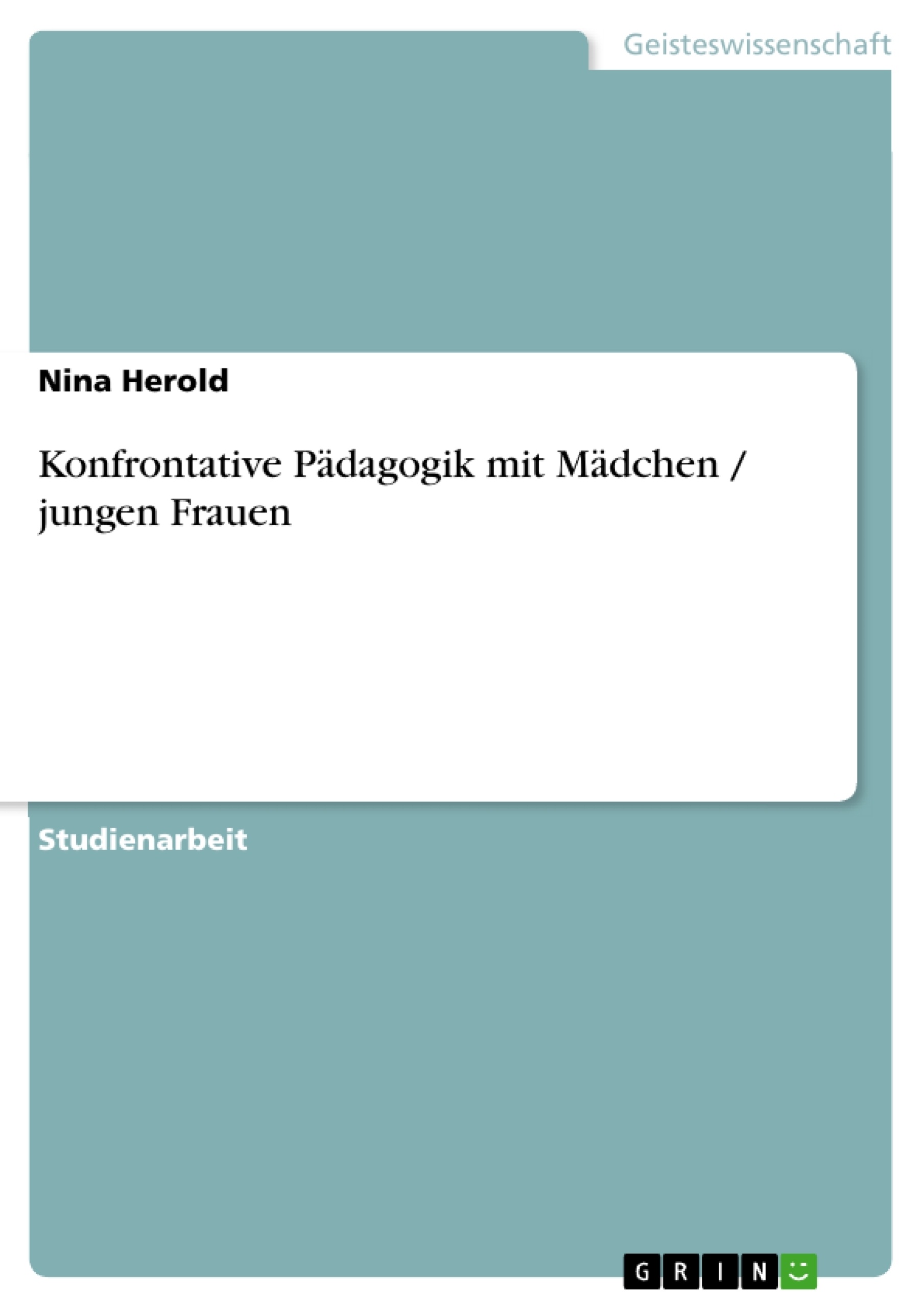Die „Konfrontative Pädagogik“ (KP) lässt sich gleichzeitig als ein (sozial)pädagogischer Handlungsstil und eine Interventionsmethode beschreiben (vgl. Kilb 2010: 38).
Sie verfolgt unterschiedliche Ziele. Durch konfrontative Maßnahmen soll eine „[…] Einstellungs- und Verhaltensänderung beim Betroffenen.“ (Weidner 2010: 23) gegenüber sich selbst und anderen Personen erzielt werden. Er soll also lernen Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und mit Aggressionen konstruktiv umzugehen, um ein gewaltfreies Leben führen zu können. Dafür sollen u.a. Rechtfertigungsmechanismen aufgebrochen, Schuldgefühle geweckt und Handlungsalternativen eingeübt werden.
Außerdem sollen unterschiedliche Handlungskompetenzen gefördert werden, bei denen die Mehrfachauffälligen Nachholbedarf aufweisen: „[…]Empathie, Frustrationstoleranz, Ambiguitäts- oder Ambivalenztoleranz sowie Rollendistanz.“ (Weidner 2010: 24). Zusätzlich soll prosoziales Verhalten gefördert und die Fähigkeit des moralischen Urteilens entwickelt werden (vgl. Walkenhorst 2010: 93).
Ein weiteres Ziel ist „[…] die Anpassung an gesellschaftlich erwünschtes bzw. erwartetes Verhalten […].“ (Kilb 2010: 54), um sich auf dieser Basis selbstständig weiterentwickeln zu können.
Konfrontative Arbeit ist grundsätzlich mit allen Zielgruppen möglich. Sie kann in unterschiedlichen Bereichen wie stationären Einrichtungen (z.B. JVA), in Schulen, Gruppenarbeit, Einzelfallarbeit und Beratungsarbeit angewendet werden (vgl. Kilb 2010: 40) und ist somit in unterschiedlichen Einsatzfeldern Sozialer Arbeit relevant. „[…] vor allem in der pädagogischen Arbeit mit aggressiven und stark auffälligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen […].“ (Weidner/Kilb 2011: 5) ist die KP ein wichtiger Bestandteil. Daher wird sich diese Arbeit auf diese Zielgruppe beziehen.
Die KP „[…] begreift sich als sozialpädagogische ultima ratio im Umgang mit Mehrfachauffälligen.“ (Weidner 2010: 23), die eingesetzt wird, wenn andere vorausgegangene Zugänge, wie z.B. die klientenzentrierte Gesprächsführung, nicht (mehr) ausreichen.
Da männliche und weibliche Jugendliche bezüglich der Gründe und Formen ihrer Gewalttaten, ihren geschlechterspezifischen Lebenswelten, gesellschaftlichen Anforderungen und Erfahrungen sehr unterschiedlich sind, benötigt man auch in der KP einen geschlechterbezogenen Zugang (vgl. Bruhns 2010: 370). Was bei Männern wirkt, wirkt nicht zwangsläufig auch bei Frauen! Dies soll in den folgenden Kapiteln erarbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Täterinnen
- Konfrontative Pädagogik mit Mädchen und jungen Frauen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Konfrontativen Pädagogik (KP) und ihrer Anwendung bei Mädchen und jungen Frauen. Sie untersucht die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der KP in Bezug auf weibliche Delinquenz. Die Arbeit verdeutlicht die Relevanz eines geschlechterdifferenzierten Ansatzes in der KP.
- Der Anteil von Mädchen und jungen Frauen an Gewaltdelikten
- Die Besonderheiten weiblicher Delinquenz im Vergleich zu männlicher Delinquenz
- Die Wirksamkeit der KP bei Mädchen und jungen Frauen
- Die Herausforderungen und Chancen der KP im Umgang mit weiblicher Delinquenz
- Die Bedeutung eines geschlechterdifferenzierten Ansatzes in der KP
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung definiert die Konfrontative Pädagogik als einen sozialpädagogischen Handlungsstil und eine Interventionsmethode, die sich auf die Lebensweltorientierung nach Thiersch und den Empowerment-Ansatz stützt. Außerdem wird die theoretische Grundlage der KP in der konfrontativen Therapie nach Corsini und der provokativen Therapie nach Farrelly sowie in der Verhaltenstherapie und den kognitiven Therapien erläutert.
Täterinnen
Dieses Kapitel untersucht die Häufigkeit und die Erscheinungsformen delinquenten Verhaltens bei Mädchen und jungen Frauen anhand der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Es wird deutlich, dass der Anteil von Frauen an Gewaltdelikten zwar deutlich geringer ist als der von Männern, jedoch in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Es wird auch auf die Unterschiede in der Art der begangenen Delikte sowie auf die Relevanz des Dunkelfelds hingewiesen.
Schlüsselwörter
Konfrontative Pädagogik, Mädchen, junge Frauen, Delinquenz, Gewalt, Körperverletzung, Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), Soziale Trainingskurse, Coolnesstraining (CT), Lebensweltorientierung, Empowerment, geschlechterdifferenzierter Ansatz, polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konfrontative Pädagogik (KP)?
KP ist ein sozialpädagogischer Handlungsstil und eine Interventionsmethode, die darauf abzielt, Verhaltensänderungen bei aggressiven oder auffälligen Jugendlichen durch direkte Konfrontation zu bewirken.
Warum braucht man für Mädchen einen eigenen pädagogischen Zugang?
Da Gründe, Formen der Gewalt und Lebenswelten von Mädchen stark von denen der Jungen abweichen, funktionieren rein männlich orientierte Methoden bei Frauen oft nicht.
Welche Ziele verfolgt die konfrontative Arbeit?
Ziele sind die Übernahme von Verantwortung, das Aufbrechen von Rechtfertigungsmechanismen sowie die Förderung von Empathie und Frustrationstoleranz.
Wann wird die Konfrontative Pädagogik eingesetzt?
Sie gilt als „Ultima Ratio“, wenn andere Methoden wie die klientenzentrierte Gesprächsführung bei Mehrfachauffälligen nicht mehr ausreichen.
Wie hat sich die Kriminalität bei jungen Frauen entwickelt?
Laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) ist der Anteil von Mädchen an Gewaltdelikten zwar geringer als bei Jungen, in den letzten Jahren jedoch stetig gestiegen.
- Arbeit zitieren
- Nina Herold (Autor:in), 2011, Konfrontative Pädagogik mit Mädchen / jungen Frauen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/191427