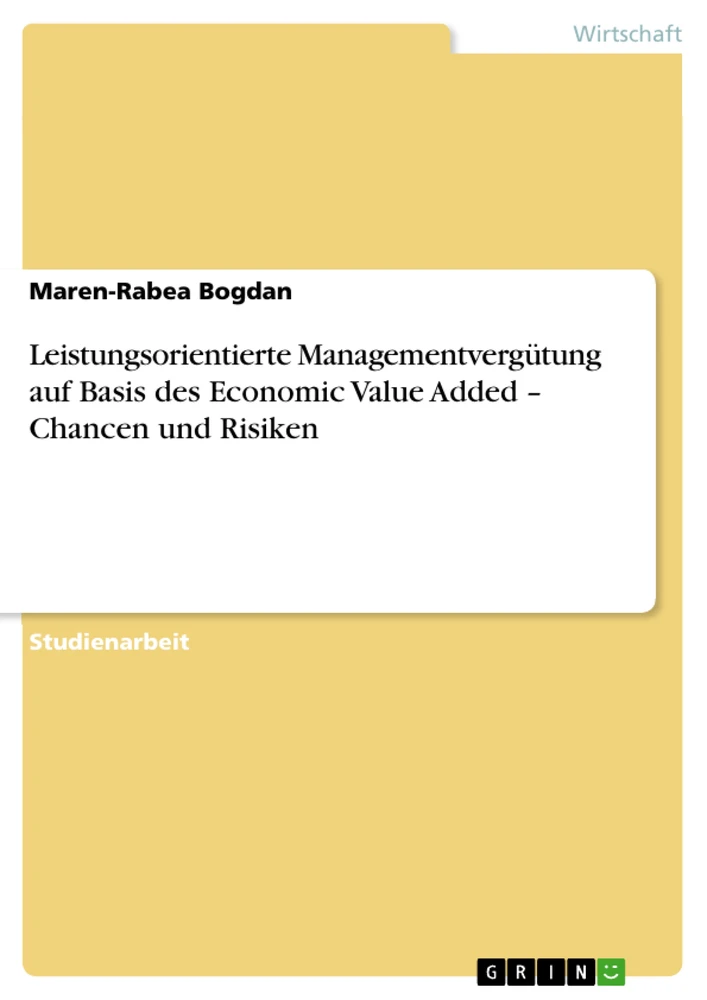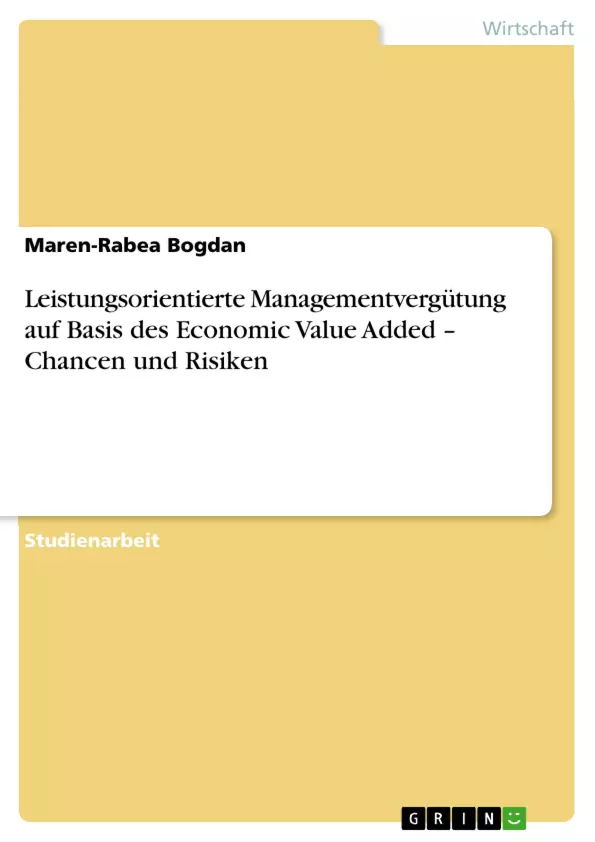Diese und ähnliche Berichte rufen seit der Finanzkrise 2008 einen lauten Aufschrei in
der Bevölkerung und in der Politik hervor. Großzügige Angebote, wie die des Deutsche
Bank AG Vorstandchefs Josef Ackermann, dass er in dem Krisenjahr auf einen Teil
seiner Bezüge verzichten werde, entlocken der Bevölkerung nur ein müdes Lächeln.
Auszahlungen an das Management in verschiedensten Bankhäusern wurden geplant,
obwohl der Antrag auf Hilfe aus dem 700-Milliarden schweren Rettungsplans schon
gestellt war. Diese Zahlungen wurden oftmals mit den strategischen Entscheidungen
und dem Weitblick der Manager für das Geschäftsjahr begründet.
Die Politik fordert seitdem eine Obergrenze für Managergehälter. Christian Wulff fasst
das Verhalten der Manager in scharfe Worte: „Eine pflichtwidrige Vernichtung von
Kapital ist eine Straftat“.2 Viele Führungskräfte haben für kurzfristige Liquiditätsbeschaffungen
langfristige Verpflichtungen aufgenommen, die wissentlich einen exorbitanten,
existenziellen Unternehmensschaden herbeiführen könnten. Nicht nur die Deckelung
der Managergehälter, sondern auch die Ahndung von Fehlentscheidungen mit
Haftung des Privatvermögens stand zur Debatte. Aufgrund egoistischer Entscheidungen
der Manager haben Investoren Verluste in Millionenhöhe erfahren.
Die Politik fordert Vergütungsmodelle, die die Führungskräfte an Gewinnen und Verlusten
beteiligt, die auf Grundlage ihrer Entscheidungen entstehen. Ein Wandel in der
Denkweise muss herbeigeführt werden, indem sich das Management auf unternehmerische
Tugenden zurück besinnt, die den langfristigen Unternehmenserfolg sichern.
Die Basis dafür kann eine leistungsorientiere Vergütung auf Grundlage einer langfristigen
Wertsteigerung des Unternehmens sein, die eine zusätzliche Entlohnung der Manager
rechtfertigen würde. Dieses Entlohnungsmodell soll in der folgenden Arbeit erläutert
werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Themenhinführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Wertorientierte Unternehmensführung
- 2.1 Shareholder Value
- 3. Prinzipal-Agenten-Theorie und Anreizsysteme
- 3.1 Prinzipal-Agenten-Theorie
- 3.2 Anreizsysteme
- 3.2.1 Nicht monetäre Anreizsysteme
- 3.2.2 Monetäre Anreizsysteme
- 4. Vergütungsmodelle
- 4.1 Defintion Vergütung
- 4.2 Erfolgsorientierte Vergütung
- 4.3 Leistungsorientierte Vergütung
- 4.3.1 Akkordlohn
- 4.3.2 Prämienlohn
- 4.3.3 Ziellohn
- 5. Economic Value Added
- 5.1 Definition EVA
- 5.2 Korrelation von MVA und EVA
- 6. Leistungsorientierte Managementvergütung auf Grundlage des EVA
- 6.1 Chancen
- 6.2 Risiken
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die leistungsorientierte Managementvergütung auf Basis des Economic Value Added (EVA). Die Arbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken dieser Vergütungsform und analysiert die Zusammenhänge zwischen EVA, Shareholder Value und der Prinzipal-Agenten-Theorie.
- Wertorientierte Unternehmensführung und Shareholder Value
- Prinzipal-Agenten-Theorie und Anreizsysteme
- Vergütungsmodelle und deren Bedeutung für die Leistungsmotivation
- Economic Value Added als Kennzahl für die Unternehmensbewertung
- Chancen und Risiken der leistungsorientierten Managementvergütung auf Basis des EVA
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung der leistungsorientierten Managementvergütung ein und erläutert den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Konzept der wertorientierten Unternehmensführung und dem Zusammenhang mit dem Shareholder Value. Kapitel 3 behandelt die Prinzipal-Agenten-Theorie und die verschiedenen Anreizsysteme, die zur Lösung des Informationsasymmetrie-Problems beitragen können. Kapitel 4 beschreibt unterschiedliche Vergütungsmodelle und beleuchtet die verschiedenen Formen der leistungsorientierten Vergütung. In Kapitel 5 wird der Economic Value Added (EVA) als Kennzahl für die Unternehmensbewertung definiert und die Korrelation von MVA und EVA untersucht. Kapitel 6 analysiert die Chancen und Risiken der leistungsorientierten Managementvergütung auf Grundlage des EVA.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der wertorientierten Unternehmensführung, Shareholder Value, der Prinzipal-Agenten-Theorie, Anreizsystemen, Vergütungsmodellen, Economic Value Added (EVA), MVA, und der leistungsorientierten Managementvergütung.
- Quote paper
- Maren-Rabea Bogdan (Author), 2011, Leistungsorientierte Managementvergütung auf Basis des Economic Value Added – Chancen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190569