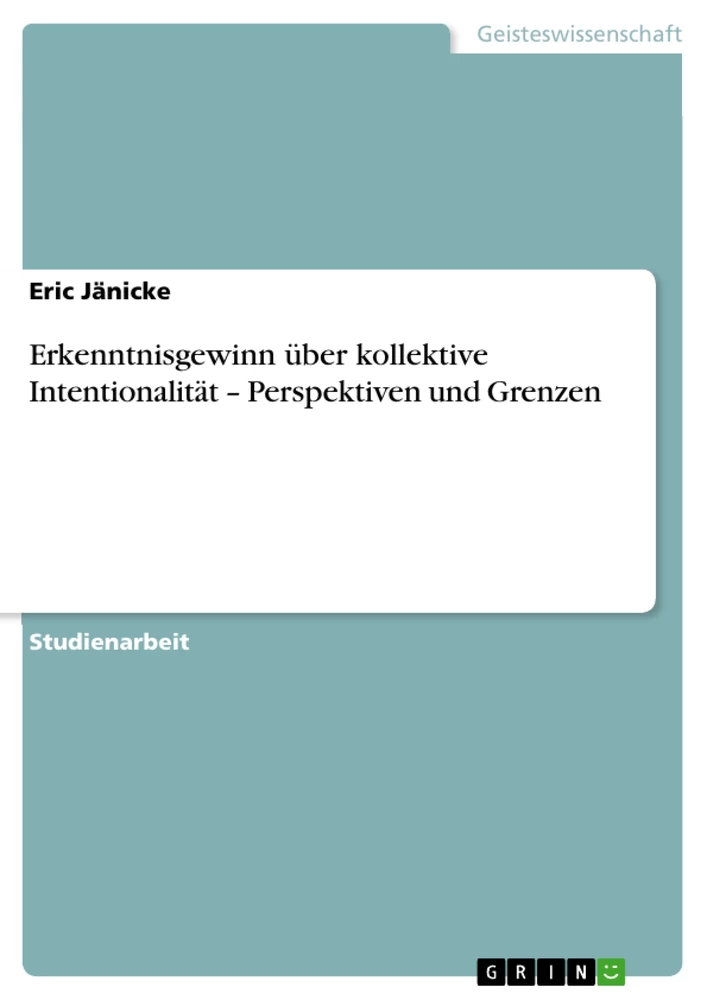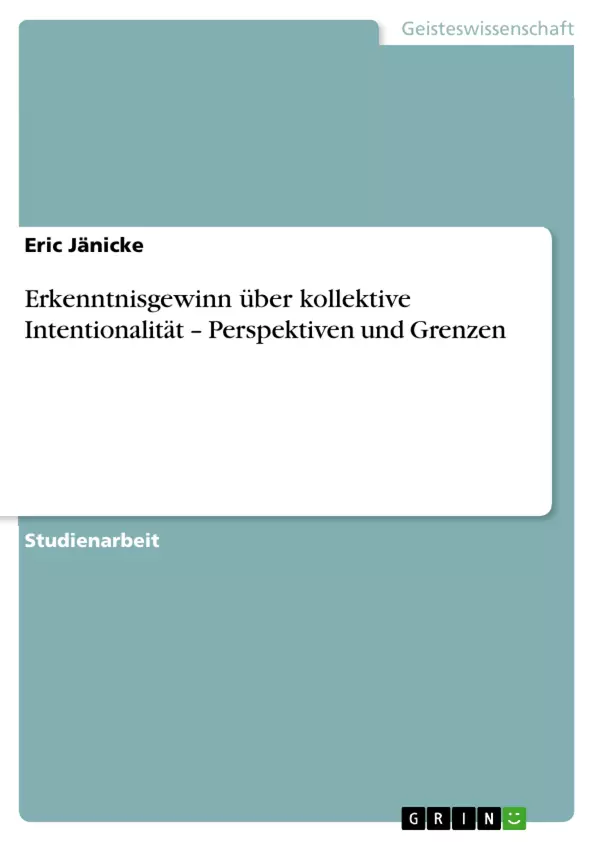Kollektive Intentionalität bezeichnet ein soziales Phänomen, das gemeinsames Handeln ermöglicht. Bedenkt man, dass gemeinsame Absichten, ob nun bewusst oder unbewusst, einen Großteil zur Etablierung und Institutionalisierung einer Art Gemeinwillens beitragen, so scheint die Thematik eine sehr grundlegende und spannende für kulturelle Prozesse zu sein. Zu durchdenken und zu beschreiben, was dieses fragile Gebilde schwer nachweislicher Zwischenmenschlichkeit in seinem Wesen ausmacht und wie man es erfassen kann, haben sich verschiedene Autoren zur Aufgabe gemacht. Es wurden unterschiedliche Ansätze zu Tage gefördert, von denen einige im Rahmen dieser Arbeit miteinander verglichen, untersucht und letztlich auf ihren Erkenntnisgewinn hin überprüft werden sollen.
Zuerst werden vier Ansätze erläutert und aufeinander bezogen. Danach werden diese so gut es geht kurz resümiert, um anschließend einen reflektierenden Aufsatz aus der Debatte um kollektive Intentionalität vorzustellen. Am Ende wird das Thema unter genannten Gesichtspunkten zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Raimo Tuomela und Kaarlo Miller
- John R. Searle
- Margaret Gilbert
- Michael E. Bratman
- Zwischenresümee
- Annette C. Baier
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der kollektiven Intentionalität, einem sozialen Prozess, der gemeinsames Handeln ermöglicht. Sie untersucht und vergleicht verschiedene Ansätze zur Erklärung dieses Phänomens und analysiert deren Erkenntnisgewinn.
- Definition und Abgrenzung der kollektiven Intentionalität
- Analyse verschiedener Ansätze zur Erklärung kollektiver Intentionalität
- Kritik und Bewertung der unterschiedlichen theoretischen Perspektiven
- Die Rolle von Überzeugungen und wechselseitigen Verpflichtungen
- Das Verhältnis von individueller und kollektiver Intentionalität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Konzept der kollektiven Intentionalität wird eingeführt und die Relevanz des Themas für kulturelle Prozesse beleuchtet. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz und die zu behandelnden Ansätze.
- Raimo Tuomela und Kaarlo Miller: Dieser Ansatz definiert die "Wir-Absicht" als eine Gruppenabsicht, die auf die Erreichung eines gemeinsamen Ziels ausgerichtet ist. Die Autoren analysieren die Beziehung zwischen Wir-Absicht, Ich-Absicht und kollektivem Handeln.
- John R. Searle: Searle kritisiert den Ansatz von Tuomela und Miller mit dem Argument, dass nicht alle gemeinsamen Überzeugungen und Handlungen eine Wir-Absicht implizieren. Er präsentiert eine eigene Konzeption der kollektiven Intentionalität.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der kollektiven Intentionalität, Wir-Absicht, Ich-Absicht, gemeinsame Ziele, wechselseitige Überzeugung, und verschiedenen theoretischen Ansätzen zur Erklärung des Phänomens. Die Diskussion umfasst auch Aspekte wie die Bedeutung von Handlungstheorien, Intentionalität, sozialer Kognition und den Grundlagen des Sozialen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist kollektive Intentionalität?
Es beschreibt das Phänomen, dass Menschen gemeinsame Absichten und Überzeugungen teilen, die koordiniertes soziales Handeln erst ermöglichen.
Was versteht John Searle unter kollektiver Intentionalität?
Searle sieht sie als eine biologisch primitive Form der Intentionalität („Wir-Intention“), die nicht einfach auf individuelle Absichten reduziert werden kann.
Wie definieren Tuomela und Miller die „Wir-Absicht“?
Sie definieren sie als eine Gruppenabsicht, bei der Individuen ein gemeinsames Ziel verfolgen und dabei wechselseitig aufeinander bezogen handeln.
Welche Rolle spielen Verpflichtungen bei Margaret Gilbert?
Gilbert betont, dass kollektives Handeln auf einer „gemeinsamen Bindung“ (joint commitment) beruht, die gegenseitige Rechte und Pflichten schafft.
Warum ist das Thema für kulturelle Prozesse wichtig?
Kollektive Intentionalität ist die Basis für Institutionen, Gesetze und soziale Normen, die das Zusammenleben in einer Kultur regeln.
- Arbeit zitieren
- Eric Jänicke (Autor:in), 2010, Erkenntnisgewinn über kollektive Intentionalität – Perspektiven und Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190416