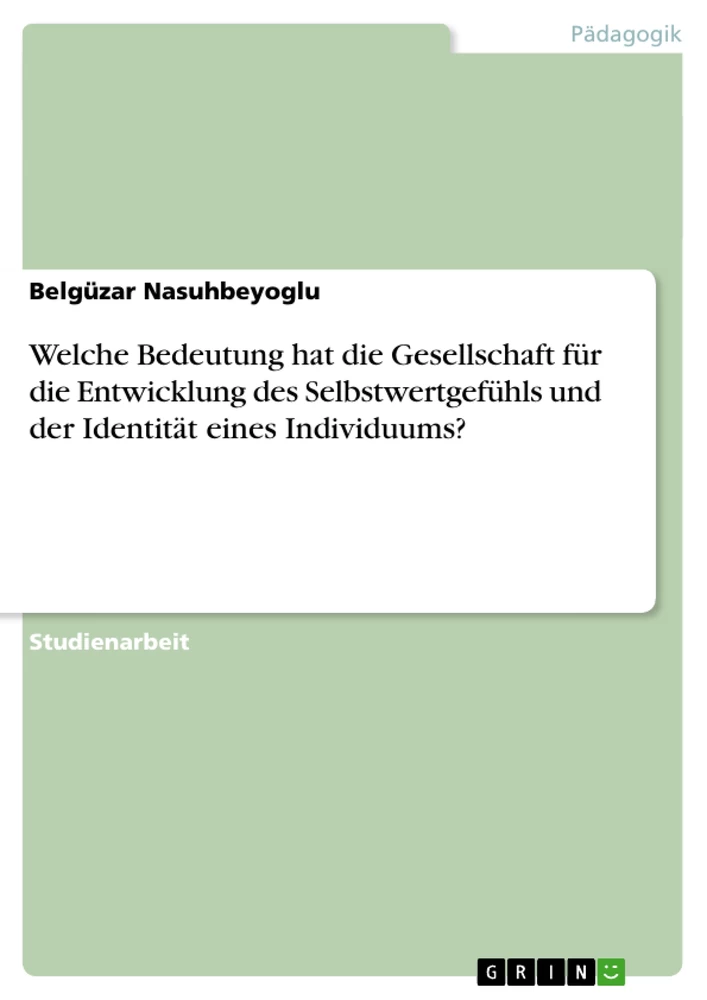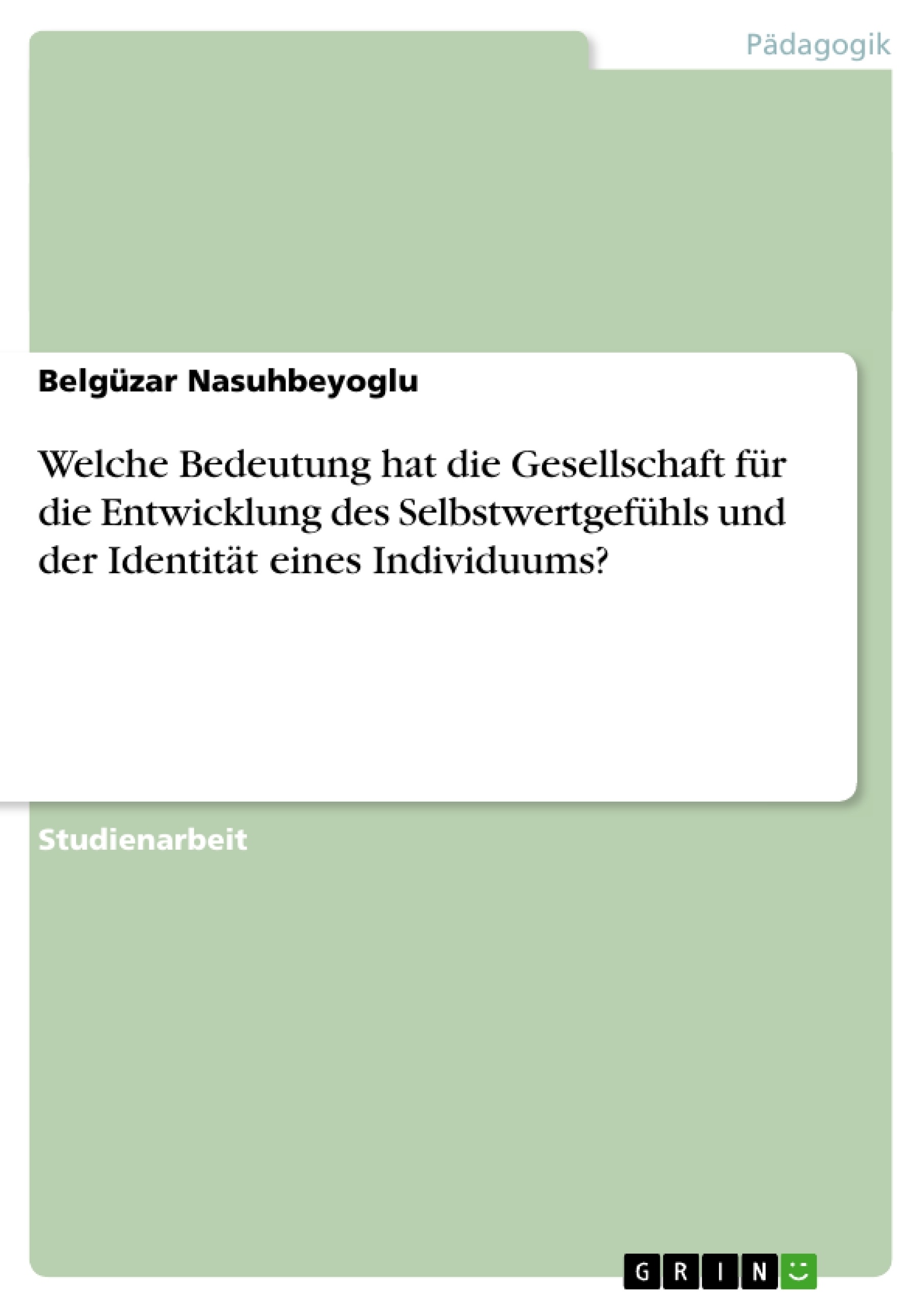Gegenstand dieser Arbeit soll die Bedeutung der Gesellschaft für das Wohlbefinden bzw. Selbstwertgefühl eines Individuums sein. Dabei soll im Rahmen unseres Seminars von komplexen Gesellschaften ausgegangen werden. Komplexe Gesellschaften, die oftmals
durch hierarchische Strukturen geprägt sind, sind nämlich unter anderem ein Grund dafür, dass die meisten ihrer Mitglieder unter einem geringen Selbstwertgefühl leiden. Ein meist durch Konkurrenz ausgelöster zu hoher Druck führt die Menschen in das
Bestreben, den sich ständig ändernden und steigenden Anforderungen gerecht werden zu müssen. Für diesen Zusammenhang wichtige Begriffe sollen im Folgenden näher erläutert und operationalisiert werden. Vor allem der Begriff des Selbstwertgefühls und
der des symbolischen Interaktionismus sollen im Mittelpunkt unserer Betrachtungen liegen. Dabei sollen auf mögliche Ursachen für ein mangelndes Selbstbewusstsein eingegangen werden und versucht werden Antworten auf Fragen zum Entstehungsprozess des Selbstwertgefühls zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstwertgefühl
- Symbolischer Interaktionismus
- Exkurs: Adlerperspektive
- Sozialisation als Prozess der Identitätsbildung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Gesellschaft für das Selbstwertgefühl und die Identität eines Individuums, insbesondere im Kontext komplexer Gesellschaften. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung des Selbstwertgefühls und beleuchtet den Einfluss von sozialem Interaktionismus und Sozialisation auf die Identität.
- Der Einfluss von komplexen Gesellschaften auf das Selbstwertgefühl.
- Die Bedeutung des symbolischen Interaktionismus für die Identitätsbildung.
- Die Rolle der Sozialisation als Prozess der Identitätsbildung.
- Der Einfluss von Selbst- und Fremdperspektive auf das Selbstwertgefühl.
- Die Grenzen professioneller Förderung des Selbstwertgefühls.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung und die grundlegende Argumentation der Arbeit vor. Sie betont die Bedeutung der Gesellschaft für das Selbstwertgefühl und die Identität in komplexen Gesellschaften.
- Selbstwertgefühl: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Selbstwertgefühls und untersucht die Faktoren, die ihn beeinflussen. Es beleuchtet die Entstehung von mangelndem Selbstbewusstsein und mögliche Ursachen in der Kindheit.
- Symbolischer Interaktionismus: Dieses Kapitel erläutert die Theorie des symbolischen Interaktionismus und betont die Bedeutung von sozialen Beziehungen für die Entwicklung der Identität. Es diskutiert die Rolle von Kommunikation in der Identitätsbildung und den Einfluss von Gesellschaft auf den Charakter und die Identität ihrer Mitglieder.
- Exkurs: Adlerperspektive: Dieser Abschnitt bietet eine alternative Perspektive auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls, indem er die Ansätze von Alfred Adler diskutiert.
- Sozialisation als Prozess der Identitätsbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Sozialisation als Prozess der Identitätsbildung. Es analysiert den Einfluss von sozialen Interaktionen und Erfahrungen auf die Entwicklung der Identität.
Schlüsselwörter
Selbstwertgefühl, Identität, komplexe Gesellschaften, symbolischer Interaktionismus, Sozialisation, Kommunikation, Selbst- und Fremdperspektive, professionelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen komplexe Gesellschaften das Selbstwertgefühl?
Hierarchische Strukturen und hoher Konkurrenzdruck in modernen Gesellschaften führen oft zu steigenden Anforderungen, denen Individuen schwer gerecht werden können, was das Selbstwertgefühl mindern kann.
Was ist Symbolischer Interaktionismus?
Dies ist eine Theorie, die besagt, dass sich die Identität eines Menschen primär durch soziale Interaktionen und Kommunikation mit anderen entwickelt.
Welche Rolle spielt die Sozialisation bei der Identitätsbildung?
Sozialisation ist der lebenslange Prozess, in dem ein Individuum die Normen und Werte der Gesellschaft lernt und dadurch sein „Selbst“ formt.
Was sind die Ursachen für mangelndes Selbstbewusstsein in der Kindheit?
Negative Erfahrungen in der frühen Interaktion mit Bezugspersonen und fehlende Bestätigung können die Basis für ein dauerhaft geringes Selbstwertgefühl legen.
Was besagt die „Adlerperspektive“ zum Selbstwertgefühl?
Alfred Adler betonte das Streben nach Geltung und die Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen als zentrale Motive der Persönlichkeitsentwicklung.
- Quote paper
- Belgüzar Nasuhbeyoglu (Author), 2012, Welche Bedeutung hat die Gesellschaft für die Entwicklung des Selbstwertgefühls und der Identität eines Individuums?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190021