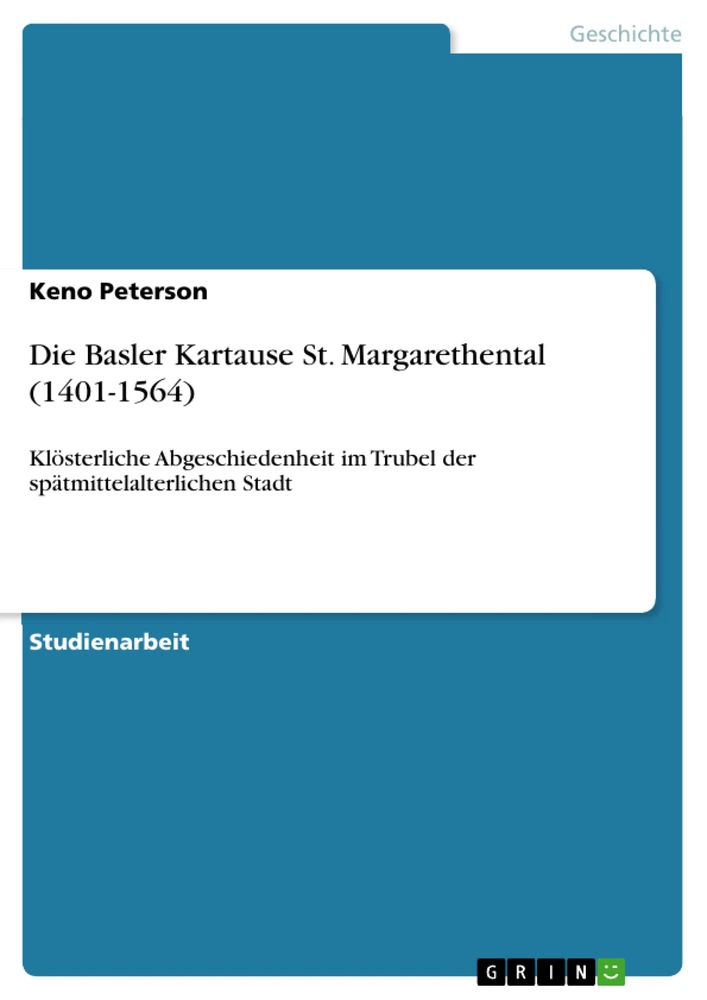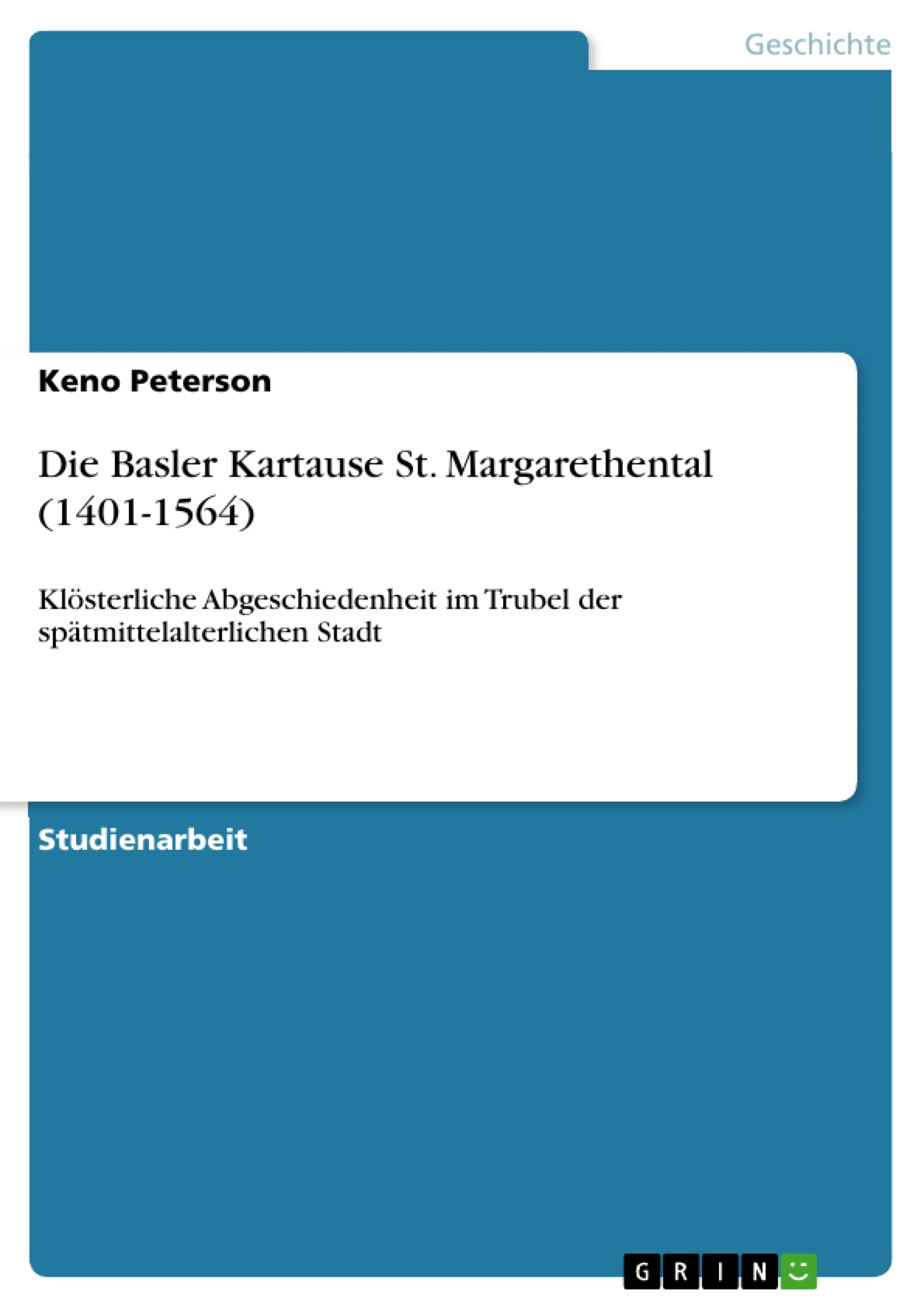Im Folgenden soll versucht werden, die Kommunikationswege und Austauschformen zwischen der Kartause St. Margarethental und der städtischen Gesellschaft Basels exemplarisch nachzuvollziehen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Interaktion mit den wissensproduzierenden bzw. wissensinteressierten Räumen der spätmittelalterlichen Stadt Basel in der Blütephase der Kartause ab den 1480er Jahren: Der Universität und den Basler Druckern. Galten nach der stratifikatorischen Differenzierungsform Klöster, Universitäten und städtische Gilden als vornehmliche Orte der Ansammlung und des Austauschs relevanten Wissens so lässt
mit der Erfindung des Buchdrucks die Konzentration auf diese Orte nach. Des Weiteren soll anhand der Geschichte der Kartause bis 1480 die ökonomischen, sozialen und geistlichen Kontakte mit der Basler Bürgerschaft nachgezeichnet werden. Zwei Leitfragen sollen diese Untersuchung umrahmen: Zum Einen stellt sich die Frage nach den
Kommunikationswegen, den Möglichkeiten der Interaktion der Basler Kartause mit den vorhandenen Wissensräumen. Aufgrund der vorgeschriebenen Abgrenzung gegen die Außenwelt durch das Schweigegebot müssen neben dem mündlichen Austausch vormalig andere Formen Verwendung gefunden haben. So standen den Kartäusern die sonst üblichen Nahtstellen der klösterlich-städtischen Interaktion – Predigt und universitäre Lehrtätigkeit – nicht zur Verfügung. Ein deutlicher Schwerpunkt ist daher auf den schriftlichen Austausch zu setzen, ohne den personellen Austausch außer Acht zu lassen. Als Mittelpunkt bzw. Medium des schriftbasierten Austauschs wird die umfangreiche Bibliothek der Basler Kartause und ihre Entstehung und Vergrößerung in den Jahren ihres Bestehens dienen. Auf der anderen Seite drängt sich die Frage auf, warum die Kartäuser im Allgemeinen – und die Basler Kongregation im Besonderen – eine solch große Wirkung auf ihr städtisches Umfeld haben konnten. Anhand der Zuwendungen an die Kartause und den zahlreichen Eintritten und
Übertritten von Personen aus dem Umfeld des Basler Patriziats und der Universität in den Orden kann diese Wertschätzung nachvollzogen werden. Diese starke Außenwirkung kann sich nur mit einem Blick auf die Umstände und Umbrüche des geistigen und geistlichen Leben der
spätmittelalterlichen (städtischen) Gesellschaft erklären lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Abgrenzung durch Alltag und Architektur der Kartäuser
- 3. Die Kartause St. Margarethental und die Bürger der Stadt Basel
- 4. Die Basler Kartäuser und ihre Kontakte mit der Universität Basel und den Basler Druckern während des Priorats Jakob Loubers (1480-1502)
- 5. Klösterliche Abgeschiedenheit im Trubel der spätmittelalterlichen Stadt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Basler Kartause St. Margarethental (1401-1564) und deren Verhältnis zur spätmittelalterlichen Stadt Basel. Ziel ist es, den scheinbaren Widerspruch zwischen der kartäuserischen Ideologie der Abgeschiedenheit und der tatsächlichen Vernetzung der Kartause mit dem städtischen Leben zu beleuchten.
- Die Lebensweise der Kartäuser und ihre strikte Regel
- Die Entwicklung der Kartäuserorden im spätmittelalterlichen städtischen Kontext
- Die Beziehungen der Basler Kartause zu den Bürgern Basels
- Die wissenschaftlichen und ökonomischen Verbindungen der Kartause zur Universität Basel und den Druckern
- Die Rolle der Kartause im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Basels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Geschichte des Kartäuserordens ein, beginnend mit Bruno von Köln und der Gründung der Grand Chartreuse. Sie beschreibt die zentralen Prinzipien des Ordens, insbesondere das Streben nach Abgeschiedenheit und die Betonung der schriftlichen Arbeit als Form der Kontemplation und Verkündigung. Die Einleitung skizziert die Ausbreitung des Ordens und die zunehmende Ansiedlung in Städten ab dem 14. Jahrhundert, was einen scheinbaren Widerspruch zur ursprünglichen Ideologie darstellt. Der Fokus wird auf die Basler Kartause St. Margarethental gelegt, die im Mittelpunkt der weiteren Untersuchung steht. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse der komplexen Beziehungen zwischen klösterlicher Abgeschiedenheit und städtischem Leben im Spätmittelalter.
2. Abgrenzung durch Alltag und Architektur der Kartäuser: Dieses Kapitel analysiert die architektonische Gestaltung und den Tagesablauf in den Kartäuserklöstern, die die strikte Trennung von Außenwelt und dem kontemplativen Leben der Mönche zum Ziel hatten. Es beleuchtet die räumliche Anordnung der Zellen, die Schweigepflicht und die streng reglementierten Aktivitäten als Mittel zur Abgrenzung von der Welt. Das Kapitel stellt dar, wie der Alltag der Kartäuser durch die Consuetudines minutiös geregelt war, um eine konsequente Distanz zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Die Architektur des Klosters, als Ausdruck der Ordensregel, wird als zentrale Komponente in der Gestaltung des klösterlichen Lebens verstanden.
3. Die Kartause St. Margarethental und die Bürger der Stadt Basel: Dieses Kapitel untersucht die Interaktionen der Basler Kartause mit den Bürgern der Stadt Basel. Es analysiert die verschiedenen Formen der Beziehung, die von wirtschaftlichen Transaktionen bis hin zu sozialen und spirituellen Verbindungen reichten. Das Kapitel erforscht, wie die Kartause in das wirtschaftliche und soziale Gefüge Basels integriert war, ohne die klösterliche Abgeschiedenheit aufzugeben. Hier werden die vielfältigen Austauschformen und deren Bedeutung für das Verständnis des kartäuserischen Lebens im städtischen Umfeld erörtert.
4. Die Basler Kartäuser und ihre Kontakte mit der Universität Basel und den Basler Druckern während des Priorats Jakob Loubers (1480-1502): Dieses Kapitel konzentriert sich auf den intensiven wissenschaftlichen und kulturellen Austausch der Basler Kartause, speziell während des Priorats Jakob Loubers, mit der Universität Basel und den aufstrebenden Basler Druckern. Es beleuchtet die Rolle der Kartause als Zentrum des Wissens und der Gelehrsamkeit im spätmittelalterlichen Basel. Die Analyse der Beziehungen zur Universität und zu den Druckern zeigt die Bedeutung der Kartause als Akteur im intellektuellen Leben der Stadt. Die Kapitel analysiert die Wechselwirkungen zwischen klösterlicher Gelehrsamkeit und dem sich entwickelnden Druckwesen.
Schlüsselwörter
Kartäuserorden, St. Margarethental, Basel, Spätmittelalter, Klösterliche Abgeschiedenheit, Stadtgesellschaft, Universität Basel, Buchdruck, Handschriften, Consuetudines, Kontemplation, Wissenskultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Basler Kartause St. Margarethental
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Basler Kartause St. Margarethental (1401-1564) und ihr Verhältnis zur spätmittelalterlichen Stadt Basel. Der Fokus liegt auf dem scheinbaren Widerspruch zwischen der kartäuserischen Ideologie der Abgeschiedenheit und der tatsächlichen Vernetzung des Klosters mit dem städtischen Leben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Lebensweise der Kartäuser und ihre strikte Regel, die Entwicklung des Kartäuserordens im spätmittelalterlichen städtischen Kontext, die Beziehungen der Basler Kartause zu den Basler Bürgern, die wissenschaftlichen und ökonomischen Verbindungen zur Universität Basel und den Druckern, sowie die Rolle der Kartause im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Basels.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Geschichte des Kartäuserordens und die Basler Kartause ein. Kapitel 2 analysiert die architektonische Gestaltung und den Tagesablauf der Kartäuser, um ihre Abgrenzung von der Außenwelt zu verdeutlichen. Kapitel 3 untersucht die Interaktionen der Kartause mit den Basler Bürgern. Kapitel 4 konzentriert sich auf den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch der Kartause mit der Universität Basel und den Druckern während des Priorats Jakob Loubers (1480-1502).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kartäuserorden, St. Margarethental, Basel, Spätmittelalter, Klösterliche Abgeschiedenheit, Stadtgesellschaft, Universität Basel, Buchdruck, Handschriften, Consuetudines, Kontemplation, Wissenskultur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen der kartäuserischen Ideologie der Abgeschiedenheit und der tatsächlichen Vernetzung der Kartause mit dem städtischen Leben. Sie untersucht, wie die Kartause trotz ihres Strebens nach Abgeschiedenheit in das wirtschaftliche, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Leben Basels eingebunden war.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält ausführliche Zusammenfassungen jedes Kapitels, die die zentralen Inhalte und Argumentationslinien der jeweiligen Abschnitte beschreiben. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über die behandelten Themen und Ergebnisse.
Was ist die Bedeutung des Priorats Jakob Loubers (1480-1502)?
Das Priorat Jakob Loubers wird als besonders bedeutende Periode für den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch der Basler Kartause mit der Universität Basel und den Basler Druckern hervorgehoben. Diese Periode illustriert die intensive Vernetzung des Klosters mit dem intellektuellen Leben der Stadt.
Wie wird die klösterliche Abgeschiedenheit im Kontext des städtischen Lebens dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie die Kartäuser ihre Abgeschiedenheit trotz ihrer Einbindung in das städtische Leben aufrechterhielten. Sie untersucht die architektonischen, rituellen und regelmäßigen Aspekte des klösterlichen Lebens, um dieses Paradox zu erklären.
- Quote paper
- Keno Peterson (Author), 2011, Die Basler Kartause St. Margarethental (1401-1564), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189847