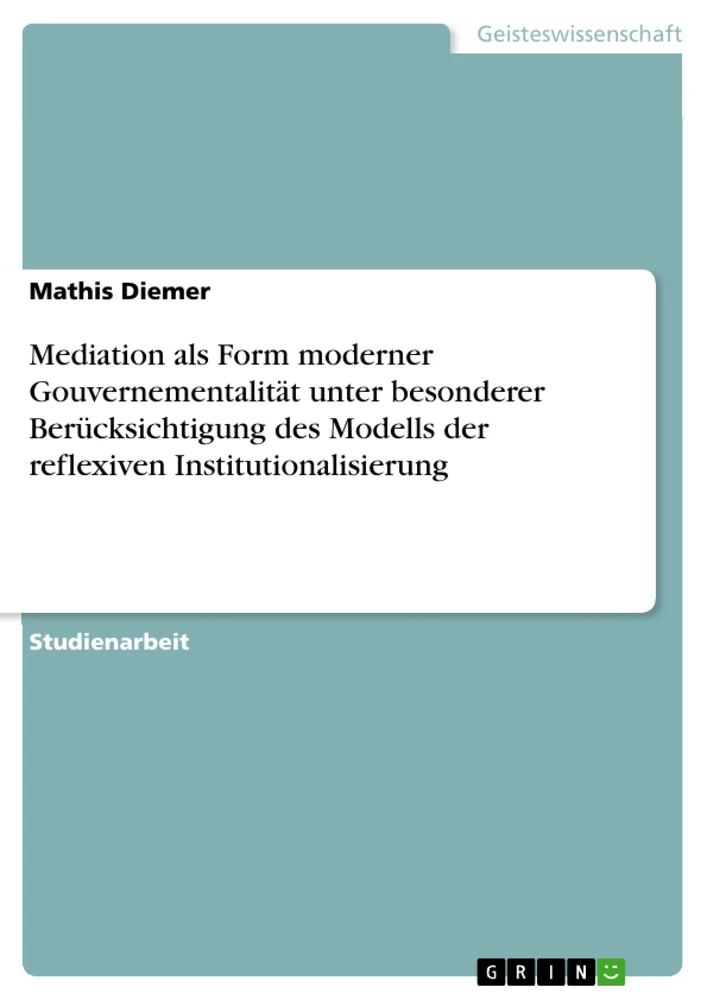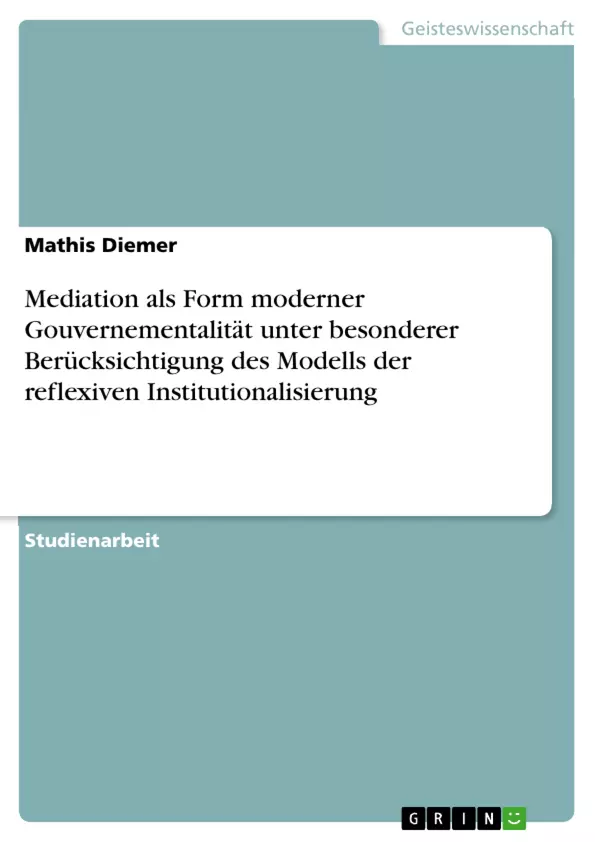[...] In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob mit dem Modell der Mediation ein Instrument geliefert werden kann, das eine konstruktive Ergänzung der bestehenden Institutionen ermöglicht und den Wünschen vieler Bürgerinnen und Bürger nach verstärktem Einfluss auf die Erarbeitung und Umsetzung politischer Inhalte gerecht wird. Um der institutionellen Komponente des Problems gerecht zu werden, bedient sich der Autor dem Modell der reflexiven Institutionalisierung und untersucht, ob Mediation den Ansprüchen dieses institutionellen Modells genügt. Im nächsten Schritt soll aufgezeigt werden, ob das Modell der Mediation einen Ausdruck moderner Gouvernementalität im Sinne Michel Foucaults darstellt und damit als Instrument der Verbindung von Herrschaftstechnik und Selbsttechnologie bezeichnet werden kann.
Die analyseleitenden Fragestellungen lauten: Kann das Modell der Mediation als Ausdruck reflexiver Institutionalisierung bezeichnet werden? Kann Mediation als Ausdruck neoliberaler Gouvernementalität angesehen werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemdefinition und Fragestellungen
- Vorgehensweise
- Forschungsstand
- Gouvernementalität, Reflexive Institutionalisierung, Mediation
- Gouvernementalität nach Foucault und „gouvernmentality studies“
- Reflexive Institutionalisierung
- Das Modell der Mediation
- Beantwortung der analyseleitenden Fragestellungen
- Mediation als Ausdruck reflexiver Institutionalisierung? Mediation als Ausdruck neoliberaler Gouvernementalität?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Modell der Mediation im Hinblick auf seine Rolle als Instrument zur Gestaltung moderner Gouvernementalität. Dabei wird besonders auf das Modell der reflexiven Institutionalisierung Bezug genommen, um zu untersuchen, ob und wie Mediation einen Beitrag zur konstruktiven Ergänzung bestehender Institutionen leisten kann. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Mediation Ausdruck reflexiver Institutionalisierung und zugleich Ausdruck neoliberaler Gouvernementalität im Sinne Michel Foucaults darstellt.
- Die Funktionsweise von Mediation als Instrument moderner Gouvernementalität
- Das Modell der reflexiven Institutionalisierung als analytischer Rahmen
- Die Einordnung von Mediation als Ausdruck neoliberaler Regierungsrationalitäten
- Die Verbindung von Selbsttechnologie und Herrschaftstechnik im Kontext von Mediation
- Die Relevanz von Mediation für die Stärkung der Bürgerbeteiligung und -partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Problemdefinition und die Leitfragen der Arbeit vor. Es beleuchtet den Wandel von Herrschaftsideen und die Herausforderungen der modernen Regierungsführung im Kontext der zunehmenden Komplexität und Vernetzung gesellschaftlicher Probleme.
- Gouvernementalität, Reflexive Institutionalisierung, Mediation: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden theoretischen Konzepte, die der Analyse zugrunde liegen. Es stellt das Foucaultsche Konzept der Gouvernementalität vor und beleuchtet den Einfluss von „governmentality studies“. Weiterhin wird das Modell der reflexiven Institutionalisierung vorgestellt und die Bedeutung der Mediation im Kontext dieser Theorien herausgearbeitet.
- Beantwortung der analyseleitenden Fragestellungen: Dieses Kapitel analysiert, ob das Modell der Mediation als Ausdruck reflexiver Institutionalisierung und als Ausdruck neoliberaler Gouvernementalität verstanden werden kann. Anhand der zentralen Merkmale der verwendeten Modelle wird geprüft, inwiefern Mediation den Anforderungen des jeweiligen Konzepts entspricht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gouvernementalität, reflexive Institutionalisierung, Mediation, neoliberale Regierungsrationalitäten, Selbsttechnologie und Herrschaftstechnik. Die Analyse fokussiert auf die Bedeutung der Mediation als Instrument zur Gestaltung von Governance-Prozessen im Kontext des Wandels von Herrschaftsideen und der Herausforderungen der modernen Regierungsführung. Die Forschung greift dabei auf die Konzepte von Michel Foucault, der „governmentality studies“ und der reflexiven Institutionalisierung zurück.
- Quote paper
- Mathis Diemer (Author), 2011, Mediation als Form moderner Gouvernementalität unter besonderer Berücksichtigung des Modells der reflexiven Institutionalisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189651