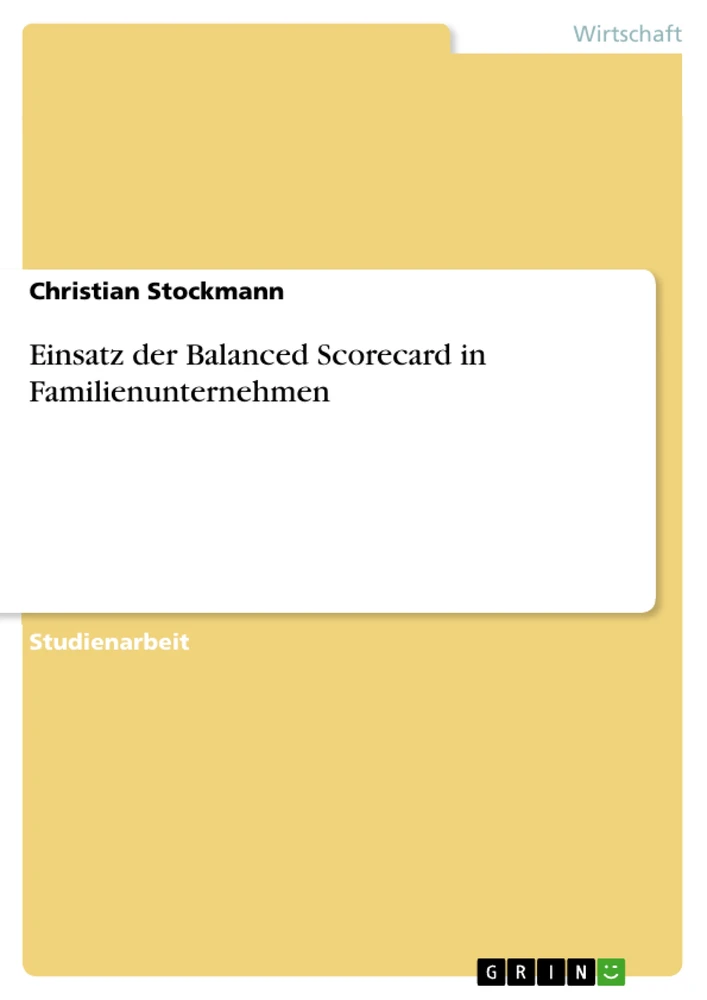I. Inhaltsverzeichnis 1
II. Abbildungsverzeichnis 2
III. Abkürzungsverzeichnis 3
1. Einleitung 4
2. Die Balanced Scorecard 5
2.1. Definition 5
2.2. Die Perspektiven 5
2.2.1. Aufbau der Perspektiven 5
2.2.2. Die Finanzperspektive 6
2.2.3. Kundenperspektive 7
2.2.4. Interne Geschäftsprozessperspektive 7
2.2.5. Lern- und Entwicklungsperspektive 8
2.3. Ziele 8
2.4. Vorteile 9
2.5. Nachteile 9
2.6. Der Implementierungsprozess 10
2.6.1. Grundlage 10
2.6.2. Controlling 11
2.6.3. Missionen und Strategien 11
2.6.4. Roll-Out 12
2.7. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 12
3. Das Familienunternehmen 13
3.1. Definition 13
3.2. Merkmale von Familienunternehmen 13
3.3. Implementierung der BSC in Familienunternehmen 14
4. Fazit 15
IV. Literaturverzeichnis 16
1. Einleitung
Nur wenige Managementsysteme haben in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit erregt, wie die Balanced Scorecard. Das Konzept der Balanced Scorecard ist rund um den Globus bekannt und wird in vielen Unternehmen aller Größenklassen eingesetzt.
Der Anlass für die Entwicklung der Balanced Scorecard war der starke finanzielle Fokus der amerikanischen Managementsysteme, z.B. beim Berichtswesen oder der Planung. Im Gegensatz zu den bisherigen amerikanischen Managementinstrumenten, basiert die Balanced Scorecard nicht nur auf finanziellen sondern auch auf nicht-finanziellen mehrdimensionalen Perspektiven. Darüber hinaus berücksichtigt die Balanced Scorecard neben Ergebniskennzahlen (lagging indicators) wie z.B. die Eigenkapitalrentabilität, die als Spätindikatoren die Ergebnisse messen, auch Leistungstreiber (leading indicators) wie z.B. die Anzahl der Angebote an Neukunden, die auf Entwicklungspotenziale hinweisen und somit als Frühindikatoren dienen.
Durch den Einsatz der Balanced Scorecard im Unternehmen soll dem Management ein Informations- und Meßsystem zur Verfügung gestellt werden, um einen schnellen Überblick über die Geschäftsabläufe im Unternehmen zu gewinnen. Darüber hinaus fungiert sie als Steuerungssystem für die von der Unternehmensleitung konkretisierten operativen und strategischen Maßnahmen über alle Führungsebenen hinweg.
Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es zu prüfen, ob die ursprünglich für Joint Ventures, Zentralabteilungen und Non-Profit-Organisationen entwickelte Balanced Scorecard auch problemlos in Familienunternehmen implementiert werden kann. Daher wird nach der Definition auf die Vor- und Nachteile eingegangen ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Balanced Scorecard
- Definition
- Die Perspektiven
- Aufbau der Perspektiven
- Die Finanzperspektive
- Kundenperspektive
- Interne Geschäftsprozessperspektive
- Lern- und Entwicklungsperspektive
- Ziele
- Vorteile
- Nachteile
- Der Implementierungsprozess
- Grundlage
- Controlling
- Missionen und Strategien
- Roll-Out
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Das Familienunternehmen
- Definition
- Merkmale von Familienunternehmen
- Implementierung der BSC in Familienunternehmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Einsatzmöglichkeiten der Balanced Scorecard im Kontext von Familienunternehmen. Ziel ist es, die Eignung des Managementkonzepts für diese Unternehmenskategorie zu bewerten.
- Definition und Funktionsweise der Balanced Scorecard
- Die verschiedenen Perspektiven der Balanced Scorecard
- Spezifische Merkmale von Familienunternehmen
- Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung der Balanced Scorecard in Familienunternehmen
- Bewertung der Potenziale und Grenzen des Balanced Scorecard-Ansatzes für Familienunternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Balanced Scorecard als relevantes Managementinstrument vor und erläutert die Motivation für die Untersuchung ihrer Anwendung in Familienunternehmen.
- Die Balanced Scorecard: Dieses Kapitel definiert die Balanced Scorecard und beleuchtet die vier Perspektiven: Finanz-, Kunden-, Interne Prozesse- und Lern- und Entwicklungsperspektive.
- Das Familienunternehmen: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Merkmale von Familienunternehmen und diskutiert die Herausforderungen und Chancen bei der Implementierung der Balanced Scorecard in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard, Familienunternehmen, Perspektiven, Finanzperspektive, Kundenperspektive, Interne Prozesse, Lern- und Entwicklungsperspektive, Implementierung, Herausforderungen, Chancen
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Balanced Scorecard (BSC)?
Die BSC ist ein Managementsystem, das neben finanziellen Kennzahlen auch nicht-finanzielle Perspektiven berücksichtigt, um eine ganzheitliche Steuerung des Unternehmens zu ermöglichen.
Welche vier Perspektiven umfasst die klassische Balanced Scorecard?
Sie umfasst die Finanzperspektive, die Kundenperspektive, die interne Geschäftsprozessperspektive sowie die Lern- und Entwicklungsperspektive.
Was ist der Unterschied zwischen Spät- und Frühindikatoren?
Spätindikatoren (lagging indicators) messen vergangene Ergebnisse (z.B. Rentabilität), während Frühindikatoren (leading indicators) wie die Anzahl von Neukundenangeboten auf zukünftige Potenziale hinweisen.
Kann die BSC problemlos in Familienunternehmen eingesetzt werden?
Die Arbeit prüft genau diese Fragestellung und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich durch die Merkmale von Familienunternehmen bei der Implementierung ergeben.
Welche Vorteile bietet die BSC für die Unternehmensleitung?
Sie bietet einen schnellen Überblick über Geschäftsabläufe und dient als Steuerungssystem, um operative und strategische Maßnahmen über alle Führungsebenen hinweg zu koordinieren.
Was gehört zum Implementierungsprozess der BSC?
Der Prozess umfasst die Definition von Missionen und Strategien, die Einbindung des Controllings, den Roll-Out im Unternehmen und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
- Quote paper
- Christian Stockmann (Author), 2011, Einsatz der Balanced Scorecard in Familienunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189485