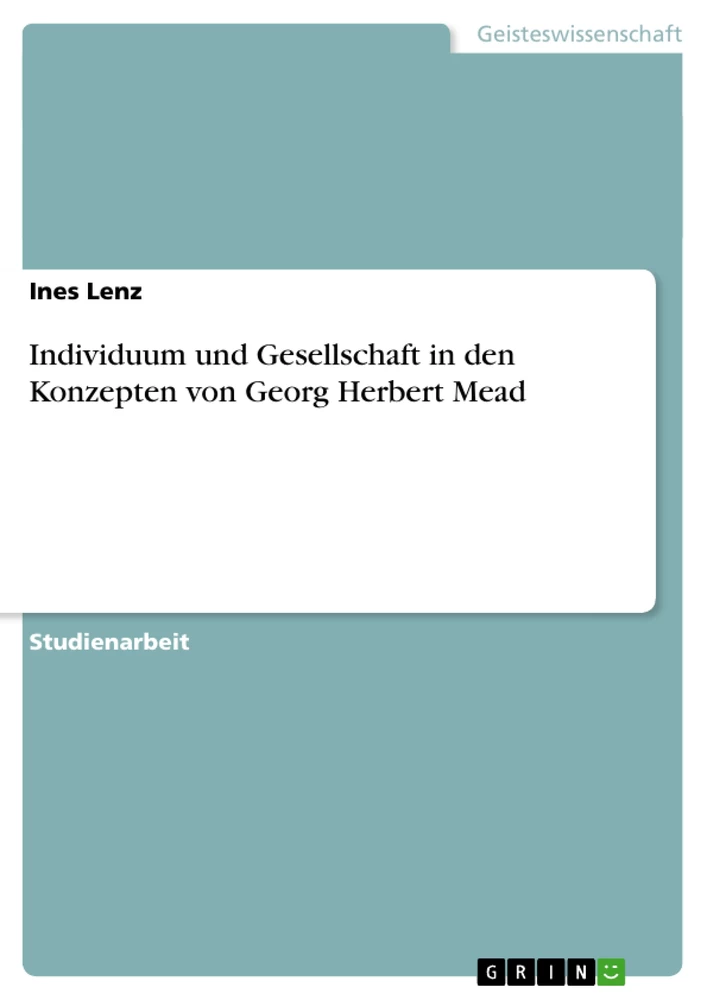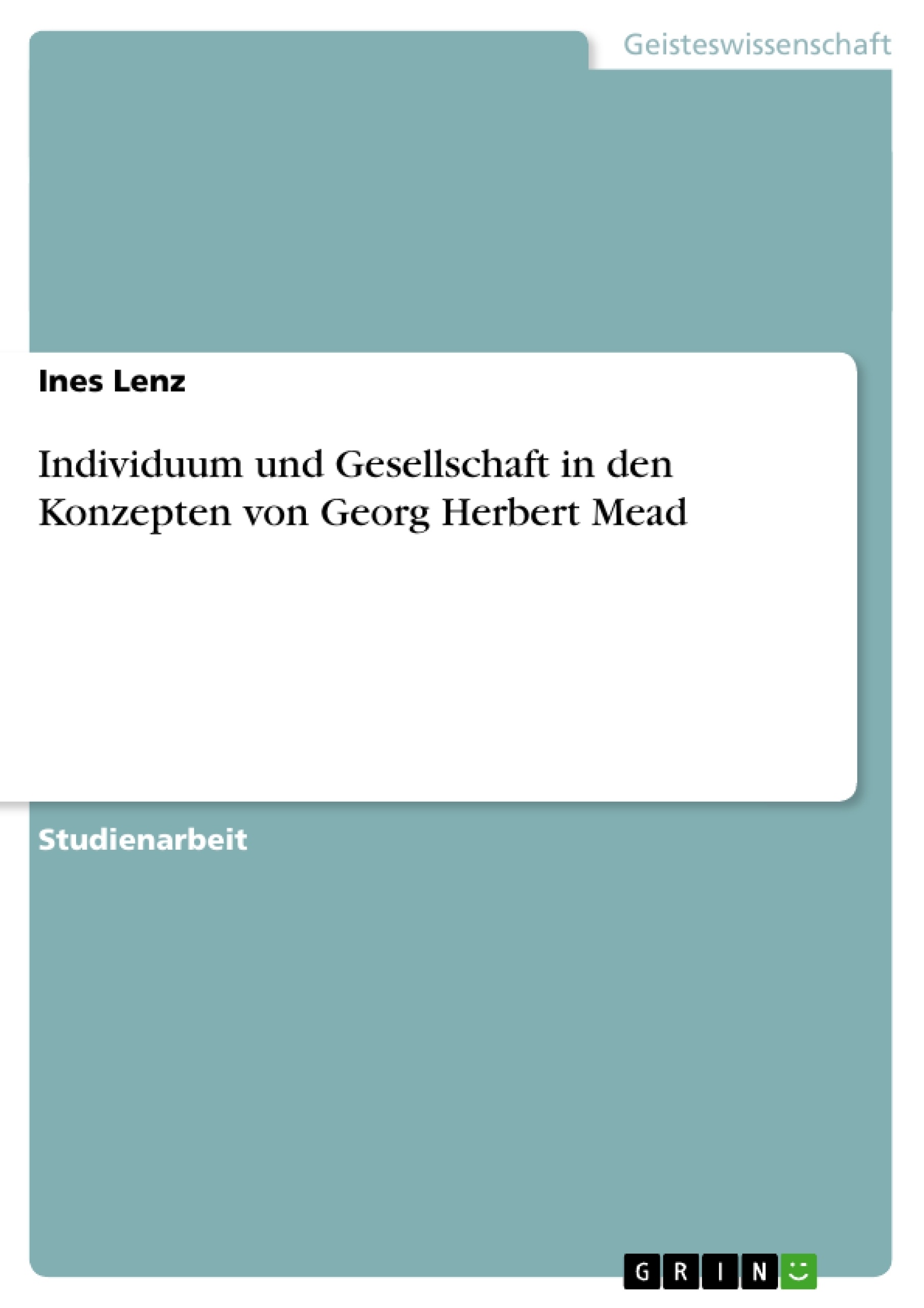Zum Verständnis der Konzepte von George Herbert Mead, ist die
Erörterung von mehreren soziologischen Lehren erforderlich.
Die Chicagoer Schule vertrat eine Empirie, die sich im
Besonderen quantitativ orientierte. Ihre strukturelle-funktionale
Theorie ist die Zusammenfassung des Wertvollsten der
europäischen Klassiker der Soziologie und bildet somit das
Fundament einer „professionell abgesicherten und kumulativen
Erkenntnisgewinnung“.1 Die neu gewonnene Identität des Faches
verdrängte jedoch die Tradition des deutschen Idealismus und
Marxismus, die nicht in das Bild eingefügt werden konnten.
Darüber hinaus wurden auch die Leistungen der pragmatischen
Sozialphilosophie nur unzureichend gewürdigt. Konzeptionen der
Ich-Identität und der Rollenübernahme, das „Thomas-Theorem“
und die Grundidee der biographischen Methode gehören jedoch
zum Standartwissen in der Soziologie. Von allgemeinem
Interesse in den sechziger Jahren war Blumers Fassung des
„interpretativen Ansatzes“. Auch heute noch spielt das Erbe der
Chicagoer Schule eine wichtige Rolle in aktuellen
Theoriediskussionen. Der symbolische Interaktionismus war
jedoch nicht ausgereift genug, um gleichwertig neben der
kritischen Theorie, oder dem Marxismus zu stehen. Daher setzte
sich diese Tradition jahrzehntelang eher durch exemplarische
Forschung und mündliche Übermittlung, als durch theoretische
Systematik und Selbstbegründung durch. Der symbolische Interaktionismus, der seinen Namen von
Herbert Blumer bekam, kennzeichnet sich durch Prozesse der
Interaktion. Der Begriff Interaktion meint hier den
Symbolvermittelnden Charakter sozialen Handelns. Somit
bedeuten soziale Beziehungen nicht die Umsetzung fester
Vorschriften in die Tat, sondern gemeinsame und wechselseitige
Beziehungsdefinitionen. Damit sind soziale Beziehungen nicht
stabil und zum Teil vorhersehbar, sondern offen und an
gemeinsame Anerkennung gebunden.
Der symbolische Interaktionismus gründet auf den
Pragmatismus, eine Philosophie der Handlung. Die
Leitvorstellungen im Denken von Descartes des einsam
zweifelnden Ich werden von der Idee einer kooperativen
Wahrheitssuche zur Bewältigung realer Handlungsprobleme
abgelöst. John Dewey und George Herbert Mead waren
diejenigen, über die die entscheidende Wirkung des
Pragmatismus in die Soziologie übertrat. [...]
1 Hans Joas 1988: symbolischer Interaktionismus. Von der Philosophie des Pragmatismus
zu einer soziologischen Forschungstratition, S.40
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Biographisches zu Georg Herbert Mead
- III Theoretische Grundlagen
- IV Mead und der Behaviorismus
- IV.1 Grundannahmen
- IV.2 Interaktion
- V Grundbegriffe
- V.1 Interaktionsformen
- V.2 Role taking Role making
- V.3 Identität
- VI Meads Theorie des Interaktionismus
- VI.1 Selbst/Identität
- VI.2 Das „Ich“
- VI.3 Das „Mich“
- VII Qualitäten der Interaktionistische Theorie nach Habermas
- VII.1 Das Meadsche Sozialisationsmodell
- VII.2 Die Gesellschaft
- VII.3 „Die Soziale Kontrolle“
- VII.3.1 Beispiel: Meads Idealgesellschaft
- VII.4 Die gesellschaftlichen Konflikte
- VIII Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Konzepte von Georg Herbert Mead zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die Arbeit erörtert die theoretischen Grundlagen von Meads Interaktionismus, beleuchtet seine zentralen Begriffe und analysiert die Bedeutung seiner Theorie für das Verständnis von Sozialisation, Identität und gesellschaftlicher Ordnung.
- Meads Bezug zum Behaviorismus und Pragmatismus
- Die Rolle von Interaktion und Symbolen in Meads Theorie
- Die Konzepte von „Ich“ und „Mich“ in der Entwicklung der Identität
- Meads Verständnis von Sozialisation und gesellschaftlicher Kontrolle
- Eine kritische Auseinandersetzung mit Meads Theorie im Kontext der soziologischen Diskussion.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Meads Konzepten im Kontext der soziologischen Tradition. Sie hebt die Bedeutung des pragmatischen Ansatzes und des symbolischen Interaktionismus hervor, wobei die Limitationen des symbolischen Interaktionismus im Vergleich zu anderen soziologischen Theorien hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, verschiedene soziologische Lehren zu betrachten, um Meads Konzepte umfassend zu verstehen. Die Chicagoer Schule und ihre methodologischen Ansätze werden als wichtiger Kontext erwähnt.
II Biographisches zu Georg Herbert Mead: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, da nur der Titel angegeben ist.)
III Theoretische Grundlagen: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, da nur der Titel angegeben ist.)
IV Mead und der Behaviorismus: Dieses Kapitel untersucht Meads Verhältnis zum Behaviorismus. Es beleuchtet die Grundannahmen des Behaviorismus und wie Mead diese kritisch aufgreift und weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf dem Konzept der Interaktion und wie diese durch symbolische Kommunikation gestaltet wird. Es wird die Abkehr von einer rein reiz-reaktionsbasierten Handlungstheorie hin zu einem Verständnis von Handlungen als selbstreflexiven Prozessen dargestellt.
V Grundbegriffe: Das Kapitel definiert zentrale Begriffe in Meads Theorie. Die verschiedenen Interaktionsformen werden erklärt und der Prozess des „Role taking“ und „Role making“ im Kontext der Identitätsentwicklung wird detailliert beschrieben. Die Bedeutung der Rollenübernahme für das Verständnis von Selbst und Gesellschaft wird betont.
VI Meads Theorie des Interaktionismus: Dieses Kapitel stellt Meads Theorie des Interaktionismus dar. Es erläutert die Konzepte von „Ich“ und „Mich“ als zentrale Elemente der Identität und erklärt deren Interaktion und den Prozess der Selbstreflexion. Die Bedeutung der symbolischen Interaktion für die Herausbildung des Selbst wird hervorgehoben.
VII Qualitäten der Interaktionistische Theorie nach Habermas: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, da nur der Titel angegeben ist.)
Schlüsselwörter
Georg Herbert Mead, Symbolischer Interaktionismus, Pragmatismus, Behaviorismus, Identität, Selbst, „Ich“, „Mich“, Interaktion, Sozialisation, Gesellschaft, Soziale Kontrolle, Rollenübernahme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Georg Herbert Mead: Individuum und Gesellschaft"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Georg Herbert Meads Konzepte zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen seines Interaktionismus, beleuchtet zentrale Begriffe wie „Ich“ und „Mich“, und analysiert die Bedeutung seiner Theorie für Sozialisation, Identität und gesellschaftliche Ordnung. Die Arbeit bezieht sich auf Meads Verhältnis zum Behaviorismus und Pragmatismus und beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Theorie im soziologischen Kontext.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Meads Bezug zum Behaviorismus und Pragmatismus; die Rolle von Interaktion und Symbolen in Meads Theorie; die Konzepte von „Ich“ und „Mich“ in der Identitätsentwicklung; Meads Verständnis von Sozialisation und gesellschaftlicher Kontrolle; eine kritische Auseinandersetzung mit Meads Theorie im Kontext der soziologischen Diskussion; sowie eine detaillierte Erläuterung der Interaktionsformen und des Prozesses des „Role taking“ und „Role making“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die die Thematik einführt und den pragmatischen Ansatz und den symbolischen Interaktionismus hervorhebt; ein biographisches Kapitel zu Georg Herbert Mead (Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext); ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Zusammenfassung fehlt); ein Kapitel zu Meads Verhältnis zum Behaviorismus, welches dessen Grundannahmen und Meads Weiterentwicklung beleuchtet; ein Kapitel zu zentralen Begriffen wie Interaktionsformen, „Role taking“ und „Role making“ und Identität; ein Kapitel zu Meads Interaktionismus mit Erläuterung von „Ich“ und „Mich“; ein Kapitel zu den Qualitäten der interaktionistischen Theorie nach Habermas (Zusammenfassung fehlt); und abschließend ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Die zentralen Schlüsselbegriffe sind: Georg Herbert Mead, Symbolischer Interaktionismus, Pragmatismus, Behaviorismus, Identität, Selbst, „Ich“, „Mich“, Interaktion, Sozialisation, Gesellschaft, Soziale Kontrolle, Rollenübernahme.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft nach Mead. Sie erörtert die theoretischen Grundlagen seines Interaktionismus, erklärt seine zentralen Begriffe und analysiert die Bedeutung seiner Theorie für das Verständnis von Sozialisation, Identität und gesellschaftlicher Ordnung.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Arbeit in Kapitel und Unterkapitel. Es beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Biographie Meads, seinen theoretischen Grundlagen, seinem Verhältnis zum Behaviorismus, seinen Grundbegriffen, seiner Interaktionismus-Theorie, einer Analyse seiner Theorie im Lichte von Habermas und einem abschließenden Fazit. Viele Unterkapitel sind detailliert aufgelistet.
Wo finde ich Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Zusammenfassungen sind für die Kapitel I, IV, V und VI vorhanden. Für die Kapitel II, III und VII fehlen die Zusammenfassungen im vorliegenden Ausgangstext.
- Quote paper
- Ines Lenz (Author), 2004, Individuum und Gesellschaft in den Konzepten von Georg Herbert Mead, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18920