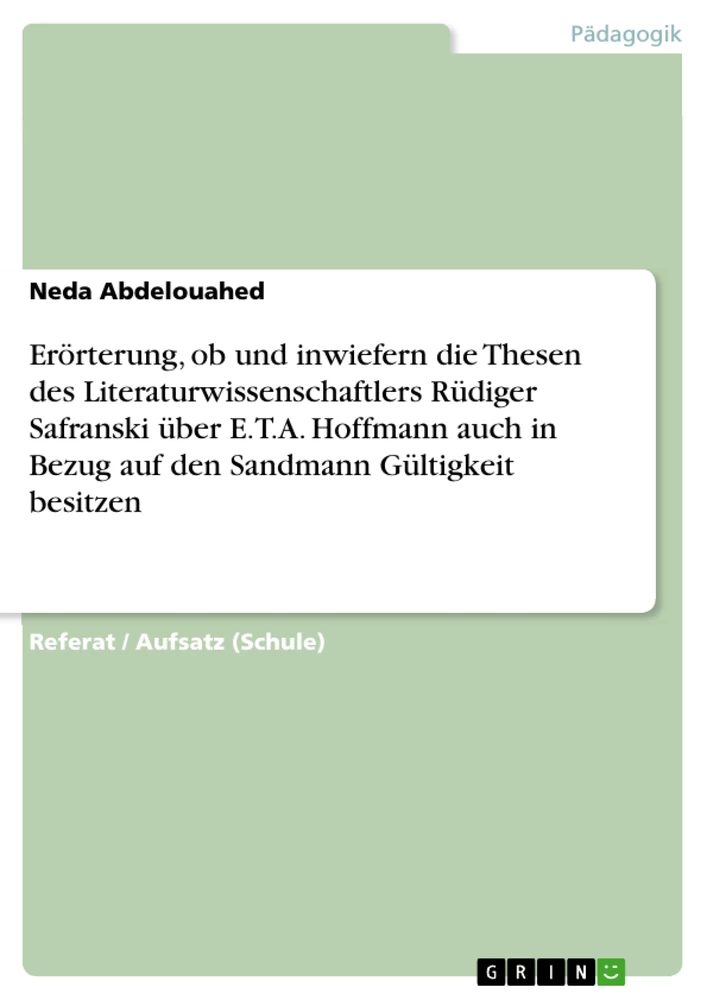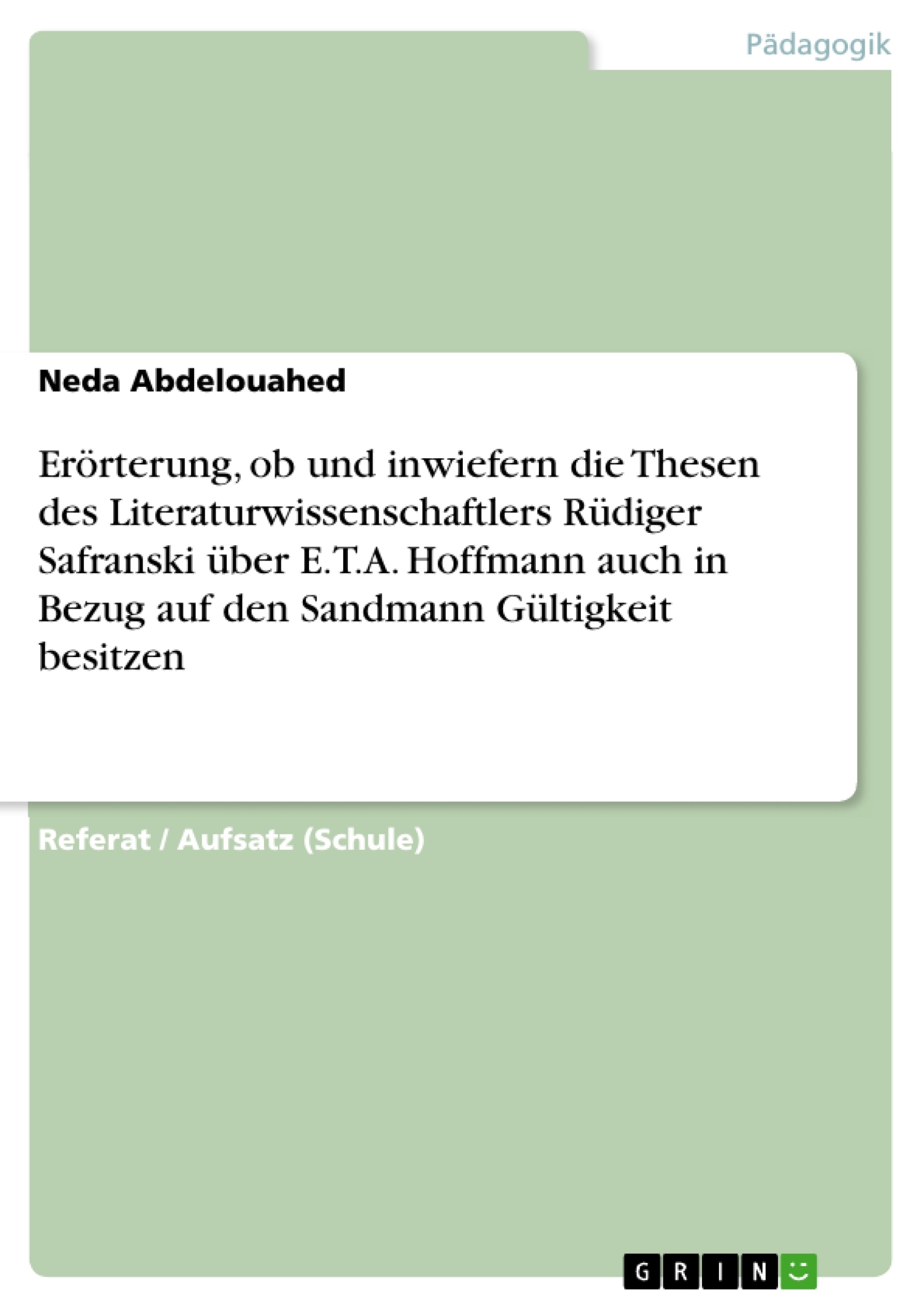Die Thesen Rüdiger Safranskis im Bezug auf die romantischen Autoren Eichendorff und Hoffmann beziehen sich auf deren unterschiedlichen Umgang mit den Elementen des Übersinnlichen.
Eichendorff, ein Vertreter der positiven Romantik, beschäftigte sich vornehmlich mit den göttlich-spirituellen Aspekten des Übernatürlichen. Hoffmann, der sich schon zu Lebzeiten den Beinamen Schauer-Hoffmann einspielte, beschäftigte sich in seiner Literatur mit den unheimlichen, gespenstischen Seiten des Unterbewusstseins und des Übersinnlichen. Der Umgang mit den Gegebenheiten jenseits des Fassbaren ist immer ein Grenzgang zum Wahnsinn. Was vielen Figuren der romantischen Erzählung widerfährt, ist ein Schicksal, welches ihren Schöpfern nicht erspart bleiben muss. Das Wahrhaftige nicht mehr vom Fantastischen unterscheiden zu können liegt nahe, wenn man sich so eingehend in die Möglichkeiten jenseits der sichtbaren Welt hineindenkt. Diesem Grenzgang begegnen die romantischen Autoren auf verschiedene Weisen. Denn nicht nur inhaltlich, sondern auch theoretisch ist die Romantik keineswegs eine homogene Epoche.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Himmelsleiter befestigt im Leben
- II. Das große Gelächter
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Gültigkeit der Thesen des Literaturwissenschaftlers Rüdiger Safranski über E.T.A. Hoffmann im Kontext der Novelle "Der Sandmann". Insbesondere wird untersucht, ob und inwiefern Hoffmanns Umgang mit dem Übersinnlichen in "Der Sandmann" mit Safranskis Beobachtungen übereinstimmt, die er im Bezug auf Hoffmanns Werk "Die Elixiere des Teufels" formuliert hat.
- Untersuchung der Gültigkeit von Safranskis Thesen über Hoffmann in Bezug auf "Der Sandmann"
- Analyse von Hoffmanns Umgang mit dem Übersinnlichen und dessen Verwurzelung im Alltag
- Die Rolle der Ironie und des Realismus in Hoffmanns Werk
- Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft in "Der Sandmann"
- Vergleich von Hoffmanns Werk mit Eichendorffs Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Himmelsleiter befestigt im Leben
Dieses Kapitel beleuchtet, wie Hoffmann in "Der Sandmann" die Verbindung zwischen dem Alltag und dem Übersinnlichen herstellt. Die Geschichte von Nathanael, einem Studenten aus einer bürgerlichen Familie, beginnt im gewöhnlichen Leben. Doch durch die Figur des Coppelius, der in Nathanaels kindlicher Wahrnehmung zum "Sandmann" wird, wird das Unheimliche in die Geschichte eingeführt. Die Verlobung Nathanaels mit Klara, seine Studienzeit und der Briefkontakt mit seiner Familie verdeutlichen die Verwurzelung der Geschichte im bürgerlichen Alltag. Auch Nathanaels zunehmender Wahnsinn und seine Einweisung in eine Anstalt sind gesellschaftlich nachvollziehbar. Hoffmann gelingt es, den Leser den Gedankengang vom Realen ins Übersinnliche zu begleiten und das Fantastische im Äußeren zu erblicken.
II. Das große Gelächter
Im zweiten Kapitel wird die Rolle der Ironie in Hoffmanns Werk und ihre Verbindung zu seinem Umgang mit dem Realismus untersucht. Safranskis These, dass Hoffmann mit frommer Ironie die Abgründe des Unterbewusstseins erforscht und den fehlenden Spiritualismus durch Humor kompensiert, wird anhand des Frauenbildes in "Der Sandmann" illustriert. Die ironische Darstellung von Claras und die Automatenfigur Olimpia, die in der Gesellschaft als Mensch akzeptiert wird, verdeutlichen Hoffmanns Kritik an den Erwartungen an Frauen und die Oberflächlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Auch die Vaterrolle und die undurchsichtige Beziehung zwischen Nathanaels Vater und Coppelius werden mit einer ironischen Note betrachtet. Die Geheimnisse und das Vorenthalten von Informationen durch den Vater dienen Hoffmann als Kritik an der Distanziertheit der klassischen Vaterrolle und verstärken Nathanaels Neigung, das Unheimliche zu interpretieren.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Rüdiger Safranskis Thesen zu E.T.A. Hoffmann?
Safranski betont Hoffmanns Grenzgang zwischen Alltag und Wahnsinn sowie die Nutzung von Ironie, um die Abgründe des Unheimlichen im bürgerlichen Leben zu bewältigen.
Wie wird das Übersinnliche in „Der Sandmann“ dargestellt?
Es ist tief im bürgerlichen Alltag verwurzelt; das Unheimliche bricht durch Figuren wie Coppelius in die Realität des Protagonisten Nathanael ein.
Welche Rolle spielt die Ironie in Hoffmanns Werk?
Ironie dient als Mittel, um die bürgerliche Gesellschaft zu kritisieren (z. B. durch die Puppe Olimpia) und den Schrecken des Fantastischen distanzierbar zu machen.
Was unterscheidet Hoffmann von Eichendorff?
Eichendorff vertritt eine „positive Romantik“ mit Fokus auf das Göttliche, während Hoffmann (der „Schauer-Hoffmann“) die dunklen Seiten des Unterbewusstseins erkundet.
Ist Nathanaels Wahnsinn in „Der Sandmann“ real oder übernatürlich?
Hoffmann lässt dies bewusst in der Schwebe; Nathanaels Schicksal ist sowohl psychologisch als auch durch die phantastische Perspektive deutbar.
- Arbeit zitieren
- Neda Abdelouahed (Autor:in), 2012, Erörterung, ob und inwiefern die Thesen des Literaturwissenschaftlers Rüdiger Safranski über E.T.A. Hoffmann auch in Bezug auf den Sandmann Gültigkeit besitzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188893