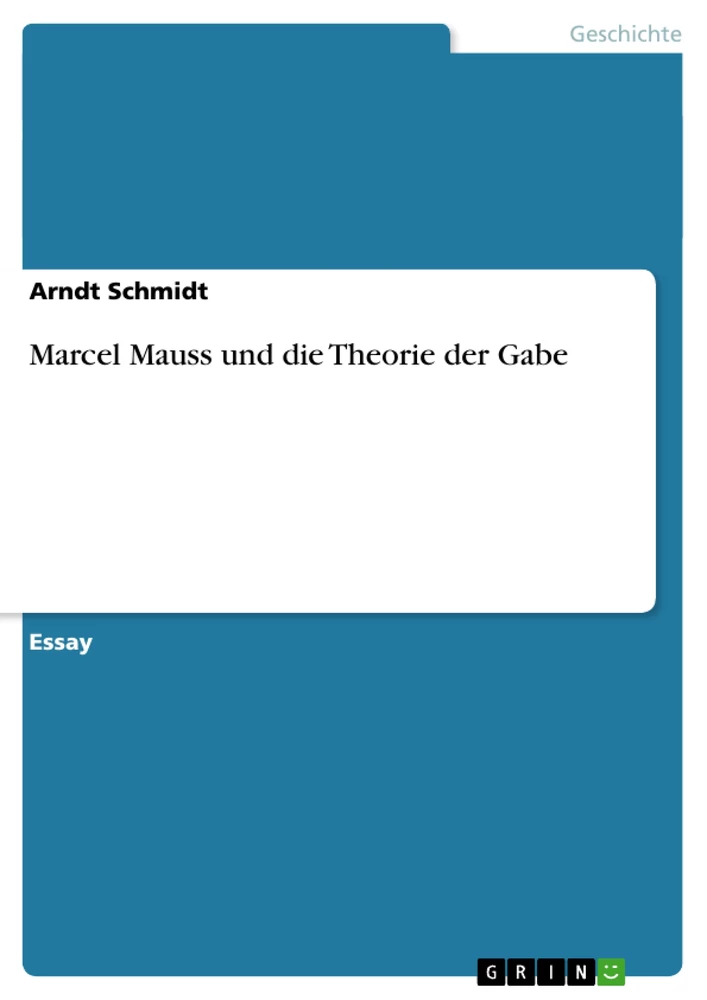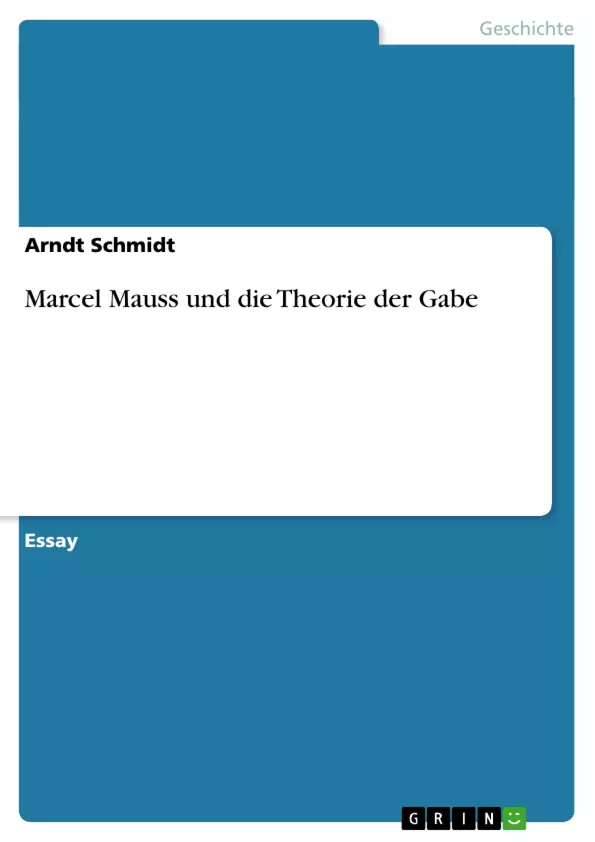„Der homo oeconomicus steht nicht hinter uns, sondern vor uns – wie der moralische Mensch, der pflichtbewusste Mensch, der wissenschaftliche Mensch und der vernünftige Mensch. Lange Zeit war der Mensch etwas anderes; und es ist noch nicht sehr lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.“
Marcel Mauss beschließt sein berühmtes Werk „Die Gabe“ mit einigen „Sozial- und nationalökonomischen Schlussfolgerungen“, in denen er Kritik übt an der Privilegierung materieller Nützlichkeit, der Verfolgung individueller Zwecke und der reinen Pro-fitmaximierung, die seiner Ansicht zufolge dem Rationalismus der Moderne geschuldet sind und „dem Frieden, des Ganzen, dem Rhythmus unserer Arbeit und unserer Freuden und damit letztlich dem Einzelnen selbst“ schaden.
Nach einem kurzen Überblick zur Person Marcel Mauss sollen im Folgenden die Kernaspekte seiner Kulturtheorie der Gabe Erläuterung finden. Im Vordergrund ste-hen dabei seine Ausführungen zur Ökonomie des Gabentausches in Polynesien und dem Südpazifik. Mauss’ Lesart der Ökonomie zeigt den kontingenten Charakter der Wirtschaftsordnungen auf, die unser gesellschaftliches Zusammenleben maßgeblich bestimmen. Vor dem Hintergrund derzeitiger wirtschaftlicher Krisen gelesen verdeut-licht seine Kritik an einem essentialistischen Verständnis vom homo oeconomicus, dass eine Orientierung am Primat der Gewinnmaximierung weder naturgegeben noch ohne Alternativen sein muss.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Person
- III. Marcel Mauss' Theorie der Gabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Kulturtheorie der Gabe von Marcel Mauss. Im Zentrum stehen die Kernaussagen seiner Schrift „Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften“ sowie seine Kritik an einer rein rationalistischen und individualistischen Sichtweise auf Ökonomie und Gesellschaft.
- Marcel Mauss' Biografie und sein sozialistisches Engagement
- Das Prinzip der totalen Leistung und die Funktion des Geschenkaustauschs
- Die Relevanz von Moral und Ehre im Rahmen des Wirtschaftens
- Kritik am homo oeconomicus und die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts
- Die Rolle von Prestige und Verpflichtung im Gabentausch
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Der Text beginnt mit einer Kritik an der modernen ökonomischen Denkweise, die Mauss als zu stark auf materielle Nützlichkeit und individuelle Profite ausgerichtet ansieht. Er stellt die zentrale Frage nach der Kraft der Gabe, die den Empfänger zur Gegenleistung verpflichtet.
II. Zur Person
Dieses Kapitel beleuchtet das Leben und Wirken von Marcel Mauss, einem französischen Soziologen, Ethnologen und Religionshistoriker. Es werden seine sozialistischen Überzeugungen und sein politisches Engagement, vor allem im Kontext der Dreyfus-Affäre und des Ersten Weltkriegs, dargestellt. Die Betonung liegt auf Mauss' Interesse an der Ganzheitlichkeit von Gesellschaft und seinem Einsatz für soziale Reformen.
III. Marcel Mauss' Theorie der Gabe
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Kernpunkten der „Theorie der Gabe“. Mauss untersucht den Geschenkaustausch als „totale soziale Tatsache“, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch moralische, rechtliche, religiöse und ästhetische Aspekte beinhaltet. Besonderes Gewicht liegt auf dem Konzept des „Potlatsch“ als einer Form der totalen Leistung, die Prestige und Hierarchien in der Gesellschaft aushandelt. Mauss betont die Bedeutung der Erwiderungspflicht als zentralen Mechanismus des Gabentauschs und beleuchtet die Verknüpfung von Sach- und Personenrecht in archaischen Gesellschaften. Der Begriff „tonga“ als Ausdruck von Besitz und Prestige, eng verknüpft mit dem „mana“ des Gebers, wird eingeführt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte des Textes sind: Marcel Mauss, Kulturtheorie der Gabe, Geschenkaustausch, totale Leistung, Potlatsch, Erwiderungspflicht, tonga, mana, homo oeconomicus, Moral, Ökonomie, archaische Gesellschaften, soziales Zusammenleben.
- Quote paper
- Arndt Schmidt (Author), 2010, Marcel Mauss und die Theorie der Gabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188871