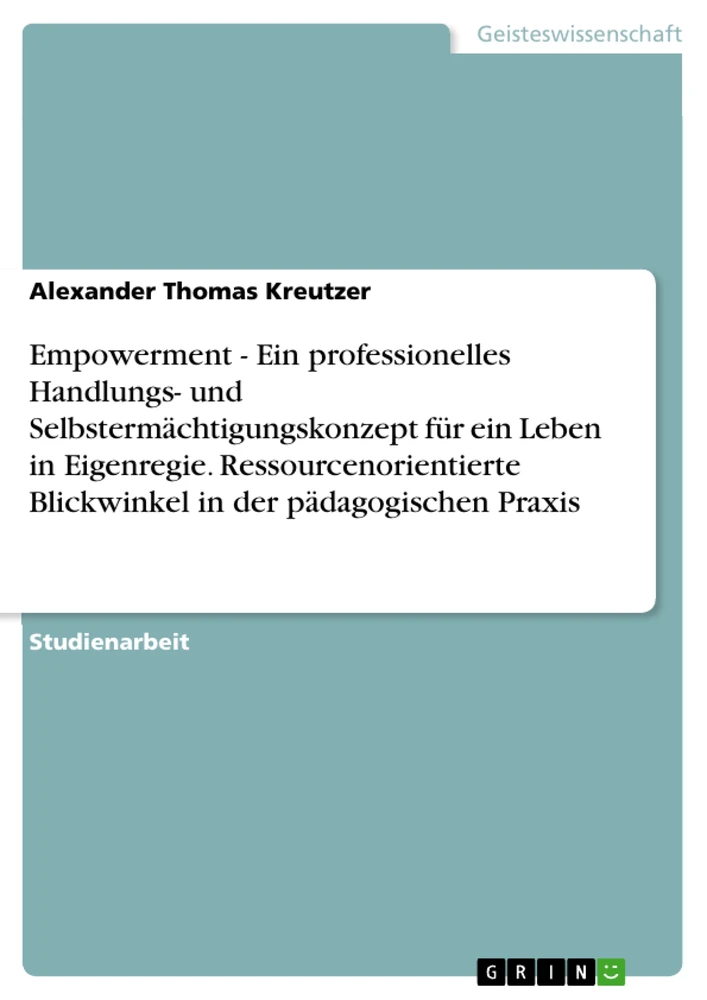Denken ist Krieg, ein Krieg der Ideen. Ideenreichtum im sozialwissenschaftlichen und psychosozialen Kontext, erzeugt oft ein Bild, das sich durch unterschiedliche Konzepte, Wege und Möglichkeiten immer wieder aufs Neue zeichnet. Dabei ist die Idee und das Konzept der Anfang für die Entstehung neuer Zukunftshorizonte. Konzeptionelle Neuerungen und alternative Praxisentwürfe werden auf Basis von unterschiedlichen Blickwinkeln ausgeführt, entweder wieder verworfen oder in das Fortschrittsprogramm der Sozialen Arbeit integriert. Manche Begriffe oder Konzepte erweisen sich dabei im Zyklus der Konjunktur als wertvoll, manche verlieren zunehmend an Bedeutung. Viele führen hierbei aber auch oft zu neuen Methoden, die produktiv eingesetzt werden können, um belastende Lebenssituationen zu verringern.
Empowerment (im Kontext der Sozialen Arbeit), als Konzept der Selbstbemächtigung von Menschen in Lebenskrisen, hat sich dabei als sicherer Gewinner auf dem sozialwissenschaftlichen Ideenmarkt erwiesen. Dabei richtet sich der Blick dieses Konzeptes auf die Selbstgestaltungskräfte der Adressaten Sozialer Arbeit, mit der Zielsetzung diese einzusetzen, um zur positiven Veränderung bestehender und belastender Lebenssituationen beizutragen. Das einzelne Individuum, aber auch die Gruppe, ist sozusagen als Regisseur ihres eigenen Lebens anzusehen. Empowerment hierzu ist als Starkmacher, Befähiger von Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu verstehen, das den Klienten bei der Suche nach Lebensräumen und Lebenszukünften unterstützt, aber auch einen Zugewinn von Unabhängigkeit, sozialer Teilhabe und eigene Lebensregie verspricht. In der Sozialen Arbeit ist es, als Anstifter zur (Wieder-) Aneignung zur Selbstbestimmung eigener Lebensumstände, zu einem wichtigen Bestandteil professioneller Handlungskonzepte gewachsen. (Vgl. Herriger 1997, S.6ff)
Fokus dabei ist nicht mehr der Defizit-orientierte Blickwinkel, sondern die Stärken des Individuums oder einer Gruppe. In der folgenden Studienarbeit wird die Idee, der Begriff, die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte und das Konzept (sowohl theoretisch, als auch praktisch) des Empowerment -Gedankens verdeutlicht und erklärt. Empowerment kommt nicht nur in den Sozialwissenschaften und der damit verbundenen Sozialen Arbeit vor. Der Begriff wird in der vorliegenden Studienarbeit jedoch nur im Kontext der Sozialen Arbeit betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff Empowerment
- 2.1 Wörtliche Bedeutung
- 2.2 Empowerment- ein Importbegriff
- 3. Empowerment- Das Konzept
- 3.1 Von der Selbstbestimmung und Partizipation zum Konzept Empowerment
- 3.2 Das Konzept Empowerment
- 4. Psychologisches und politisches Empowerment
- 4.1 Psychologisches Empowerment
- 4.2 Politisches (soziales) Empowerment
- 5. Ansätze in der pädagogischen Praxis
- 5.1 Erlernte Hilflosigkeit
- 5.2 Ressourcenorientierte Beratung in der Alltagspraxis
- 5.3 Ressourcen in der Empowermentpraxis
- 5.4 Empowerment Phasen
- 5.5 Rollen der SozialarbeiterInnen
- 6. Empowerment im Migrationsdienst/ Interview
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht das Empowerment-Konzept im Kontext der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, den Begriff, seine Entstehungsgeschichte und seine Anwendung in der Praxis zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den ressourcenorientierten Ansätzen und der Stärkung der Selbstbestimmung der Klienten.
- Der Begriff Empowerment: Definition und Herleitung
- Das Empowerment-Konzept: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung
- Psychologisches und politisches Empowerment: Unterschiedliche Perspektiven
- Empowerment in der pädagogischen Praxis: Methoden und Herausforderungen
- Empowerment im Migrationskontext: Ein Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Empowerment ein und beschreibt dessen Bedeutung im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie hebt die Bedeutung ressourcenorientierter Ansätze hervor und positioniert Empowerment als zukunftsweisendes Konzept zur Bewältigung belastender Lebenssituationen. Der Fokus auf die Selbstbestimmung des Individuums und die Stärkung seiner Handlungsfähigkeit wird betont.
2. Der Begriff Empowerment: Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Empowerment" aus verschiedenen Perspektiven. Es betrachtet die wörtliche Bedeutung des Wortes, seine Herkunft und seine Rezeption im deutschsprachigen Raum. Der Abschnitt differenziert zwischen politischen, lebensweltlichen und reflexiven Interpretationen des Begriffs und zeigt die Vielschichtigkeit und die Entwicklung des Verständnisses von Empowerment auf.
3. Empowerment- Das Konzept: Hier wird das Empowerment-Konzept umfassend dargestellt. Es wird der Weg von Selbstbestimmung und Partizipation zum Konzept Empowerment nachvollzogen und das Konzept selbst detailliert erklärt. Der Abschnitt vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis der theoretischen Grundlagen und der praktischen Implikationen des Empowerment-Ansatzes.
4. Psychologisches und politisches Empowerment: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen psychologischem und politischem Empowerment. Es untersucht die individuellen und gesellschaftlichen Aspekte der Selbstbemächtigung und beleuchtet die Interdependenz zwischen individueller Stärke und strukturellen Bedingungen. Die Analyse verdeutlicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der sowohl die individuellen Ressourcen als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
5. Ansätze in der pädagogischen Praxis: Dieses Kapitel widmet sich der Anwendung des Empowerment-Gedankens in der pädagogischen Praxis. Es betrachtet die Problematik der erlernten Hilflosigkeit, die Bedeutung ressourcenorientierter Beratung und die Rolle von Ressourcen im Empowerment-Prozess. Die Darstellung der Empowerment-Phasen und der Rolle der SozialarbeiterInnen gibt praktische Handlungsanleitungen.
6. Empowerment im Migrationsdienst/ Interview: Dieses Kapitel präsentiert ein Interviewbeispiel aus dem Migrationsdienst, welches die praktische Anwendung des Empowerment-Konzepts im konkreten Kontext illustriert. Der Abschnitt zeigt die Herausforderungen und die Möglichkeiten der Selbstbemächtigung im Migrationskontext auf und liefert wertvolle Einblicke in die Praxis.
Schlüsselwörter
Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstveränderung, Ressourcenorientierung, Soziale Arbeit, pädagogische Praxis, Migrationsdienst, politisches Empowerment, psychologisches Empowerment, Hilflosigkeit, Partizipation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Empowerment in der Sozialen Arbeit"
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Diese Studienarbeit untersucht das Empowerment-Konzept im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet den Begriff, seine Entstehungsgeschichte und seine Anwendung in der Praxis, mit Fokus auf ressourcenorientierte Ansätze und die Stärkung der Selbstbestimmung der Klienten. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine detaillierte Analyse des Empowerment-Begriffs, eine Erläuterung des Empowerment-Konzepts, eine Unterscheidung zwischen psychologischem und politischem Empowerment, die Anwendung in der pädagogischen Praxis, ein Interviewbeispiel aus dem Migrationsdienst und ein Fazit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Herleitung des Begriffs Empowerment, theoretische Grundlagen und praktische Anwendung des Empowerment-Konzepts, unterschiedliche Perspektiven von psychologischem und politischem Empowerment, Methoden und Herausforderungen von Empowerment in der pädagogischen Praxis, und ein Fallbeispiel von Empowerment im Migrationskontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Begriff Empowerment (inkl. wörtlicher Bedeutung und Importcharakter), Empowerment – Das Konzept (inkl. Selbstbestimmung und Partizipation), Psychologisches und politisches Empowerment, Ansätze in der pädagogischen Praxis (inkl. erlernter Hilflosigkeit, ressourcenorientierter Beratung und Rollen der SozialarbeiterInnen), Empowerment im Migrationsdienst/ Interview und Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was ist der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf ressourcenorientierten Ansätzen und der Stärkung der Selbstbestimmung der Klienten. Es wird untersucht, wie Empowerment in der Praxis angewendet werden kann und welche Herausforderungen dabei bestehen, insbesondere im Migrationskontext.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstveränderung, Ressourcenorientierung, Soziale Arbeit, pädagogische Praxis, Migrationsdienst, politisches Empowerment, psychologisches Empowerment, Hilflosigkeit, Partizipation.
Was wird im Kapitel "Ansätze in der pädagogischen Praxis" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung von Empowerment in der Pädagogik. Es thematisiert die erlernte Hilflosigkeit, die Bedeutung ressourcenorientierter Beratung, die Rolle von Ressourcen im Empowerment-Prozess, die Phasen des Empowerments und die Rolle der SozialarbeiterInnen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den Begriff Empowerment, seine Entstehungsgeschichte und seine Anwendung in der Praxis zu beleuchten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis und der praktischen Umsetzung ressourcenorientierter Ansätze zur Stärkung der Selbstbestimmung der Klienten.
Wie wird der Begriff "Empowerment" definiert?
Die Arbeit analysiert den Begriff "Empowerment" aus verschiedenen Perspektiven, betrachtet seine wörtliche Bedeutung, Herkunft und Rezeption im deutschsprachigen Raum und differenziert zwischen politischen, lebensweltlichen und reflexiven Interpretationen.
Welches Beispiel wird im Migrationskontext gegeben?
Die Arbeit enthält ein Interviewbeispiel aus dem Migrationsdienst, das die praktische Anwendung des Empowerment-Konzepts in diesem Kontext illustriert und die Herausforderungen und Möglichkeiten der Selbstbemächtigung im Migrationskontext aufzeigt.
- Arbeit zitieren
- Alexander Thomas Kreutzer (Autor:in), 2011, Empowerment - Ein professionelles Handlungs- und Selbstermächtigungskonzept für ein Leben in Eigenregie. Ressourcenorientierte Blickwinkel in der pädagogischen Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188753