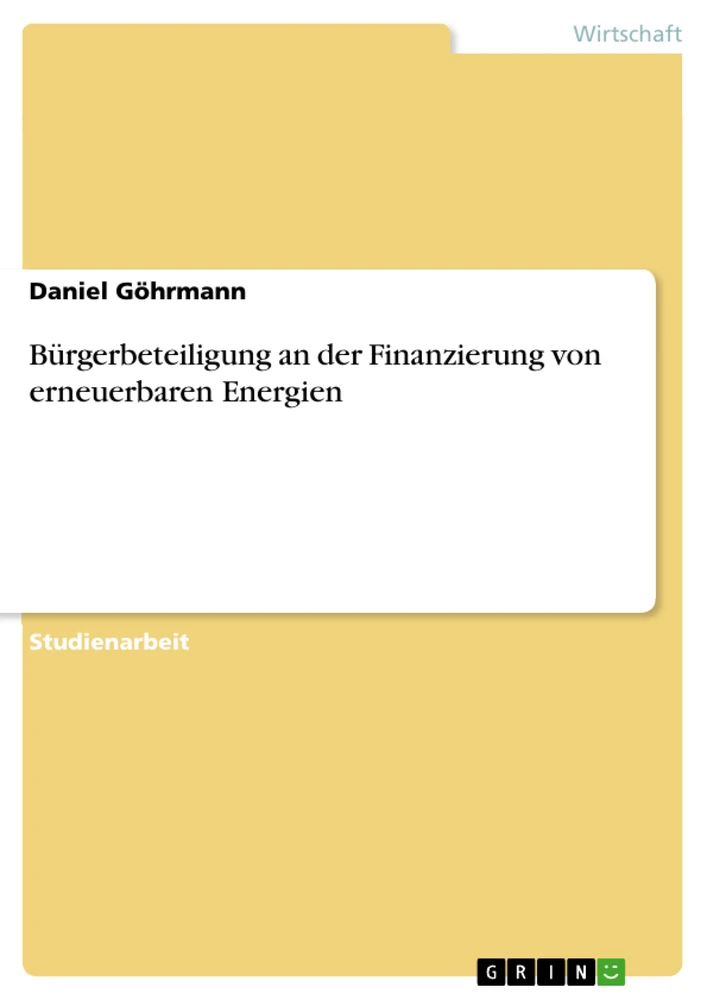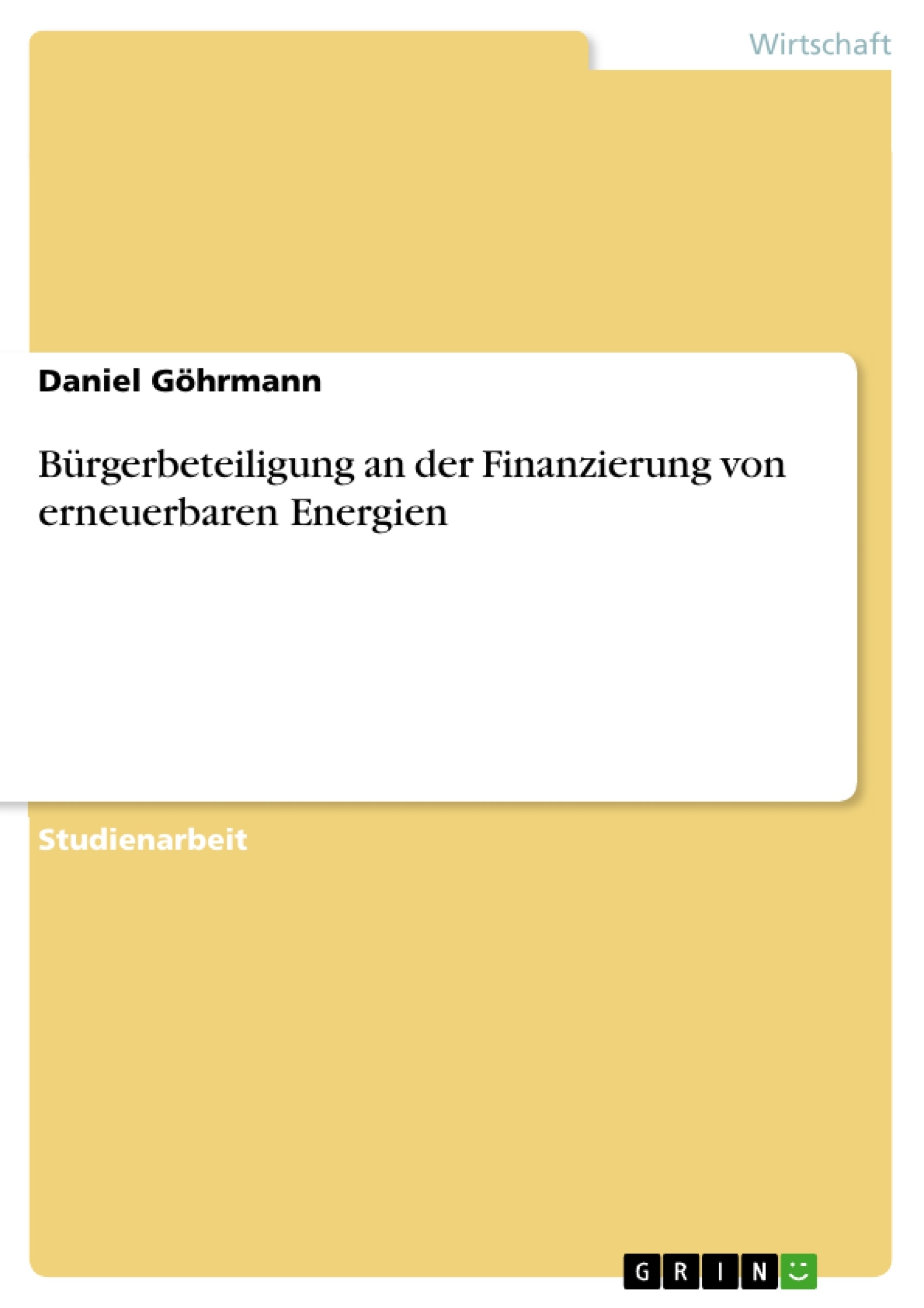Die erneuerbaren Energien werden immer beliebter und sollen insbesondere aus Klimaschutzgründen im Jahr 2020 fast die Hälfte des deutschen Strombedarfs decken. Mittlerweile ist die Nutzung erneuerbarer Energien durch eine breit gefächerte Akteursstruktur gekennzeichnet. Neben Unternehmen und Kommunen sind inzwischen immer mehr Privatpersonen zunehmend organisiert, Energie aus regenerativen Quellen zu schöpfen. Die Energiegewinnung ist bereits heute eine zu wichtige Angelegenheit. Daher bietet die Energiewende den Bürgern zunehmend Möglichkeiten sich bei der Finanzierung der Anlagen zu beteiligen, um die Akzeptanz für eine ökonomische, aber auch ökologische sinnvolle Energieerzeugung zu erhöhen. Ferner haben sich Geldanlagen in erneuerbare Energien derzeit als interessante Option für die Anleger entwickelt, die eine lukrative Alternative zu Tagesgeld oder Festgeld suchen, das momentan gerade mal 1,5 bis 2,7 % Zinsen erbringt.
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, einen groben Überblick über die verschiedensten Beteiligungsmodelle, vor allem für private Anleger im Bereich der erneuerbaren Energien aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Begriffliche Abgrenzungen
- Erneuerbare Energien
- Bürgerbeteiligung
- Bürgerbeteiligungsanlagen
- Bürgerbeteiligungsmodelle
- Entwicklung
- Finanzierungsformen
- Fondkonzepte
- offene und geschlossene Fonds
- Genossenschaft
- Genussscheine
- Direkte Anlageprodukte
- Sparbriefe
- Inhaberschuldverschreibungen
- Risiken der Finanzierungsformen
- Geschlossene Fonds
- Genossenschaft
- Genussscheine
- Sparbriefe
- Inhaberschuldverschreibungen
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Finanzierung von erneuerbaren Energien. Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Beteiligungsmodelle für private Anleger in diesem Bereich zu geben.
- Entwicklung und Bedeutung von Bürgerbeteiligungsmodellen im Bereich der erneuerbaren Energien
- Analyse verschiedener Finanzierungsformen für Bürgerbeteiligungsanlagen
- Bewertung der Risiken und Chancen der einzelnen Finanzierungsmodelle
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten
- Kritische Würdigung der Bedeutung und Herausforderungen der Bürgerbeteiligung im Kontext der Energiewende
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel werden wichtige Begriffe wie erneuerbare Energien, Bürgerbeteiligung und Bürgerbeteiligungsanlagen abgegrenzt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Bürgerbeteiligungsmodellen im Bereich der erneuerbaren Energien, wobei die Entwicklung und die einzelnen Finanzierungsformen im Fokus stehen. Das vierte Kapitel analysiert die Risiken der verschiedenen Finanzierungsformen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im fünften Kapitel kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Bürgerbeteiligung, erneuerbare Energien, Finanzierung, Energiewende, Finanzierungsformen, Risiken, Chancen, rechtliche Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten, Genossenschaften, Fondskonzepte, Sparbriefe, Inhaberschuldverschreibungen, Genussscheine.
- Arbeit zitieren
- Daniel Göhrmann (Autor:in), 2012, Bürgerbeteiligung an der Finanzierung von erneuerbaren Energien, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188747