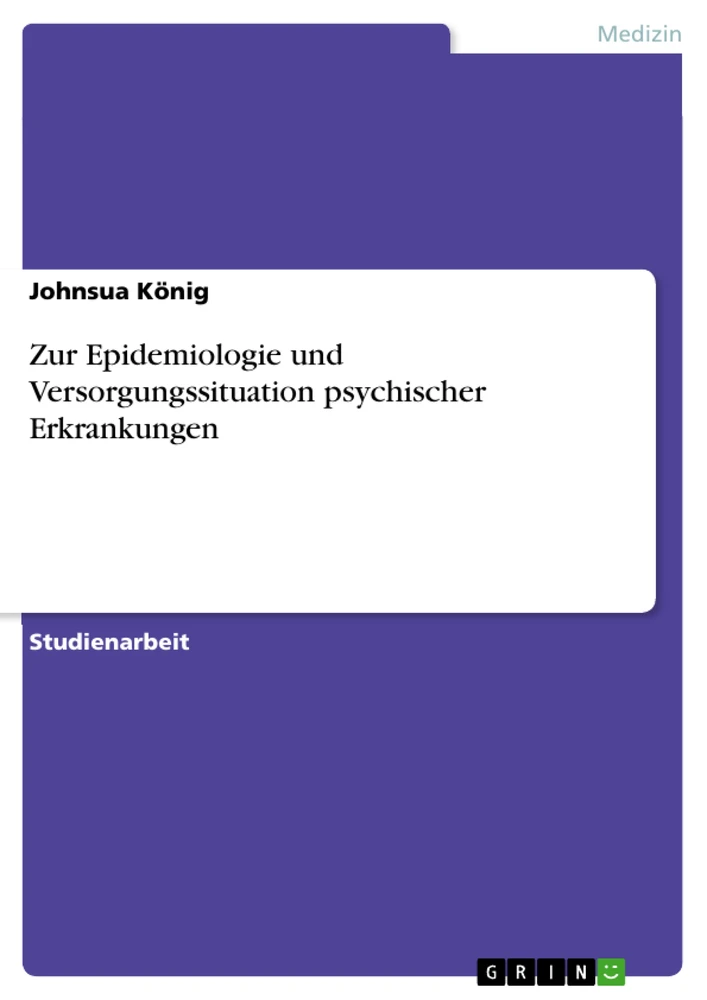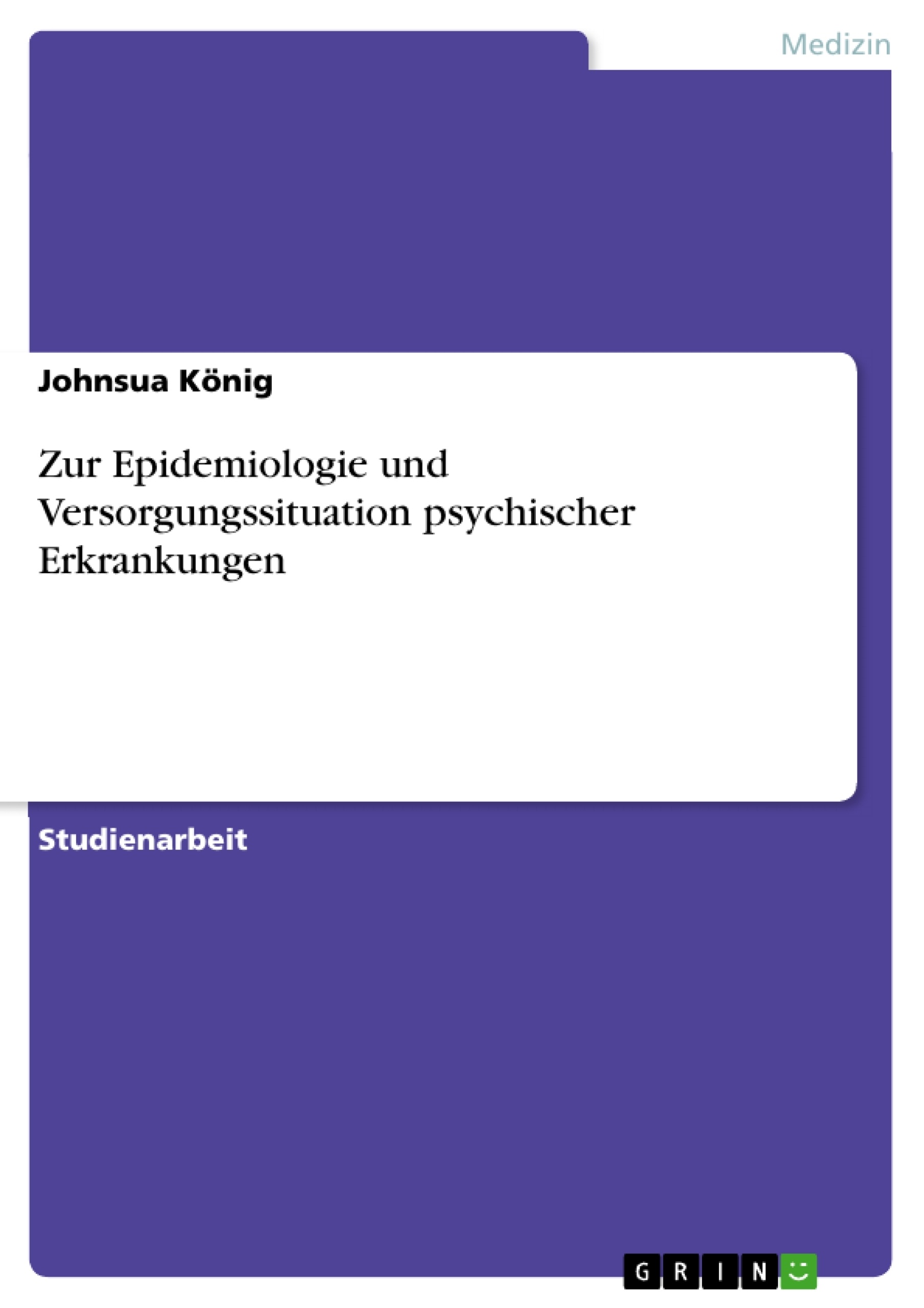Der Begriff Epidemiologie leitet sich aus der griechischen Sprache aus folgenden Teilen ab: „epi = über“, demos = das Volk“ und logos = die Lehre“. Somit bedeutet Epidemiologie so viel wie „die Lehre von dem, was über das Volk kommt“ oder „was im Volk verbreitet ist“. Die Epidemiologie versteht sich als eine Basiswissenschaft von Public Health, das global auf die Verbesserung der Gesundheitssituation in der Bevölkerung abzielt. Mit diesem positiven Vorhaben liefert die Epidemiologie wissenschaftliche Erkenntnisse zur Quantität und Distribution von Erkrankungen innerhalb der Bevölkerung. Darin erörtert die Epidemiologie die beeinflussenden Faktoren für die Entstehung, den Verlauf und die Folgen von Erkrankungen. Man unterscheidet zwischen der deskriptiven und der analytischen Epidemiologie. In der deskriptiven Epidemiologie stehen die Häufigkeit und die Verteilung einer Krankheit im Vordergrund. Zentrale Komponenten der deskriptiven Epidemiologie sind Zeit, Ort und Person. Die analytische Epidemiologie hingegen befasst sich konkret mit der Pathogenese sowie Ätiologie der Krankheiten. Hier gilt es, die hypothesengeleiteten Risikofaktoren einer Erkrankung in Bezug zu dem Auftreten der Erkrankung in der Bevölkerung zu setzen, denn die analytische Epidemiologie geht davon aus, dass Krankheiten nicht zufällig, sondern immer unter bestimmten Voraussetzungen auftreten. Selten wird die Epidemiologie auch in experimentellen Fällen eingesetzt, wenn es um besonders aussagekräftige Interventionsstudien geht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmung Epidemiologie und die Versorgungslage psychischer Erkrankungen im Gesundheitswesen der BRD
- 1.1 Epidemiologie
- 1.1.1 Definition der Epidemiologie
- 1.1.2 Aufgaben und Ziele der Epidemiologie
- 1.1.3 Methoden der Epidemiologie
- 1.2 Die gesundheitliche Bedeutung psychischer Erkrankungen
- 1.3 Die Versorgungslage psychischer Erkrankungen im Gesundheitswesen der BRD
- 2. Die Epidemiologie, Versorgungslage und Pflege von älteren Menschen in der BRD mit einer Demenz
- 2.1 Begriffsbestimmung Demenz
- 2.1.1 Definition Demenz
- 2.1.2 Die Formen der Demenz
- 2.2 Die Epidemiologie der Demenzerkrankungen
- 2.3 Die Versorgungssituation der Menschen mit einer Demenzerkrankung
- 2.3.1 Die aktuelle Versorgungslage in der BRD
- 2.3.2 Probleme und Ressourcen in der Versorgung
- 2.4 Herausforderungen an die Pflege
- 2.5 Das Versorgungskonzept „Pflegeoase“
- 3. Erkenntnisse aus der Arbeit und Ausblicke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Epidemiologie und Versorgungssituation psychischer Erkrankungen sowie der spezifischen Herausforderungen im Kontext von Demenzerkrankungen im deutschen Gesundheitswesen. Die Arbeit analysiert die Definition, Aufgaben und Methoden der Epidemiologie und setzt diese Erkenntnisse in Bezug zu den aktuellen Versorgungsstrukturen in der BRD. Darüber hinaus werden die spezifischen Herausforderungen der Demenzversorgung und die Bedeutung des Versorgungskonzepts „Pflegeoase“ untersucht.
- Epidemiologie psychischer Erkrankungen
- Versorgungssituation psychischer Erkrankungen in der BRD
- Epidemiologie und Versorgung von Menschen mit Demenz
- Herausforderungen in der Demenzpflege
- Das Versorgungskonzept „Pflegeoase“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff der Epidemiologie und erläutert deren Aufgaben und Methoden. Es wird die gesundheitliche Bedeutung psychischer Erkrankungen beleuchtet und die aktuelle Versorgungslage in Deutschland analysiert. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition, Epidemiologie und Versorgungssituation von Menschen mit Demenz in Deutschland. Es beleuchtet die aktuellen Versorgungsstrukturen, die Probleme und Ressourcen sowie die Herausforderungen für die Pflege. Darüber hinaus wird das Versorgungskonzept „Pflegeoase“ näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Epidemiologie, psychische Erkrankungen, Demenz, Gesundheitswesen, Versorgungssituation, Pflege, BRD, Versorgungskonzept, Pflegeoase.
- Arbeit zitieren
- Johnsua König (Autor:in), 2011, Zur Epidemiologie und Versorgungssituation psychischer Erkrankungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188293