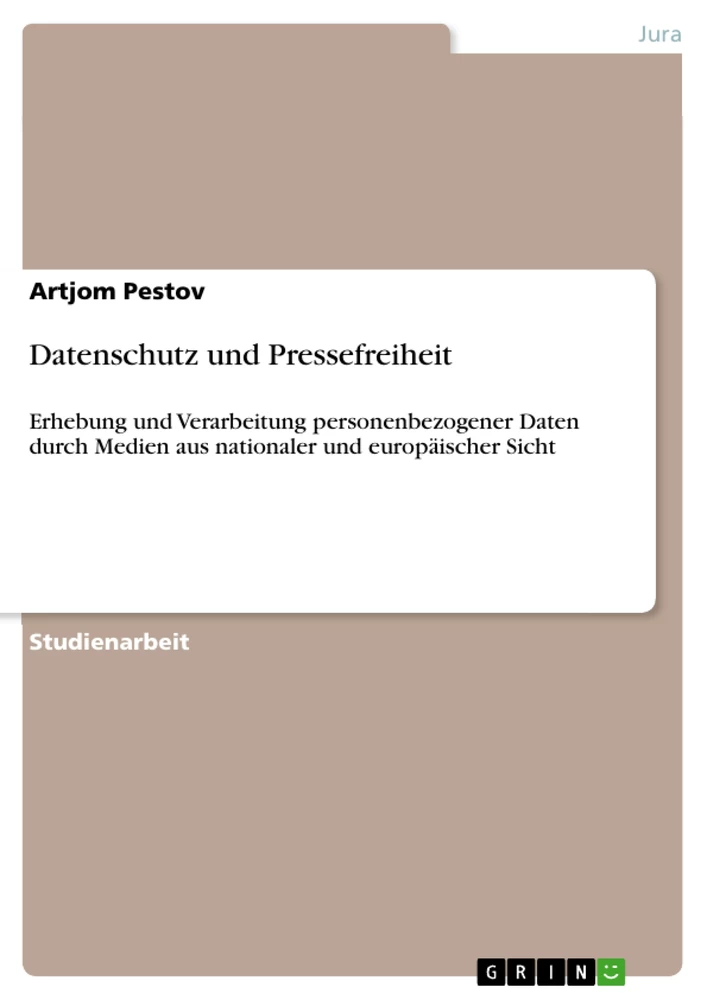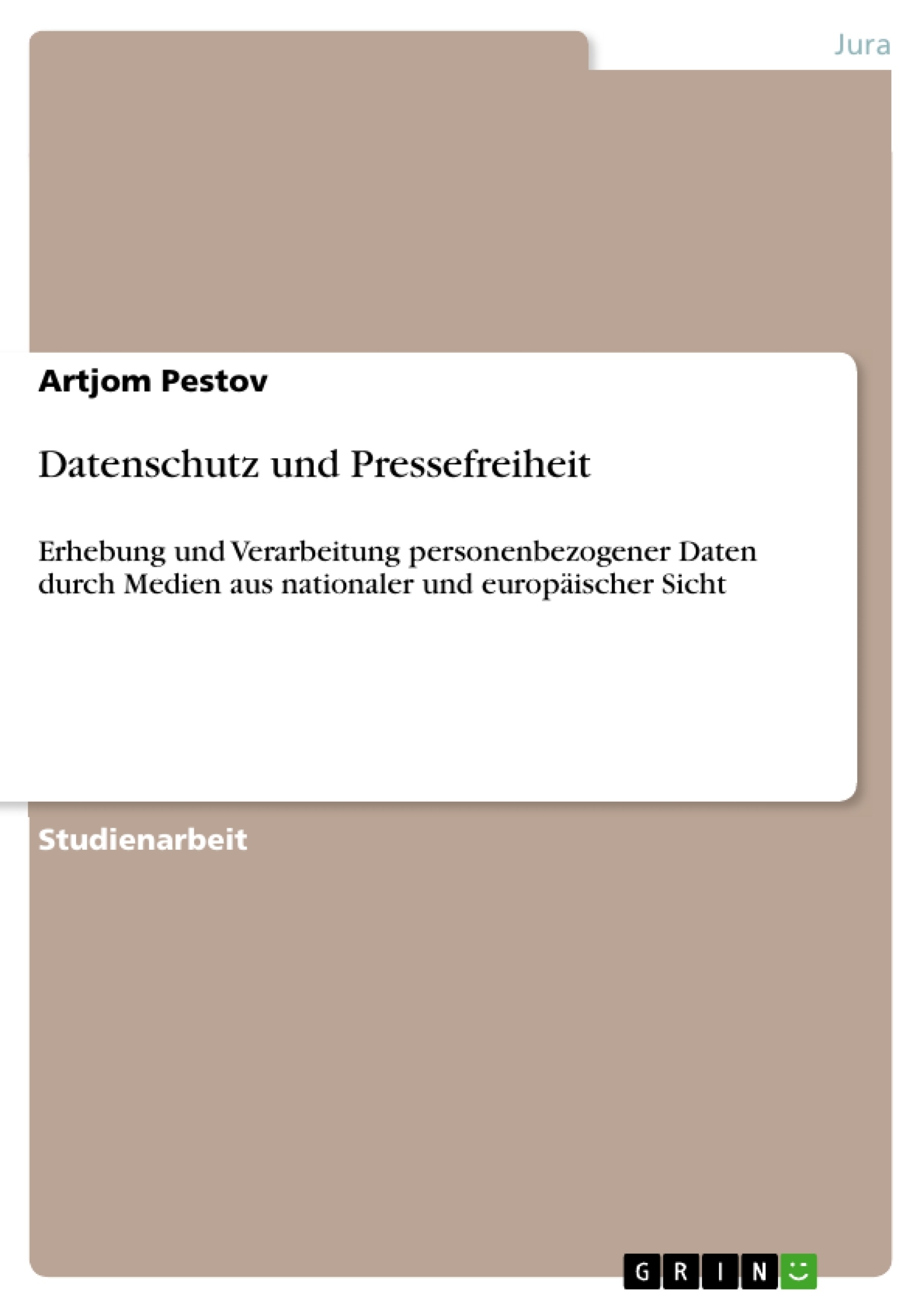Pressefreiheit und Datenschutz
Seit der Verabschiedung des ersten Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wurde das Verhältnis von Datenschutz und Pressefreiheit Gegenstand einer kontrovers geführten Diskussion. Zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Pressefreiheit besteht ein grundlegendes Spannungsverhältnis.
Art. 5 I 2 GG gewährleistet den Medien ein umfassendes Recht auf Beobachtung und Recherche. Von diesem Schutz umfasst sind auch die freie Verarbeitung und der Austausch der dabei erlangten Daten. Diese Gewährleistung kollidiert bei personenbezogenen Daten mit dem Interesse des Betroffenen, selbst über Preisgabe und Verwendung der persönlichen Daten zu bestimmen.
Ziel der Untersuchung
Ziel der Untersuchung ist, eine systematische Darstellung des Umfangs und der Grenzen der Pressefreiheit bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Medien. Dabei wird das Problem sowohl aus deutscher als auch europäischer Perspektive dargestellt. Insbesondere wird auf die neuen Entwicklungen der Rechtsprechung im Bereich der Online-Bewertungsplattformen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Pressefreiheit und Datenschutz.
- 1. Ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen Pressefreiheit und Datenschutz...
- 2. Die Wahrnehmung der Pressefreiheit erfordert Ausnahmen im Bereich Datenschutz....
- 3. Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie begründet zusätzlichen Handlungsbedarf des Gesetzgebers......
- 4. Konvergenz der Medien bringt zusätzliche Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich....
- 5. Ziel der Untersuchung....
- II. Datenschutz als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts..
- 1. Automatisierte Datenverarbeitung und ihre Gefahren...
- 2. Volkszählungsurteil des BVerfG: Verfassungsrechtliche Verankerung des Datenschutzes....
- 3. Regelungsbereich des BDSG...
- a) Personenbezogene Daten.
- b) Normadressaten...
- c) Präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, § 4 I BDSG..
- d) Präventive Ausrichtung des Datenschutzes....
- III.,,Medienprivileg“ des § 41 I BDSG als notwendige Voraussetzung freier Presse.
- 1. Journalistische Arbeit ist in erster Linie Datenverarbeitung..
- 2. Gefährdung des investigativen Journalismus.......
- 3.,,Medienprivileg“ des § 41 I BDSG ist verfassungsrechtlich geboten..
- 4. EG-Datenschutzrichtlinie und ihre Anforderungen..
- IV. Regulierung des Datenschutzes in der Presse..
- 1. Normative Säule.......
- a) Gesetzliche Regelung des „Presseprivilegs\".
- b) Regelungsumfang..
- 2. Selbstregulierungssäule..
- a) Freiwillige Selbstkontrolle..
- b) Regelungsumfang.......
- 3. Kritik an der Umsetzung der EG-DSRL..
- a) Bedenklichkeit der Selbstregulierung aus europäischer Sicht..
- b) Gegenauffassung: Ausreichende Schutz der Privatsphäre durch deutsche Gesetze.
- c) Stellungnahme...
- V. Reichweite des Medienprivilegs aus deutscher und europäischer Sicht..
- 1. Herausforderungen an die Auslegung...
- 2. Reichweite des Medienprivilegs in § 41 I BDSG aus deutscher Sicht – „Presse“ i. S. d. Art. 512 GG..
- a) Ausgangspunkt: Formaler Pressebegriff .....
- b) Schutz der Online-Publikationen im Art. 512 GG..
- c) Kriterien der Zuordnung zur Presse..
- d) Aktuelle Entwicklungen: Spickmich.de...
- f) Ergebnis: Reichweite des § 41 I BDSG aus deutscher Sicht..
- 3. Die Reichweite der Privilegierung aus europäischer Sicht...
- a) Auslegung anhand der Grundrechte der Gemeinschaft.
- b)Ausgleich zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Privatsphäre ist Sache der Rechtsanwender....
- c) Der weite Begriff des „Journalismus“.
- d)Bewertung und Stellungnahme…..\li>
- VI. Zusammenfassende Thesen......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Pressefreiheit und Datenschutz in Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch Medien. Sie untersucht, wie die Medienfreiheit im Kontext des Datenschutzes gewährleistet werden kann, insbesondere im digitalen Zeitalter.- Das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Pressefreiheit.
- Die Notwendigkeit von Ausnahmen im Datenschutz für die freie Arbeit der Medien.
- Die Bedeutung der EG-Datenschutzrichtlinie für den deutschen Gesetzgeber im Hinblick auf den Datenschutz im Medienbereich.
- Die Herausforderungen der Konvergenz der Medien für den Datenschutz und die Abgrenzung der Medienfreiheit.
- Die Reichweite des Medienprivilegs aus deutscher und europäischer Sicht, insbesondere in Bezug auf Online-Plattformen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet das grundlegende Spannungsverhältnis zwischen Pressefreiheit und Datenschutz und stellt die Notwendigkeit von Ausnahmen im Datenschutz für die freie Arbeit der Medien heraus.
- Das zweite Kapitel behandelt den Datenschutz als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und seine Verfassungsrechtliche Verankerung im Volkszählungsurteil des BVerfG.
- Im dritten Kapitel wird das Medienprivileg des § 41 I BDSG als notwendige Voraussetzung freier Presse behandelt.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Regulierung des Datenschutzes in der Presse durch Gesetzgebung und Selbstregulierung.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Reichweite des Medienprivilegs aus deutscher und europäischer Sicht, insbesondere in Bezug auf Online-Plattformen.
Schlüsselwörter
Pressefreiheit, Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Medienprivileg, EG-Datenschutzrichtlinie, Medienkonvergenz, Online-Plattformen, Online-Journalismus.- Quote paper
- Artjom Pestov (Author), 2010, Datenschutz und Pressefreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188252