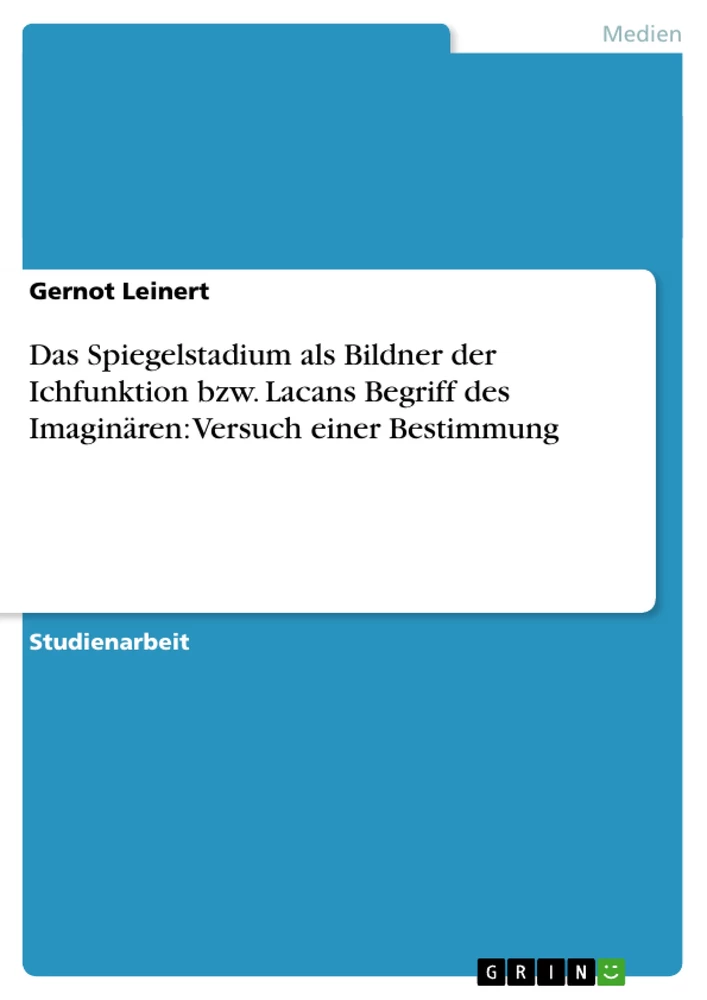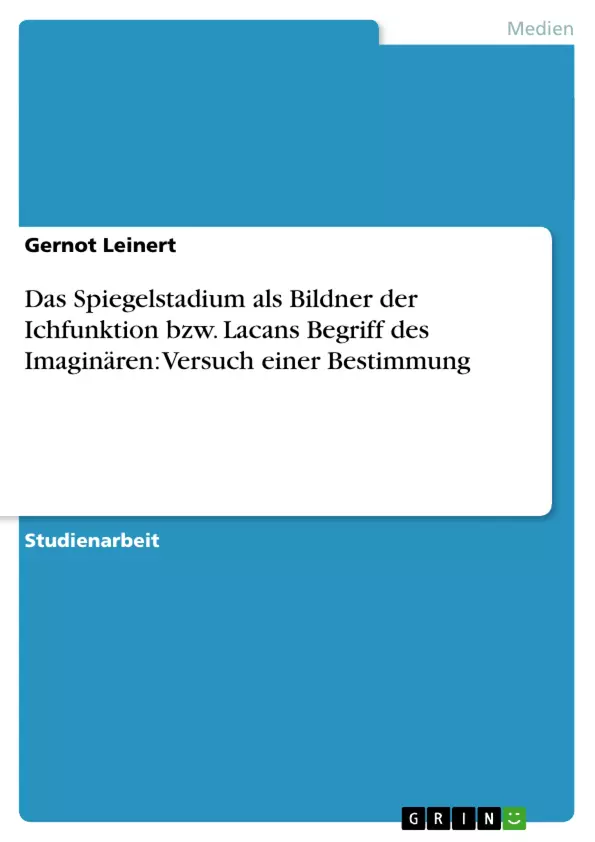Der 1936 auf dem 14. Internationalen psychoanalytischen Kongreß in Marienbad gehaltene Vortrag
„Das Spiegelstadium“ bzw. seine Ausarbeitung und Präzisierung und der erneute Vortrag 1949 auf
dem 16. Internationalen Kongreß in Zürich, nun unter den Titel „Das Spiegelstadium als Bildner der
Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint“, markiert nicht nur Lacans
Eintritt in die psychoanalytische Bewegung, sondern bildet auch den ersten großen Baustein von
Lacans Lehrgebäude und „definiert“ gleichermaßen Lacans spätere theoretische Entwicklung bis hin
zu seiner Begegnung mit dem Strukturalismus.
Damit kommt diesem Text eine Schlüsselstellung in der Beschäftigung mit Lacan zu, gleichzeitig aber
wird deutlich, welche Schwierigkeiten die Lektüre Lacans dem Leser macht. Zum einen ist hier
Lacans fast schon „poetisch-metaphorischer“ Sprach- und Schreibstil zu nennen, zum anderen ist es
sehr schwer möglich, einzelne Begriffe oder Konzepte Lacans darzustellen, ohne gleichzeitig Bezüge
zu Lacans Theoriegebäude im Ganzen zu ziehen.
Als Beispiel dafür hebt S.M. Weber in seinem Buch „Rückkehr zu Freud.“1 hervor, daß Lacans
Diskurs nicht auf die Darstellung der Wahrheit an sich abzielt, sondern vielmehr versucht, diese
Wahrheit auszusprechen. So versucht Lacan zum Beispiel seinen wichtigsten Diskursgegenstand,
nämlich das Unbewußte, nicht einfach zu beschreiben, sondern das Unbewußte soll in seinen Texten
selbst sprechen. Was so zunächst paradox anmutet, ist die konsequente Durchführung seines
Denkens, welches sich weigert, für einen Signifikanten eine starr definierte Verbindung zu einem
Signifikat zu bestimmen. Damit kann Lacan in seinen Texten inhaltliche, grammatikalische und
syntaktische Brüche bzw. die poetischen Figuren Metapher und Metonymie und begriffliche
Neuschöpfungen so gebrauchen, daß seine eigentliche Grundthese, nämlich daß der Prozeß der
Äußerung über der eigentlichen Aussage steht, als Subtext in seiner Theorie mitgeführt wird. Lacans
Sprach- und Schreibstil versucht so also die selben Mechanismen zu gebrauchen, die er seinem
Gegenstand, dem Unbewußten, zuschreibt. [...]
1 S.M. Weber: Rückkehr zu Freud, Frankfurt a. M. / Berlin/ Wien 1978
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freuds Konzeption des Narzißmus als Basis von Lacans Spiegelstadium
- Das Spiegelstadium und der Begriff des Imaginären
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat behandelt Jacques Lacans Konzept des Spiegelstadiums als bildner der Ichfunktion. Es befasst sich mit der Genese des Ichs und der damit verbundenen Prozesse der Identifizierung und Verkennung, wobei Freuds Konzeption des Narzißmus als Ausgangspunkt dient. Die Arbeit untersucht die Rolle des Imaginären in der Entstehung des Ichs und beleuchtet die Komplexität von Lacans Theoriegebäude, welches die Ordnung des Imaginären mit dem Symbolischen und dem Realen verknüpft.
- Das Spiegelstadium als Ausgangspunkt der Ich-Entwicklung
- Die Rolle des Imaginären in der Konstituierung des Ichs
- Freuds Narzißmustheorie als Grundlage für Lacans Spiegelstadium
- Die Dialektik zwischen Innenwelt und Umwelt in der Ich-Bildung
- Der Identifikationsmechanismus im Spiegelstadium und seine Bedeutung für die Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text behandelt Jacques Lacans Spiegelstadium und seinen Einfluss auf die Entwicklung der Ichfunktion. Es wird die Bedeutung des Textes für Lacans Gesamtlehre und die Schwierigkeiten bei seiner Lektüre hervorgehoben. Lacans Sprachstil wird als „poetisch-metaphorisch“ beschrieben, wobei er das Unbewußte nicht direkt beschreibt, sondern es durch die Struktur seines Textes sprechen lassen möchte.
Freuds Konzeption des Narzißmus als Basis von Lacans Spiegelstadium
Dieser Abschnitt erläutert die Beziehung zwischen Lacans Spiegelstadium und Freuds Konzeption des Narzißmus. Der Mythos von Narziß wird als Ausgangspunkt für die Analyse der Spiegelmetaphern verwendet. Die Verbindung von Sich-Erkennen und Verkennen, Faszination und Aggression sowie die Thematik von Identität und Begehren werden beleuchtet.
Das Spiegelstadium und der Begriff des Imaginären
Dieser Abschnitt definiert das Spiegelstadium als einen Identifikationsmechanismus, der die menschliche Entwicklung des Ichs und die Wahrnehmung prägt. Es wird die Rolle des Imaginären als Medium des entstandenen Subjekts im Spiegelstadium hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Spiegelstadium, Ichfunktion, Imaginäres, Symbolisches, Reales, Narzißmus, Identifizierung, Verkennung, Subjekt-Objekt-Beziehung, Freud, Lacan
- Arbeit zitieren
- Gernot Leinert (Autor:in), 1999, Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion bzw. Lacans Begriff des Imaginären: Versuch einer Bestimmung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18825