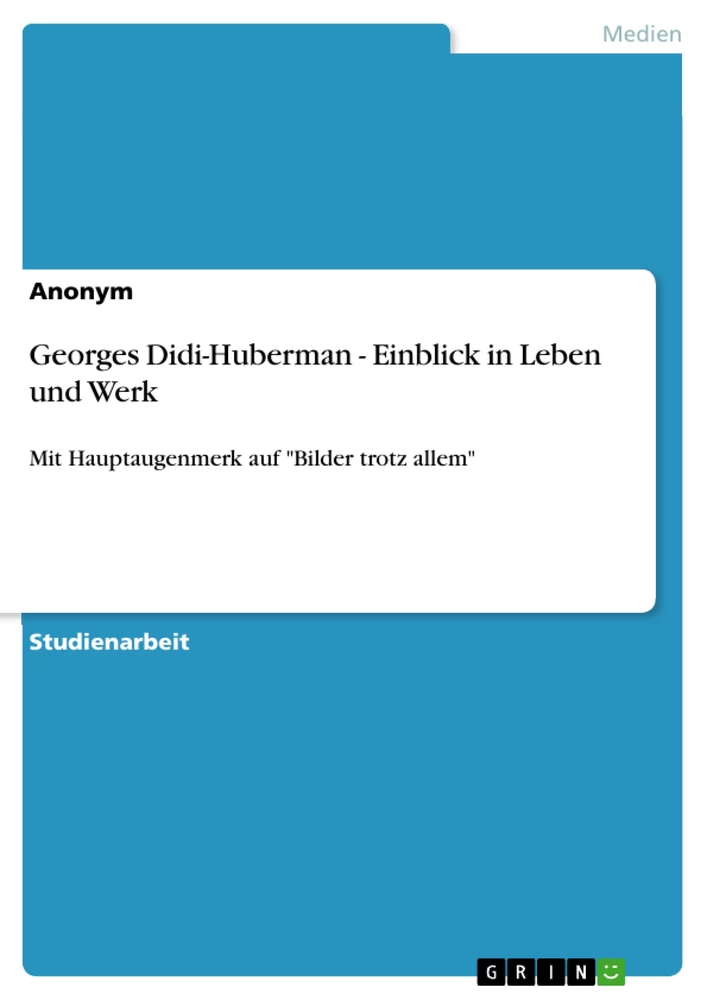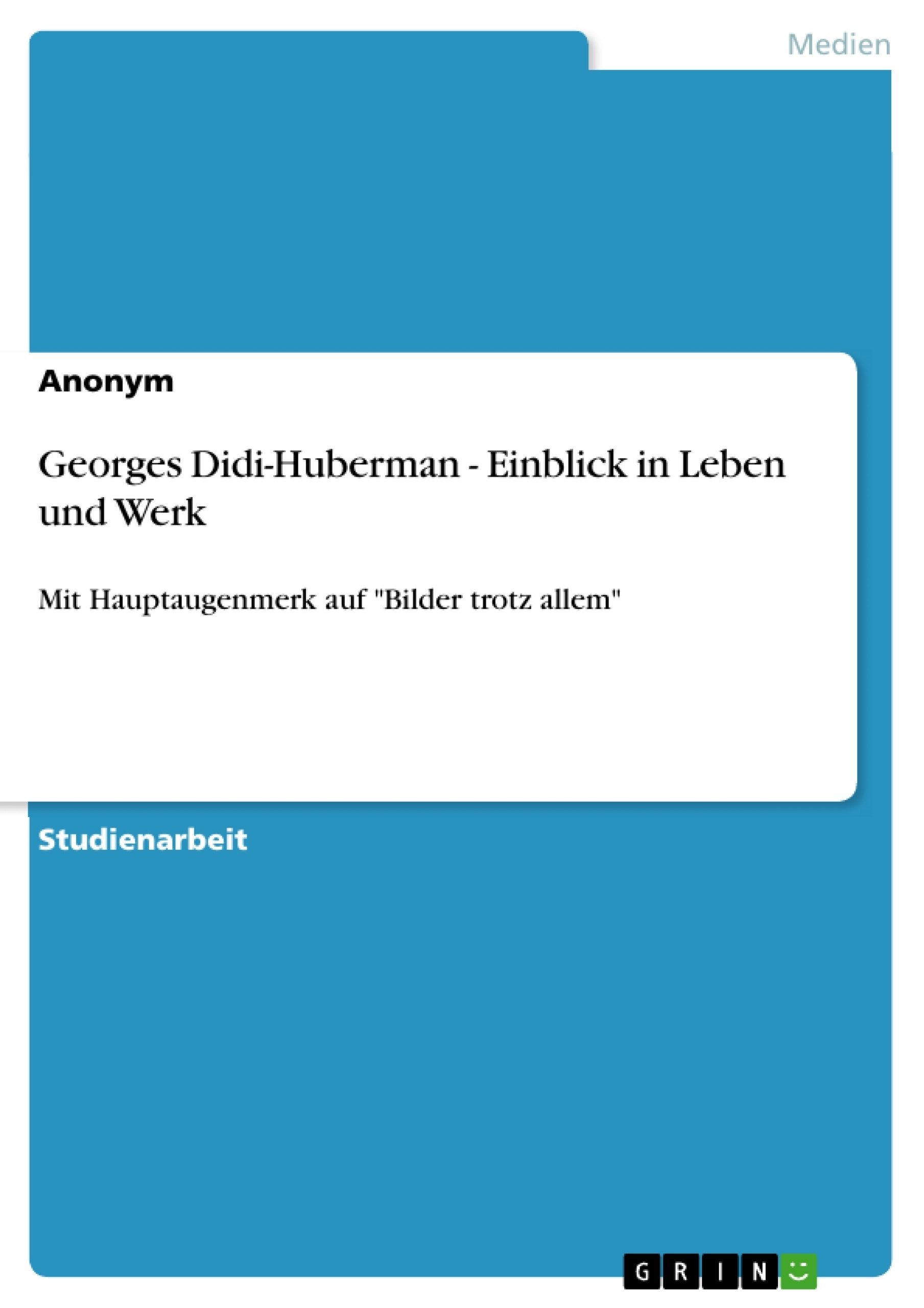„Man muss sich beeilen, wenn man etwas sehen will, alles verschwindet.“
[Paul Cezanne]
Es spielt keine Rolle, ob man sich eine Aufnahme von Personen, Landschaften, Gebäuden, Attraktionen oder Gegenständen wünscht – alles ist und bleibt in Bewegung.
Seit dem 19. Jahrundert war es möglich Augenblicke des Lebens
ohne weiteres mit einem neuen Abbildungsverfahren festzuhalten. Die Fotografie erlaubte es, ohne Menschenhand, ein Bild der Wirklichkeit zu fassen. Es war eine Sensation der damaligen Zeit, wenn auch nur Stillleben oder regungslose Menschen fotografiert werden konnten.
Im Laufe der Jahre wurde das Aufnahmematerial empfindlicher, wodurch man schnellere Bewegungen festhielt.
Immer mehr Wissenschaftler beschäftigten sich mit dem mechanischen
Abbildungsverfahren und dem Produkt der Fotografie. Daneben stand die Frage der Objektivität. Objektivität war seitens dieser mit Richtigkeit und Verlässlichkeit verbunden. In der heutigen Zeit ist dieses Thema sehr umstritten.
Auch Georges Didi-Huberman setzte sich mit der Fotografie auseinander. Die vorliegende Arbeit soll einen kurzen Einblick über das Leben und Werk des Didi-Huberman geben. Hauptaugenmerk soll dessen Werk „Bilder trotz allem“ sein. Bearbeitet wurden hierbei der erste Teil „Vier Stücke Film, der Hölle entrissen“ des ersten Kapitels „Bilder trotz allem“ und der erste Teil „Das Bild als Fakt, das Bild als Fetisch“ des zweiten Kapitels „Trotzdem kein Bild des Ganzen“. Die Frage der Objektivität wird mehrmals aufgegriffen – können Bilder beziehungsweise Abbildungen der Wirklichkeit die Realität wiedergeben? Dieser Frage soll Stück für Stück nachgegangen werden.
„Die Fotografie hilft den Menschen, zu sehen.“
[Berenice Abbott]
„Ohne Fotografie ist der Moment für immer verloren, so als ob es ihn nie gegeben hätte.“
[Richard Avedon]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leben und Wirken des Georges Didi-Huberman
- Bilder trotz allem
- Bilder trotz allem
- Erste Sequenz
- Zweite Sequenz
- Trotzdem kein Bild des Ganzen
- Das Bild als Fakt, das Bild als Fetisch
- Bilder trotz allem
- Über die Wirklichkeit der „l'imageant de l'image"
- Schlussbemerkung
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Werk „Bilder trotz allem“ des französischen Kunsthistorikers und Philosophen Georges Didi-Huberman. Ziel ist es, einen Einblick in das Leben und Werk des Autors zu geben und sich insbesondere mit dem ersten Teil des ersten Kapitels „Bilder trotz allem“ sowie dem ersten Teil des zweiten Kapitels „Trotzdem kein Bild des Ganzen“ auseinanderzusetzen. Die Arbeit analysiert die Fotografien aus dem Konzentrationslager Auschwitz und untersucht die Frage der Objektivität und der Fähigkeit von Bildern, die Realität wiederzugeben.
- Die Rolle der Fotografie in der Darstellung der Realität
- Die Objektivität von Bildern und die Frage der Interpretation
- Die Bedeutung von Bildern als Zeugnisse der Geschichte
- Die ethische Dimension der Darstellung von Gewalt und Leid
- Die Analyse von Bildern als Mittel zur Erschließung der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Fotografie und ihrer Rolle in der Darstellung der Realität ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Fotografie und die Frage der Objektivität. Anschließend wird der Fokus auf das Leben und Werk von Georges Didi-Huberman gelegt, wobei seine wichtigsten Publikationen und Forschungsprojekte vorgestellt werden.
Das Kapitel „Bilder trotz allem“ befasst sich mit den Fotografien aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Didi-Huberman analysiert die Bilder und untersucht die Bedingungen ihrer Entstehung sowie die ethischen Herausforderungen ihrer Betrachtung. Der erste Teil des Kapitels „Vier Stücke Film, der Hölle entrissen“ konzentriert sich auf vier Fotografien, die den Alltag im Lager dokumentieren. Didi-Huberman analysiert die Bilder detailliert und versucht, die Geschichte der abgebildeten Personen und Ereignisse zu rekonstruieren.
Der zweite Teil des Kapitels „Trotzdem kein Bild des Ganzen“ beschäftigt sich mit der Frage der Objektivität von Bildern. Didi-Huberman argumentiert, dass Bilder nicht einfach die Realität abbilden, sondern immer auch von der Perspektive des Betrachters geprägt sind. Er analysiert die Funktion von Bildern als „Fakten“ und als „Fetische“ und zeigt, wie Bilder sowohl zur Vermittlung von Wissen als auch zur Konstruktion von Ideologien beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fotografie, die Objektivität von Bildern, die Darstellung der Realität, die Geschichte des Holocaust, die Analyse von Bildern, die ethische Dimension der Bildbetrachtung, Georges Didi-Huberman, Auschwitz, Konzentrationslager, Sonderkommando, Primo Levi, „l'imageant de l'image“.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Georges Didi-Huberman - Einblick in Leben und Werk, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187830