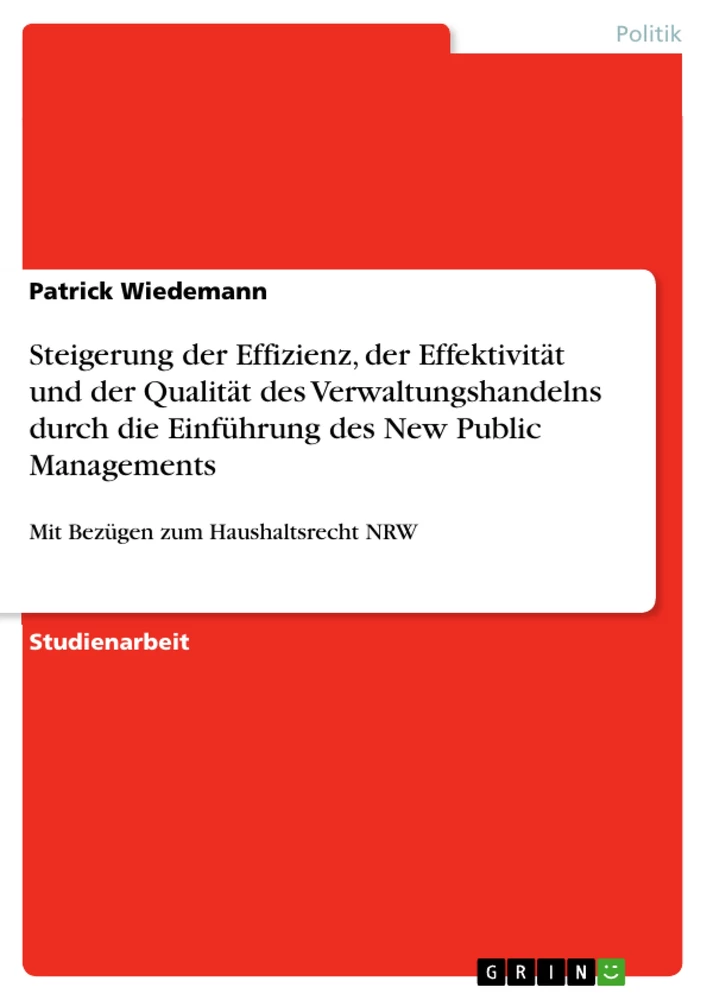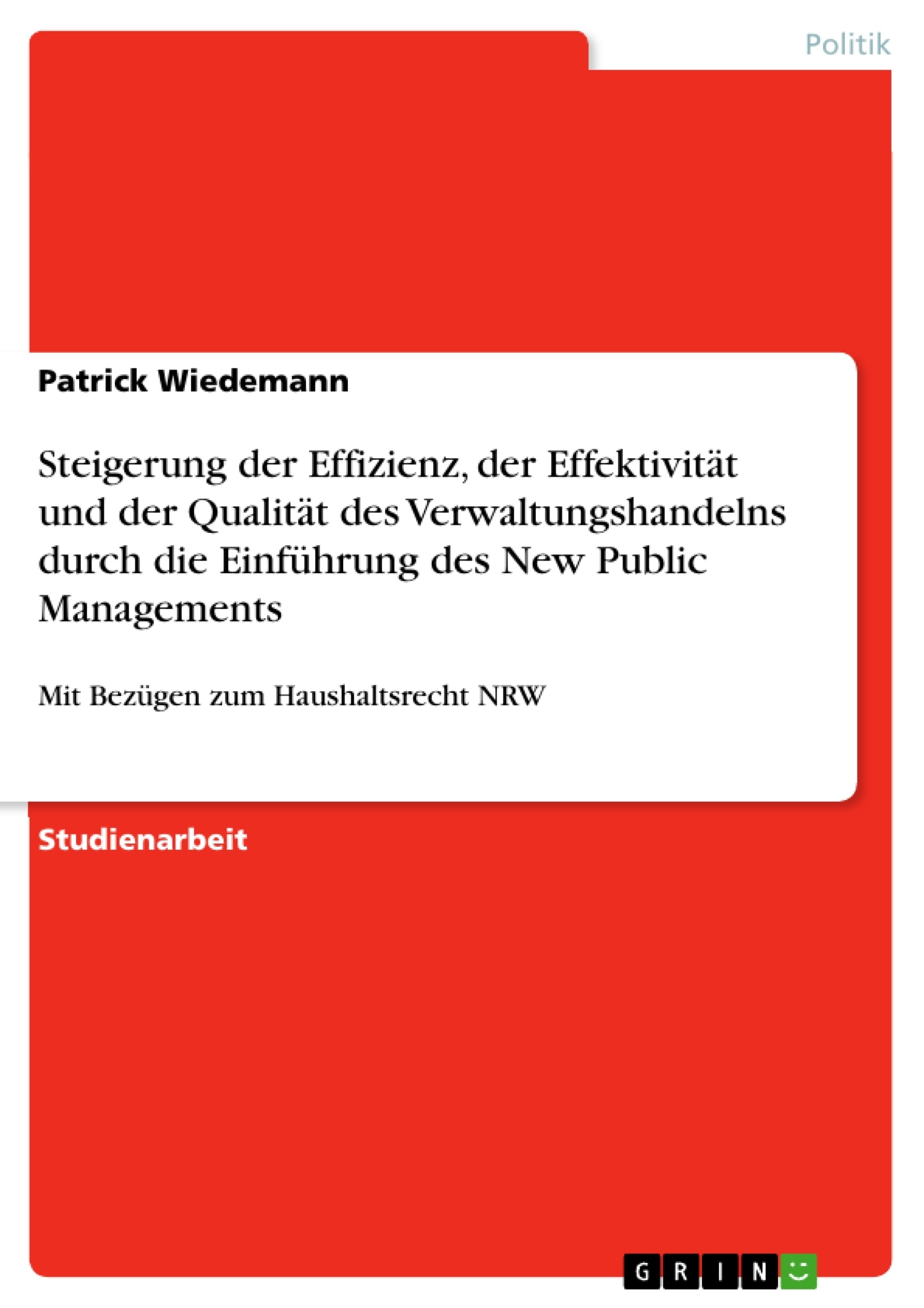Die Einführung des NPM in die öffentlichen Verwaltungen Europas soll zu einer Erhöhung der Effektivität, der Effizienz sowie der Qualität des Verwaltungshandelns führen.Der Grundstein zur Einführung des NPM wurde in der Stadt Tilburg gelegt, in welcher sich die Einführung und Weiterentwicklung in Gang gesetzt hat. Dort wurde bereits 1986 die Umstellung von der Kameralistik auf die doppische Buchführung (Doppik) vorgenommen.
In Deutschland ist diese Reformbewegung im öffentlichen Sektor eher unter der Bezeichnung des Neuen Steuerungsmodells (NSM) bekannt. Gerade in Bezug auf das öffentliche Rechnungswesen findet seit Anfang der 1990er Jahre ein „fundamentaler Umbruch“ in der BRD statt. „Generell geht es um eine Neuorientierung des Haushaltsund
Rechnungswesens öffentlicher Verwaltungen hin zu einem die tatsächlichen Verhältnisse erfassenden Ressourcenverbrauchskonzept einschließlich einer outputorientierten Budgetierung.“ Durch die Einführung des NSM in die öffentlichen Verwaltungen Deutschlands wurden erstmals in großem Umfang betriebswirtschaftliche Elemente in die öffentliche Verwaltung eingebracht wie bspw. Budgetierung, Controlling oder Kontraktmanagement. Dies erhöht die Transparenz in der Finanzierung der öffentlichen Verwaltung. Solche betriebswirtschaftlichen Elemente sind unter anderem
- die Verantwortungsabgrenzung zwischen dem Rat und der Verwaltung,
- das Kontraktmanagement,
- die dezentrale Ressourcenverantwortung sowie
- das Qualitätsmanagement.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich insbesondere auf die Steuerung über Zielvereinbarungen (z.B. in Form des Kontraktmanagements) sowie auf die dezentrale Ressourcenverantwortung
in Form von Globalbudgets. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung,
wie durch die Verknüpfung dieser Instrumente eine Erhöhung der Effektivität, der Effizienz sowie der Qualität des Verwaltungshandelns erreicht werden könnte. Abschließend
wird kritisch Stellung zur Umsetzung in der Praxis genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Steuern über Zielvereinbarungen
- Globalbudget
- Steigerung der Effizienz, der Effektivität und der Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente
- Umsetzung des NPM in der öffentlichen Verwaltungspraxis
- Anforderungen an die Verwaltungen zur Umsetzung des NPM
- Controlling- und Anreizsystem
- Entwicklungen bei der Einführung des NPM in die öffentlichen Verwaltungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz, Effektivität und Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung des New Public Management (NPM). Ziel ist es, die Auswirkungen betriebswirtschaftlicher Elemente auf die öffentliche Verwaltung zu analysieren und die praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung des NPM zu beleuchten.
- Einführung und Anwendung des New Public Management (NPM)
- Steuerung des Verwaltungshandelns durch Zielvereinbarungen und Globalbudgets
- Einfluss betriebswirtschaftlicher Elemente auf die Effizienz und Effektivität der öffentlichen Verwaltung
- Controlling- und Anreizsysteme im Kontext des NPM
- Herausforderungen und Entwicklungen bei der Implementierung von NPM in der öffentlichen Verwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Bedeutung der Effizienzsteigerung im öffentlichen Sektor. Sie erläutert den Zusammenhang zwischen New Public Management (NPM) und der Verbesserung des Verwaltungshandelns und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Steuern über Zielvereinbarungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Steuerung öffentlicher Verwaltungseinheiten mittels Zielvereinbarungen. Es analysiert die Vor- und Nachteile dieses Steuerungsinstruments und untersucht, wie Zielvereinbarungen zur Verbesserung von Effizienz und Effektivität beitragen können. Der Fokus liegt auf der konkreten Umsetzung und den Herausforderungen bei der Definition messbarer Ziele und der Kontrolle deren Erreichung.
Globalbudget: Das Kapitel Globalbudget beleuchtet die Auswirkungen von Globalbudgets auf die öffentliche Verwaltung. Es analysiert die Auswirkungen auf die Ressourcenallokation, die Entscheidungsfindungsprozesse und die Flexibilität der Verwaltung. Dabei werden die Vorteile eines solchen Systems, wie beispielsweise die Förderung von Eigenverantwortung, genauso untersucht wie die potenziellen Nachteile, etwa die Gefahr von Fehlallokationen oder die Beeinträchtigung der Qualität der Dienstleistungen. Es wird auf den Zusammenhang zwischen Globalbudgets und anderen NPM-Elementen, wie z.B. Zielvereinbarungen, eingegangen.
Steigerung der Effizienz, der Effektivität und der Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss betriebswirtschaftlicher Prinzipien und Methoden auf die öffentliche Verwaltung. Es analysiert, wie Konzepte wie Kostenrechnung, Performance-Messung und Qualitätsmanagement dazu beitragen können, die Effizienz, Effektivität und Qualität des Verwaltungshandelns zu steigern. Konkrete Beispiele aus der Praxis und deren Auswirkungen werden diskutiert.
Umsetzung des NPM in der öffentlichen Verwaltungspraxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung des NPM in öffentlichen Verwaltungen. Es analysiert die Anforderungen an die Verwaltung, die für eine erfolgreiche Implementierung notwendig sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einführung von Controlling- und Anreizsystemen, die die Motivation der Mitarbeiter fördern und gleichzeitig eine effiziente Steuerung ermöglichen sollen. Die Kapitel analysiert kritisch die Herausforderungen und Probleme, die bei der Umsetzung auftreten können.
Entwicklungen bei der Einführung des NPM in die öffentlichen Verwaltungen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Trends bei der Einführung des NPM in öffentlichen Verwaltungen. Es analysiert die Erfolge und Misserfolge bisheriger Implementierungsversuche und diskutiert zukünftige Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven. Der Fokus liegt auf den langfristigen Auswirkungen des NPM auf die Effizienz, Effektivität und Qualität der öffentlichen Verwaltung.
Schlüsselwörter
New Public Management (NPM), Effizienz, Effektivität, Qualität, öffentliche Verwaltung, Zielvereinbarungen, Globalbudget, Controlling, Anreizsysteme, betriebswirtschaftliche Elemente, Verwaltungsreform, Performance Measurement.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "New Public Management (NPM) in der öffentlichen Verwaltung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz, Effektivität und Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung des New Public Management (NPM). Sie analysiert die Auswirkungen betriebswirtschaftlicher Elemente auf die öffentliche Verwaltung und beleuchtet die praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung des NPM.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einführung und Anwendung des NPM, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Zielvereinbarungen und Globalbudgets, den Einfluss betriebswirtschaftlicher Elemente auf die Effizienz und Effektivität, Controlling- und Anreizsysteme im Kontext des NPM sowie die Herausforderungen und Entwicklungen bei der Implementierung von NPM in der öffentlichen Verwaltung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Steuern über Zielvereinbarungen, Globalbudget, Steigerung der Effizienz, der Effektivität und der Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente, Umsetzung des NPM in der öffentlichen Verwaltungspraxis (inkl. Anforderungen an Verwaltungen und Controlling- und Anreizsysteme) und Entwicklungen bei der Einführung des NPM in die öffentlichen Verwaltungen.
Wie werden Zielvereinbarungen im Kontext des NPM behandelt?
Das Kapitel zu Zielvereinbarungen analysiert die Vor- und Nachteile dieses Steuerungsinstruments und untersucht, wie es zur Verbesserung von Effizienz und Effektivität beitragen kann. Es konzentriert sich auf die konkrete Umsetzung und die Herausforderungen bei der Definition messbarer Ziele und der Kontrolle deren Erreichung.
Welche Rolle spielt das Globalbudget im NPM?
Das Kapitel zum Globalbudget beleuchtet die Auswirkungen von Globalbudgets auf die Ressourcenallokation, die Entscheidungsfindungsprozesse und die Flexibilität der Verwaltung. Es werden sowohl Vorteile (z.B. Förderung von Eigenverantwortung) als auch potenzielle Nachteile (z.B. Fehlallokationen, Beeinträchtigung der Dienstleistungsqualität) untersucht. Der Zusammenhang zu anderen NPM-Elementen wie Zielvereinbarungen wird ebenfalls behandelt.
Wie werden betriebswirtschaftliche Elemente im NPM eingesetzt?
Die Arbeit analysiert den Einfluss betriebswirtschaftlicher Prinzipien und Methoden wie Kostenrechnung, Performance-Messung und Qualitätsmanagement auf die Steigerung von Effizienz, Effektivität und Qualität des Verwaltungshandelns. Konkrete Praxisbeispiele und deren Auswirkungen werden diskutiert.
Welche Herausforderungen bei der NPM-Implementierung werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die Anforderungen an die Verwaltung für eine erfolgreiche NPM-Implementierung, insbesondere die Einführung von Controlling- und Anreizsystemen. Sie beleuchtet kritisch die Herausforderungen und Probleme, die bei der Umsetzung auftreten können.
Welche Entwicklungen im Bereich NPM werden dargestellt?
Das letzte Kapitel gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Trends bei der Einführung des NPM in öffentlichen Verwaltungen. Es analysiert Erfolge und Misserfolge und diskutiert zukünftige Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven, mit Fokus auf die langfristigen Auswirkungen auf Effizienz, Effektivität und Qualität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: New Public Management (NPM), Effizienz, Effektivität, Qualität, öffentliche Verwaltung, Zielvereinbarungen, Globalbudget, Controlling, Anreizsysteme, betriebswirtschaftliche Elemente, Verwaltungsreform, Performance Measurement.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Praktiker in der öffentlichen Verwaltung und alle, die sich für die Verbesserung der Effizienz und Effektivität der öffentlichen Verwaltung interessieren.
- Quote paper
- Patrick Wiedemann (Author), 2011, Steigerung der Effizienz, der Effektivität und der Qualität des Verwaltungshandelns durch die Einführung des New Public Managements, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/185084