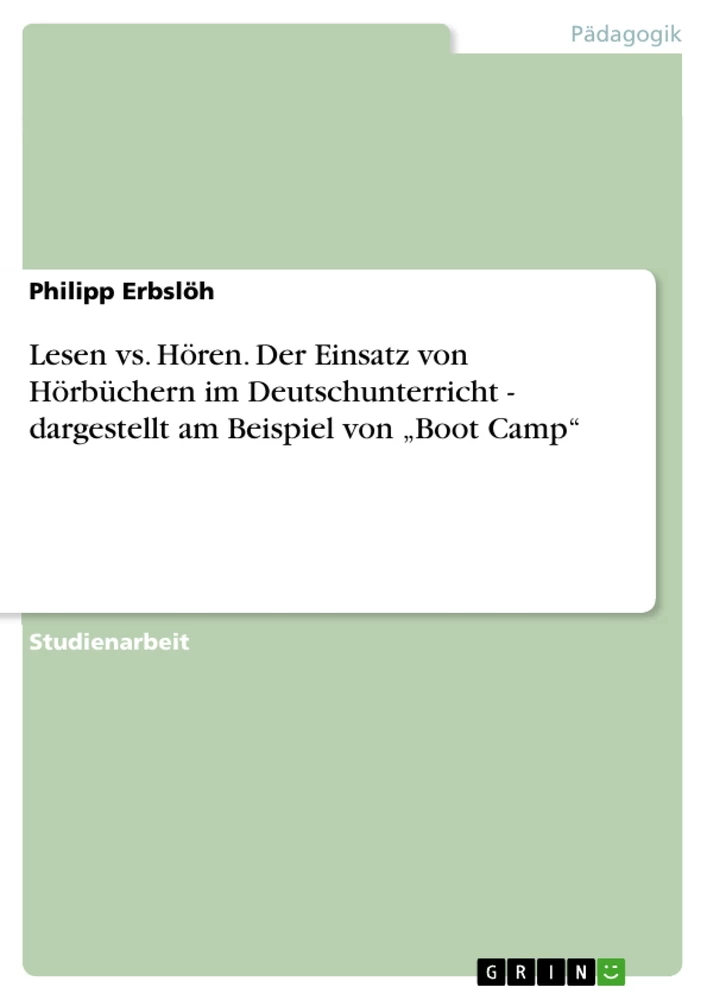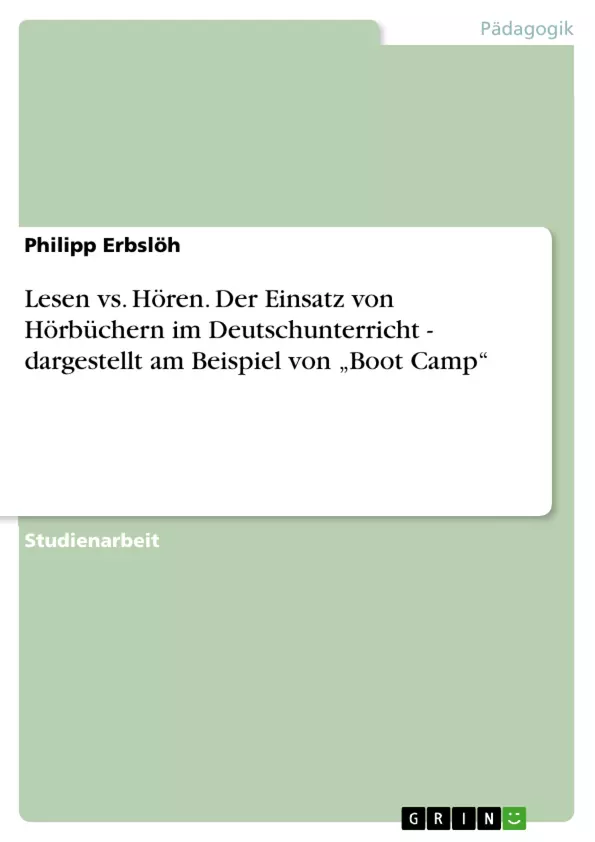Die vorliegende Arbeit untersucht die Unterschiede in der medialen Rezeption von Buch und Hörspiel aus fachdidaktischer Perspektive. Die Fachdidaktik des Deutschunterrichts für die Sekundarstufe I bildet somit den Hintergrund für die Untersuchung von Potential und Beschränkung der Medien Buch und Hörspiel im Deutschunterricht. Praktischer Untersuchungsgegenstand ist hierbei der Einsatz des Romans Bootcamp von Morton Rhue.1
Einführend wird hierzu zunächst der Begriff des Hörbuchs bestimmt und ein kurzer Abriss der Entwicklung gegeben, die zur Notwendigkeit der didaktischen Diskussion eines Nebeneinanders von Buch- und Hörbuch im Deutschunterricht führt. In einem folgenden Teil sollen die Grundlagen, auf denen die Beschäftigung mit Literatur im Deutschunterricht stattfindet zunächst vorgestellt werden. Nach einer Darstellung einer grundsätzlichen Hördidaktik im Rahmen des Deutschunterrichts, werden die beiden verortet im Kernlehrplan für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I.
Abschließend soll exemplarisch erarbeitet werden, in welcher Form während und nach dem Lesen einer Lektüre, des Romans Bootcamp von Morton Rhue, dieser Roman im Unterricht behandelt werden kann. Dem gegenübergestellt wird die Erarbeitung der Romanvorlage als Hörbuch, gelesen von Tom Niebuhr.2 Am konkreten Beispiel soll in diesem Teil der Arbeit untersucht werden, welches Potential die Rezeption eines Romans mit dem konkreten Medium Buch bzw. Hörmedium bietet: Was kann etwa ein Hörmedium durch seine mediale Beschaffenheit evozieren, das ein Buch nicht kann?
Ausgewählt wurde als zu untersuchende Unterrichtslektüre der Roman von Morton Rhue, da dieser die für die Behandlung als Ganzschrift im Unterricht typischen Merkmale aufweist – etwa die gesellschaftspolitischen Fragen, die von den Schülerinnen über den Plot hinaus bearbeitet werden können. Aber auch die frühe Hörbuchfassung des noch jungen Romans in deutscher Sprache spricht exemplarisch dafür, dass der Markt für den Kauf einer klassischen Schullektüre dieses Hörbuchangebot sehr frühzeitig herausgibt.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Das Hörbuch
- Eine Begriffsbestimmung
- Die zunehmende Konkurrenz zum Buch
- Didaktische Begründung für die Beschäftigung mit Literatur im Deutschunterricht
- Die literaturdidaktische Perspektive
- Die hördidaktische Perspektive
- Der Kernlehrplan
- Der Roman „Boot Camp“ als Unterrichtsgegenstand
- Die Methodik des Lesens
- Die Erarbeitung des Romans Boot Camp
- Die Methodik des Hörens
- Die Erarbeitung des Hörbuchs
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Unterschiede in der medialen Rezeption von Buch und Hörspiel aus fachdidaktischer Perspektive. Die Fachdidaktik des Deutschunterrichts für die Sekundarstufe I bildet somit den Hintergrund für die Untersuchung von Potential und Beschränkung der Medien Buch und Hörspiel im Deutschunterricht. Praktischer Untersuchungsgegenstand ist hierbei der Einsatz des Romans Bootcamp von Morton Rhue.
- Begriffsbestimmung des Hörbuchs und seine Entwicklung
- Didaktische Grundlagen der Beschäftigung mit Literatur im Deutschunterricht
- Verortung von Hörbuch und Buch im Kernlehrplan
- Exemplarische Erarbeitung des Romans Bootcamp als Lektüre und Hörbuch
- Potential und Beschränkungen von Buch und Hörbuch in der Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs "Hörbuch" und beleuchtet die zunehmende Konkurrenz zum traditionellen Buch. Anschließend werden die didaktischen Grundlagen für die Beschäftigung mit Literatur im Deutschunterricht erläutert, wobei sowohl die literaturdidaktische als auch die hördidaktische Perspektive betrachtet werden. Der Kernlehrplan für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I wird ebenfalls in den Kontext der Untersuchung einbezogen.
Im Hauptteil der Arbeit wird der Roman "Boot Camp" von Morton Rhue als exemplarischer Unterrichtsgegenstand vorgestellt. Die Methodik des Lesens und die Erarbeitung des Romans im Unterricht werden detailliert beschrieben. Anschließend wird die Erarbeitung des Hörbuchs "Boot Camp", gelesen von Tom Niebuhr, gegenübergestellt. Anhand dieses konkreten Beispiels werden die spezifischen Potenziale und Beschränkungen der Rezeption eines Romans mit dem Medium Buch bzw. Hörmedium untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Hörbuch, Buch, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Fachdidaktik, Medienrezeption, Literaturdidaktik, Hördidaktik, Kernlehrplan, Roman, "Boot Camp", Morton Rhue, Tom Niebuhr, Potential, Beschränkungen.
- Quote paper
- Philipp Erbslöh (Author), 2010, Lesen vs. Hören. Der Einsatz von Hörbüchern im Deutschunterricht - dargestellt am Beispiel von „Boot Camp“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/184350