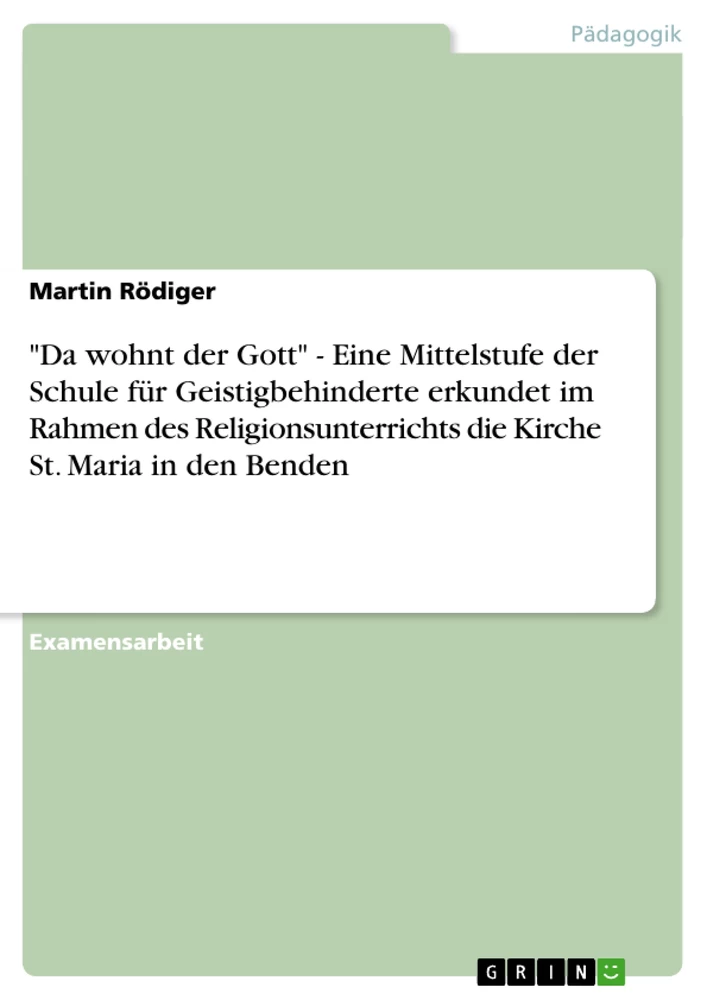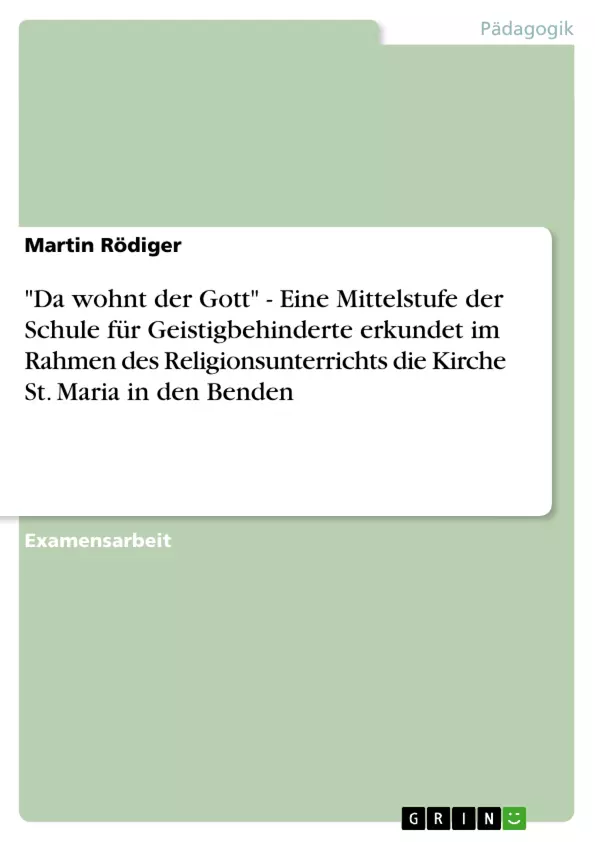Einleitung
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:
Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen!
Offb 21,3
1.1 Im Anfang war ein Wort …
„Da wohnt der Gott“. Mit diesen Worten kommentierte ein Schüler den Besuch der Kirche St. Maria in den Benden in Düsseldorf-Wersten. Er probte dort mit seiner Klasse, einer Mittelstufe der Schule für Geistigbehinderte, ein Krippenspiel für den Schulgottesdienst.
Seine Worte spiegeln nicht nur seine religiöse Sozialisation – er war in diesem Jahr Kommunionkind –, sondern geben auch etwas von der Ahnung wieder, die er von der Bedeutung dieses Raumes hatte. Er stellt sich damit unbewusst in die Tradition eines Gedankens, der sich durch die Geschichte der menschlichen Religiosität zieht: den Gedanken räumlicher Gottesnähe.
Antike Kultstätten befanden sich bevorzugt an exponierten Naturschauplätzen wie einem Berg oder einer Quelle. Es handelte sich um Orte, an denen sich wie im ersten Fall Himmel und Erde berühren oder wie im zweiten Fall das Wirken göttlicher Kräfte sichtbar wurde.
Diese Stätten wurden baulich markiert und zu Heiligen Bezirken ausgestaltet, an denen die Erscheinung Gottes festgehalten werden sollte. Ein Bauwerk wird so zum Zeichen der Gegenwart Gottes (vgl. RICHTER 22001c). Auch die Bibel kennt das Motiv des räumlichen
Wohnens Gottes. Beispielhaft seien hier die Bundeslade Israels oder der Tempelbau des Königs Salomo genannt. Als gläubiger Jude besuchte auch Jesus den Tempel, hebt aber dessen Bedeutung auf, indem er auf sich selbst als Tempel, als Wohnstätte Gottes hinweist
(Jo 2,19f.). Die Gemeinde bzw. die Kirche, die nach seinem Tod sein Gedächtnis bewahrt, wird ebenso wie er mit „Gottes Tempel“ identifiziert (1 Kor 3,16).
Wie aber verläuft die Verbindungslinie von der Hausgemeinschaft der Urgemeinde zu dem 1959 eingeweihten modernen Kirchenbau in Düsseldorf? Ein kurzer Blick in die Geschichte des christlichen Kirchenbaus macht deutlich, welche unterschiedlichen Konzepte jeweils mit dem Wort Kirche (von gr. Kyriakon – das dem Herrn gehörende [Haus] ) bezeichnet
wurden. Denn: „Selbstverständlich beeinflussen die Veränderungen im Gottes-, Menschenund Weltbild zwangsläufig auch das Verständnis des kirchlichen Raumes.“ (RICHTER 22001a, 10).*
[...]
_____
*Selbstverständlich können diese Schlaglichter dem komplexen Thema nicht gerecht werden. Sie dienen lediglich der Illustration der unterschiedlichen theologischen Konzepte und dem Nachweis einer Entwicklung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im Anfang war ein Wort ...
- Röhrigs Basiskomponenten
- Lehrerfunktionen
- Grundlegung
- Kirchenpädagogik
- Richtlinien
- Grundlagenplan
- Schulprogramm
- Die Lerngruppe und ihr Religionsunterricht
- Lernvoraussetzungen
- Vorbereitung der Kirchenerkundung im Unterricht
- Die Kirche St. Maria in den Benden
- Die Gemeinde
- Der Kirchenbau und sein theologisches Konzept
- Wir erkunden eine Kirche
- Rahmenbedingungen
- Methodisch-didaktische Überlegungen
- Ein Vormittag in der Kirche - geplantes Vorgehen
- Reflexion
- Anmerkungen zur Durchführung
- Highlights, Problemfelder und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer Erkundung der Kirche St. Maria in den Benden durch eine Mittelstufe der Schule für Geistigbehinderte im Rahmen des Religionsunterrichts. Sie untersucht die pädagogischen und theologischen Aspekte dieser Exkursion, wobei die Frage nach der räumlichen Gottesnähe im Zentrum steht.
- Theologisches Konzept des Kirchenbaus
- Räumliche Gottesnähe und ihre Vermittlung an Kinder
- Religionsunterricht mit geistigbehinderten Schülern
- Didaktische Ansätze und Methoden für die Kirchenerkundung
- Reflexion der Durchführung und der Lernerfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der räumlichen Gottesnähe ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Kirchenbaus. Dabei werden verschiedene Konzepte von Kirche als „Haus Gottes“ im Kontext religiöser Traditionen dargestellt.
Im Kapitel 2 werden die pädagogischen Grundlagen des Religionsunterrichts an der Schule für Geistigbehinderte beleuchtet, insbesondere Röhrigs Modell des subjektorientierten Religionsunterrichts.
Kapitel 3 fokussiert auf die Lerngruppe und ihre Voraussetzungen, sowie auf die Vorbereitung der Kirchenerkundung im Unterricht.
Kapitel 4 befasst sich mit der Kirche St. Maria in den Benden. Es werden die Gemeinde und die architektonische Gestaltung des Kirchenbaus im Kontext des theologischen Konzepts dargestellt.
Kapitel 5 beschreibt den Ablauf der Kirchenerkundung, die Rahmenbedingungen, die methodisch-didaktischen Überlegungen und die Planung des Vormittags in der Kirche.
Im letzten Kapitel 6 werden die Durchführung der Kirchenerkundung reflektiert, sowie Highlights, Problemfelder und Perspektiven für die zukünftige Gestaltung des Religionsunterrichts aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Räumliche Gottesnähe, Kirchenbau, Religionsunterricht, Schule für Geistigbehinderte, Kirchenpädagogik, subjektorientierter Religionsunterricht, Didaktik, Methodische Ansätze, Kirchenerkundung, Reflexion, Highlights, Problemfelder.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "räumliche Gottesnähe" im Religionsunterricht?
Es beschreibt die pädagogische und theologische Idee, dass Kirchengebäude als „Wohnstätten Gottes“ erfahren werden können, was besonders für Kinder eine greifbare Form des Glaubens darstellt.
Wie erkunden geistig behinderte Schüler eine Kirche?
Die Erkundung erfolgt subjektorientiert und handlungsorientiert, beispielsweise durch das Proben eines Krippenspiels oder das sinnliche Erfahren des Raumes.
Welches theologische Konzept hat die Kirche St. Maria in den Benden?
Der moderne Bau von 1959 in Düsseldorf-Wersten spiegelt zeitgenössische Konzepte des christlichen Kirchenbaus wider, die das Verhältnis von Gott, Mensch und Raum neu definieren.
Was ist subjektorientierter Religionsunterricht?
Ein Ansatz (nach Röhrig), der die individuellen Voraussetzungen und Erfahrungen der Schüler in den Mittelpunkt stellt, anstatt rein dogmatische Inhalte zu vermitteln.
Warum ist Kirchenpädagogik für Sonderschulen wichtig?
Sie ermöglicht es Schülern mit geistiger Behinderung, religiöse Symbole und Räume ohne Leistungsdruck und auf einer emotionalen Ebene zu entdecken.
- Quote paper
- Martin Rödiger (Author), 2003, "Da wohnt der Gott" - Eine Mittelstufe der Schule für Geistigbehinderte erkundet im Rahmen des Religionsunterrichts die Kirche St. Maria in den Benden, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18408