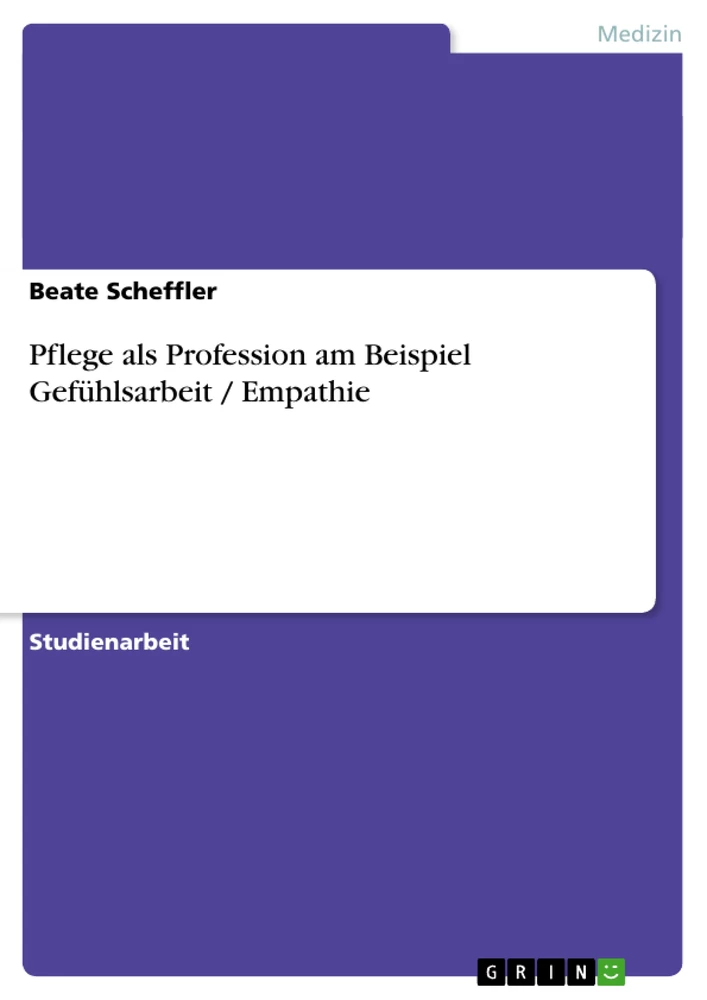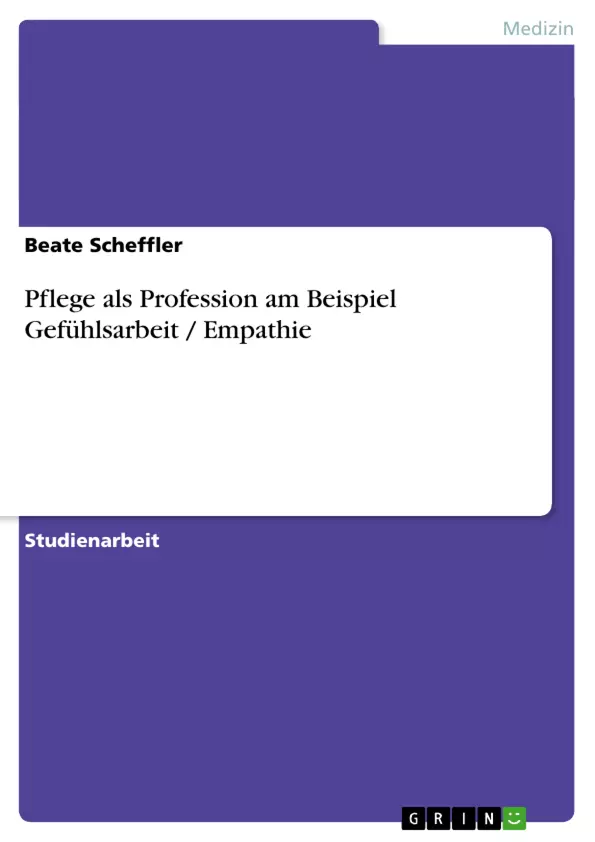Das Gesundheitswesen ist in den letzten Jahren immer stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Die lebhaften Diskussionen um Qualitätssicherung bei gleichzeitigem Zwang zur Kostensenkung werden von den Vertretern der Legislative, der Krankenkassen, der Träger von gemeinnützigen Einrichtungen, der Mediziner usw. geführt. Darüber hinaus ist durch bahnbrechende medizinischtechnische Entwicklungen die Möglichkeit für ethisch fragwürdige Eingriffe entstanden. Die Pflege nimmt - als zahlenmäßig stärkste Berufsgruppe im Gesundheitswesen - an dieser Diskussion nicht teil, obwohl sie u.a. bei der Entwicklung von Qualitätsstandards ihre vielfältigen Erfahrungen einbringen könnte.
Geht man der Frage nach, welche Ursachen für diese Zurückhaltung verantwortlich sein könnten, entdeckt man, dass die Pflege eine relativ machtlose Berufsgruppe darstellt, die hinzu noch einen geringen gesellschaftlichen Status hat. Die unbedingte Weisungsgebundenheit an ärztliche Anordnungen und der tägliche Umgang mit (in der Öffentlichkeit tabuisierten) Körperausscheidungen sind sicherlich zwei Gründe dafür.
Obwohl die Arbeit der Pflegenden - im Gegensatz zu den Medizinern - durch ständigen Kontakt zu den Patienten gekennzeichnet ist, fehlt ihnen die gesellschaftliche Anerkennung auf Expertentum. Dieser Anspruch wird von der Pflege selbst erhoben, doch der Nachweis steht noch aus. Der Bereich der Gefühlsarbeit hat in der Pflege einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund wird sich dieser Text mit dem Bereich der Gefühlsarbeit in der Pflege beschäftigen und unter dem Aspekt der Professionalität untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklung des Pflegeberufs
- Begriffsdefinition „Professionalisierung“
- Professionalisierung in der Pflege
- Erwartungen an Pflege
- Gefühlsarbeit im Pflegealltag
- Konzeptionelle Definitionen von Empathie
- Die historische Entwicklung des Begriffs „Empathie“
- Die kognitive Empathie
- Die kommunikative Empathie
- Die affektive Empathie
- Die Entwicklung des Empathiebegriffs in der Pflege
- Der Empathiebegriff nach Bischoff-Wanner
- Perspektivenübernahme als Prozessmodell nach Bischoff-Wanner
- Kritische Schlussbemerkungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Gefühlsarbeit in der Pflege und deren Bedeutung für die Professionalisierung des Berufs. Es wird die historische Entwicklung des Pflegeberufs beleuchtet und der Begriff der Empathie im Kontext der Pflegearbeit analysiert. Ziel ist es, den Stellenwert von Empathie und Gefühlsarbeit für die Qualität der Pflege zu verdeutlichen.
- Die historische Entwicklung des Pflegeberufs und die gesellschaftlichen Einflüsse
- Der Begriff der Professionalisierung im Kontext der Pflege
- Die Bedeutung von Gefühlsarbeit im Pflegealltag
- Konzeptionelle Definitionen und die Entwicklung des Empathiebegriffs
- Empathie als Prozessmodell und seine Relevanz für die Pflegepraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Text führt in die Thematik der Gefühlsarbeit in der Pflege ein und hebt die Bedeutung dieser Arbeit im Kontext der Professionalisierung hervor. Er betont die Diskrepanz zwischen der zahlenmäßigen Stärke der Pflege im Gesundheitswesen und ihrem geringen gesellschaftlichen Status und der damit verbundenen geringen Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen. Der Text kündigt die Auseinandersetzung mit Gefühlsarbeit und Empathie als zentrale Aspekte der Pflege an.
Die historische Entwicklung des Pflegeberufs: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des modernen Pflegeberufs im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Industrialisierung, dem Aufbau öffentlicher Gesundheitssysteme und dem Wandel in der Medizin. Es werden drei parallel verlaufende Entwicklungen (öffentliches Gesundheitssystem, Zerfall der Großfamilien, Wandel in der Medizin) als Gründe für den steigenden Bedarf an öffentlicher Pflege genannt. Der Mangel an Personal und die schwierigen Arbeitsbedingungen werden ebenso thematisiert wie der Gegensatz zwischen dem hohen Bedarf an qualifizierten Pflegekräften und deren geringer Bezahlung.
Schlüsselwörter
Pflege, Professionalisierung, Gefühlsarbeit, Empathie, historische Entwicklung, Gesundheitswesen, Qualitätssicherung, gesellschaftlicher Status, Bischoff-Wanner.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Gefühlsarbeit und Empathie in der Pflege
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich mit der Gefühlsarbeit in der Pflege und deren Bedeutung für die Professionalisierung des Berufs. Er analysiert die historische Entwicklung des Pflegeberufs und den Empathiebegriff im Kontext der Pflegearbeit, um den Stellenwert von Empathie und Gefühlsarbeit für die Qualität der Pflege zu verdeutlichen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung des Pflegeberufs, den Begriff der Professionalisierung in der Pflege, die Bedeutung von Gefühlsarbeit im Pflegealltag, konzeptionelle Definitionen und die Entwicklung des Empathiebegriffs, sowie Empathie als Prozessmodell und seine Relevanz für die Pflegepraxis. Ein besonderer Fokus liegt auf der Arbeit von Bischoff-Wanner zum Thema Empathie.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die historische Entwicklung des Pflegeberufs, Begriffsdefinition „Professionalisierung“, Erwartungen an Pflege, Gefühlsarbeit im Pflegealltag, Konzeptionelle Definitionen von Empathie (inkl. Unterkapiteln zur historischen Entwicklung, kognitiver, kommunikativer und affektiver Empathie), Die Entwicklung des Empathiebegriffs in der Pflege, Der Empathiebegriff nach Bischoff-Wanner, Perspektivenübernahme als Prozessmodell nach Bischoff-Wanner, Kritische Schlussbemerkungen und Fazit.
Wie wird die historische Entwicklung des Pflegeberufs dargestellt?
Das Kapitel zur historischen Entwicklung des Pflegeberufs beschreibt die Entstehung des modernen Pflegeberufs im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Industrialisierung, dem Aufbau öffentlicher Gesundheitssysteme und dem Wandel in der Medizin. Es werden drei parallel verlaufende Entwicklungen (öffentliches Gesundheitssystem, Zerfall der Großfamilien, Wandel in der Medizin) als Gründe für den steigenden Bedarf an öffentlicher Pflege genannt. Der Mangel an Personal, die schwierigen Arbeitsbedingungen und der Gegensatz zwischen dem hohen Bedarf an qualifizierten Pflegekräften und deren geringer Bezahlung werden ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung hat Empathie im Text?
Empathie ist ein zentrales Thema des Textes. Es werden verschiedene konzeptionelle Definitionen von Empathie vorgestellt (kognitive, kommunikative, affektive Empathie) und deren Entwicklung im Kontext der Pflege diskutiert. Besonders wird das Prozessmodell der Perspektivenübernahme nach Bischoff-Wanner behandelt und dessen Relevanz für die Pflegepraxis erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Pflege, Professionalisierung, Gefühlsarbeit, Empathie, historische Entwicklung, Gesundheitswesen, Qualitätssicherung, gesellschaftlicher Status, Bischoff-Wanner.
Was ist das Ziel des Textes?
Ziel des Textes ist es, den Stellenwert von Empathie und Gefühlsarbeit für die Qualität der Pflege zu verdeutlichen. Es soll die Bedeutung der Gefühlsarbeit für die Professionalisierung des Pflegeberufs hervorgehoben und die Diskrepanz zwischen der zahlenmäßigen Stärke der Pflege im Gesundheitswesen und ihrem gesellschaftlichen Status beleuchtet werden.
- Quote paper
- Beate Scheffler (Author), 2003, Pflege als Profession am Beispiel Gefühlsarbeit / Empathie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18344