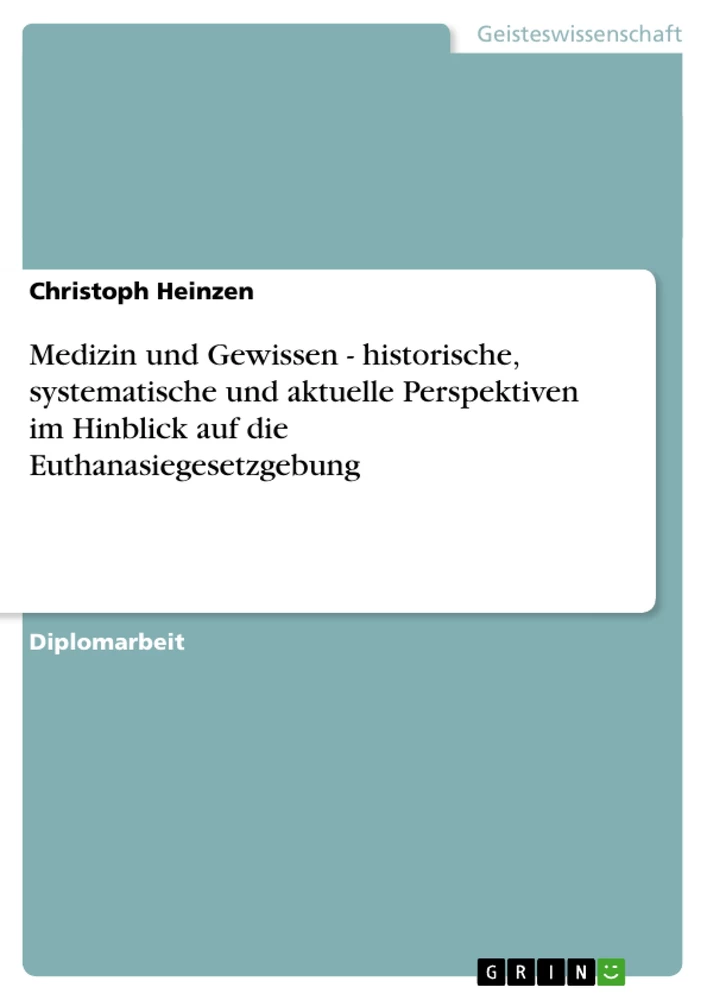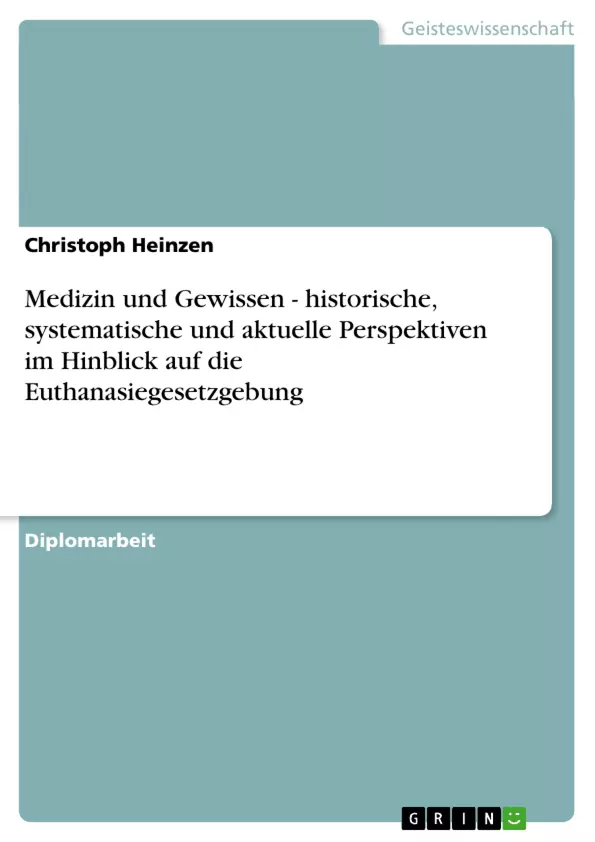Seitdem die zweite Kammer des niederländischen Parlaments am Karfreitag des Jahres 2001 den Gesetzentwurf der ehemaligen Gesundheitsministerin Els Borst über einen Strafausschließungsgrund bei der Lebensbeendigung durch den behandelnden Arzt verabschi-det hat, der am 01. April 2002 in Kraft getreten ist, finden weit über die Niederlanden und Deutschland hinaus erneut heftige Kontroversen über Wert und Unwert menschlichen Lebens, über die ethische Erlaubtheit der Tötung eines Sterbenskranken sowie die Notwendigkeit einer gesetzlichen Manifestation einer Regelung zur Euthanasie statt.
Die Kontrahenten der aktuellen niederländischen Rechtslage verweisen auf die drohende Gefahr eines Dammbruchs in der Euthanasiepraxis als auch auf eine wachsende Geringschätzung des menschlichen Daseins vom ersten Augenblick bis zum letzten Atemzug.
Die Befürworter bejubeln die innovative Regelung sowohl als Sieg des menschlichen Selbstbestimmungsrechts als auch eine weitere essentielle Etappe zu einer völligen Legalisierung.
Über ein halbes Jahrhundert nach den schrecklichen Euthanasie-Verbrechen der Nationalsozialisten sieht man in Deutschland die Entwicklungen im Nachbarland immer noch durch die Brille der Vergangenheit. Vereinzelte Stimmen lassen sich vernehmen, die eine Parallele zwischen den damaligen Untaten deutscher Ärzte und den gegenwärtigen Vorgängen in holländischen Krankenhäusern ziehen und die „Nazi-Analogie“ zu einem vielzitierten Schlagwort hochstilisiert haben.
In der vorliegenden Arbeit wird keine endgültige Evaluation dieses Vergleichs intendiert, sondern lediglich die durch ihn vorgegebenen Komponenten der Vergangenheit und Gegenwart verwendet, um auf der Basis der historischen Geschehnisse der NS-Zeit und der niederländischen Geschichte der letzten dreißig Jahre die Frage zu stellen, inwiefern dem aktuellen Euthanasiegesetz und der Handlungsweise deutscher Ärzte zur damaligen Epoche die identischen Prämissen zugrunde liegen, sowohl in Hinsicht auf eine systematische Ethik als auch auf eine bestimmte legislative Regulierung, aus der eine bestimmte Praxis erwächst.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Euthanasie im NS-Staat
- 1. Die ideologisch-systematischen Grundlagen des nationalsozialistischen Euthanasiegedankens
- 1.1. Der Sozialdarwinismus
- 1.2. Das Recht auf den Tod nach Adolf Jost
- 1.3. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens nach Binding und Hoche
- 1.3.1. Biographische Hintergründe
- 1.3.2. Karl Binding: Die Freigabe aus Sicht des Juristen
- 1.3.3. Alfred Hoche: Die Freigabe aus Sicht des Psychiaters
- 1.3.4. Die Reaktion der Mediziner auf die Thesen von Binding und Hoche
- 1.3.5. Die theologische Rezeption der Forderungen Bindings und Hoches
- 1.4. Zwischenresümee
- 2. Das Sterilisierungsgesetz von 1933 als Vorstufe zur Euthanasie-Aktion
- 2.1. Ärzte als Wegbereiter des Gesetzes
- 2.2. Das Sterilisierungsgesetz und seine praktischen Folgen
- 3. Die Kindereuthanasie
- 3.1. Der Fall „Kretschmar“ als Initialzündung für die Kindereuthanasie
- 3.2. Die Durchführung der Tötungsaktion an behinderten Kindern
- 3.3. Das Verhalten der Eltern
- 4. Die Erwachseneneuthanasie: Aktion T4
- 4.1. Die Vorbereitung der T4-Aktion
- 4.2. Das Ermächtigungsschreiben Hitlers und das Ringen um ein Euthanasiegesetz
- 4.3. Die praktische Durchführung der Tötung Geisteskranker
- 4.4. Probleme bei der Umsetzung
- 5. Die,,wilde Euthanasie”
- 6. Die Aktion „,14f13”
- 7. Grundlegende Fakten zum Nürnberger Ärzteprozess
- 8. Die Rolle der Kirchen im Kontext von Sterilisierung und Euthanasie
- 8.1. Reaktionen auf das Sterilisierungsgesetz
- 8.1.1. Die Enzyklika „,Casti connubii”
- 8.1.2. Der Protest der deutschen Bischöfe
- 8.1.3. Die Resonanz der evangelischen Kirche
- 8.2. Widerstände gegen die T4-Aktion
- 8.2.1. Die Reaktion Pius XII. und des Heiligen Offiziums
- 8.2.2. Formen des Widerstands im deutschen Episkopat
- 8.2.3. Der Protest Kardinal von Galens
- 8.2.4. Widerstand in der evangelischen Kirche
- 8.3. Zwischenresümee
- 8.1. Reaktionen auf das Sterilisierungsgesetz
- 1. Die ideologisch-systematischen Grundlagen des nationalsozialistischen Euthanasiegedankens
- III. Euthanasie in den Niederlanden
- 1. Der gesellschaftliche Hintergrund: Calvinismus, Toleranz, Duldung
- 2. Die historische Entwicklung der Euthanasiepraxis und -gesetzgebung in den Niederlanden
- 2.1. Euthanasie im niederländischen Strafgesetzbuch
- 2.2. Der erste Richterspruch im Jahre 1952
- 2.3. Die Thesen des Jan Hendrik van den Berg im Jahre 1969
- 2.4. Die siebziger Jahre: Der Fall Postma und seine Folgen
- 2.5. Die Entwicklung der Euthanasiedebatte in den achtziger Jahren
- 2.6. Empirische Studien in den neunziger Jahren
- 2.7. Das neue Meldeverfahren
- 2.8. Die weiteren Entwicklungen bis zum neuen Euthanasiegesetz
- 2.9. Zwischenresümee
- 3. Der Gesetzesvorschlag von 2000
- 3.1. Die Sorgfaltskriterien
- 3.2. Die Patientenverfügung
- 3.3. Die Regelung für Minderjährige
- 3.4. Die Ergänzung des Artikels 293 nl.StGB
- 3.5. Die Arbeit der regionalen Kontrollkommissionen
- 4. Die Evaluation des Gesetzentwurfs
- 4.1. Stimmen im Ausland
- 4.2. Das Selbstbestimmungsrecht
- 4.3. Das Dammbruchargument
- 4.4. Kritik an den Sorgfaltskriterien
- 4.5. Die regionalen Kontrollkommissionen
- 4.6. Die Euthanasie bei Minderjährigen
- 4.7. Die Rolle der Patientenverfügung
- 4.8. Zwischenresümee
- 5. Die christlich-kirchlichen Standpunkte
- 5.1. Die Enzyklika „Evangelium vitae”
- 5.2. Die Glaubenskongregation zur Euthanasie
- 5.3. Die Stellungnahmen der niederländischen Bischöfe
- 5.4. Weitere christliche Positionen in den Niederlanden sowie in Deutschland
- IV. Ärztliche Gewissensentscheidungen - gestern und heute
- 1. Die Bedeutung des Gewissens für das ärztliche Handeln
- 2. Die Formen des ärztlichen Widerstandes in der NS-Zeit
- 2.1. Prof. Gottfried Ewald
- 2.2. Dr. Hermann Grimme
- 2.3. Weitere Beispiele ärztlichen Widerspruchs
- 3. Die ärztlichen Lebenskontexte in der NS-Zeit und der Gegenwart
- 4. Die Problematik der Nazi-Analogie
- 4.1. Die Argumente der Analogie-Gegner
- 4.2. Resümee
- 5. Die Gründe für das Versagen des Gewissens bei den NS-Ärzten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der komplexen Thematik der Euthanasie, indem sie historische, systematische und aktuelle Perspektiven im Hinblick auf die Euthanasiegesetzgebung beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Euthanasiedebatte und die entsprechenden Gesetzgebungen in Deutschland und den Niederlanden, wobei sie besondere Aufmerksamkeit auf die Rolle des ärztlichen Gewissens im Kontext der Euthanasie lenkt.
- Die ideologischen und systematischen Grundlagen der Euthanasie im Nationalsozialismus
- Die historische Entwicklung der Euthanasiepraxis und -gesetzgebung in Deutschland und den Niederlanden
- Die Rolle des ärztlichen Gewissens im Kontext der Euthanasie und die ethischen Konflikte, die sich daraus ergeben
- Die aktuelle Euthanasiedebatte und die rechtlichen Rahmenbedingungen in beiden Ländern
- Der Vergleich der rechtlichen und ethischen Aspekte der Euthanasie in Deutschland und den Niederlanden
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II beschäftigt sich mit der Euthanasie im NS-Staat und beleuchtet die ideologischen und systematischen Grundlagen des nationalsozialistischen Euthanasiegedankens. Es werden die Rolle von Sozialdarwinismus und der Rechtstheorie von Adolf Jost sowie die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens durch Binding und Hoche untersucht. Kapitel II geht zudem auf das Sterilisierungsgesetz von 1933 als Vorstufe zur Euthanasie-Aktion sowie die Kindereuthanasie und die Aktion T4 ein. Die Rolle der Kirchen im Kontext von Sterilisierung und Euthanasie, insbesondere die Reaktionen auf das Sterilisierungsgesetz und die Widerstände gegen die T4-Aktion, werden ebenfalls analysiert. Kapitel III befasst sich mit der Euthanasie in den Niederlanden, indem es den gesellschaftlichen Hintergrund, die historische Entwicklung der Euthanasiepraxis und -gesetzgebung sowie den aktuellen Gesetzesvorschlag von 2000 beleuchtet. Die Evaluation des Gesetzentwurfs, die christlichen Standpunkte zur Euthanasie sowie die Rolle des ärztlichen Gewissens im niederländischen Kontext werden ebenfalls behandelt. Kapitel IV untersucht die ärztlichen Gewissensentscheidungen in Vergangenheit und Gegenwart, wobei es die Bedeutung des Gewissens für das ärztliche Handeln, die Formen des ärztlichen Widerstandes in der NS-Zeit sowie die Problematik der Nazi-Analogie behandelt. Es analysiert die Gründe für das Versagen des Gewissens bei den NS-Ärzten und die Unterschiede in den ärztlichen Lebenskontexten in der NS-Zeit und der Gegenwart.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Euthanasie, ärztliches Gewissen, Nazi-Zeit, Sterilisierung, Aktion T4, Recht auf den Tod, Lebensunwertes Leben, Sozialdarwinismus, christliche Ethik, Patientenverfügung, Selbstbestimmungsrecht, Dammbruchargument, Niederlande, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Grundlagen der NS-Euthanasie?
Die Grundlagen bildeten Sozialdarwinismus und die Ideologie des „lebensunwerten Lebens“, wie sie von Binding und Hoche propagiert wurde.
Was war die „Aktion T4“?
Eine systematische Massentötung von Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen während der Zeit des Nationalsozialismus.
Wie unterscheidet sich das niederländische Euthanasiegesetz von der NS-Praxis?
Das niederländische Gesetz basiert auf dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und strengen Sorgfaltskriterien, während die NS-Euthanasie staatlich verordnete Fremdtötung war.
Was ist das „Dammbruchargument“ in der Euthanasiedebatte?
Es beschreibt die Befürchtung, dass eine Legalisierung der Sterbehilfe zu einer schleichenden Ausweitung und Entwertung menschlichen Lebens führen könnte.
Welche Rolle spielte das ärztliche Gewissen im Nationalsozialismus?
Viele Ärzte stellten ihre medizinische Ethik in den Dienst der Ideologie, doch es gab auch vereinzelte Fälle von ärztlichem Widerstand gegen die Tötungsaktionen.
- Arbeit zitieren
- Christoph Heinzen (Autor:in), 2003, Medizin und Gewissen - historische, systematische und aktuelle Perspektiven im Hinblick auf die Euthanasiegesetzgebung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18303