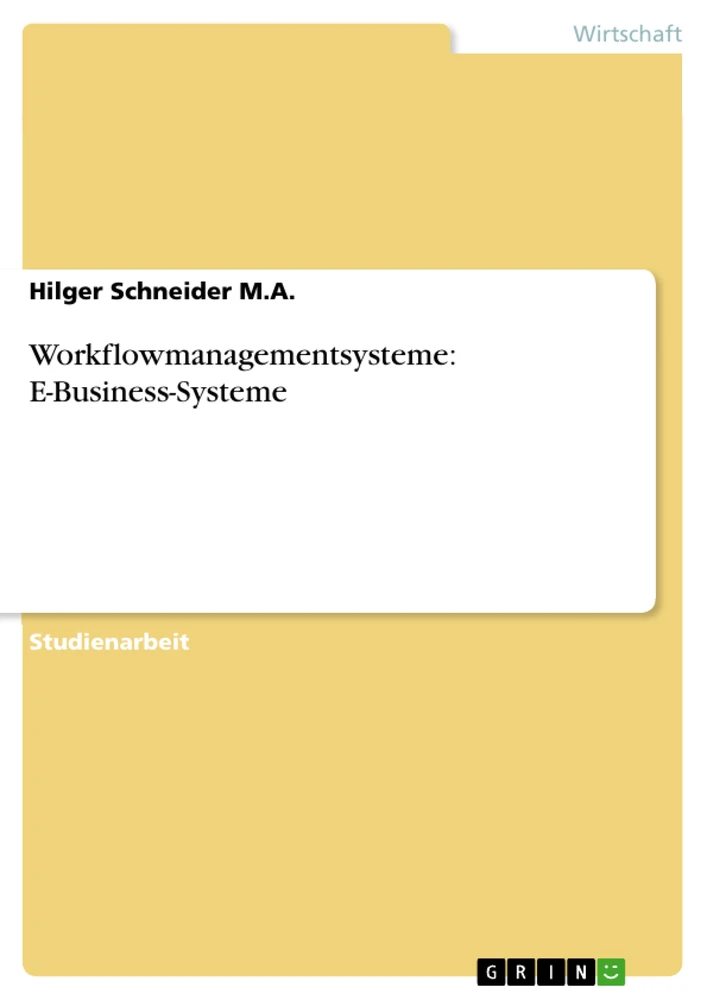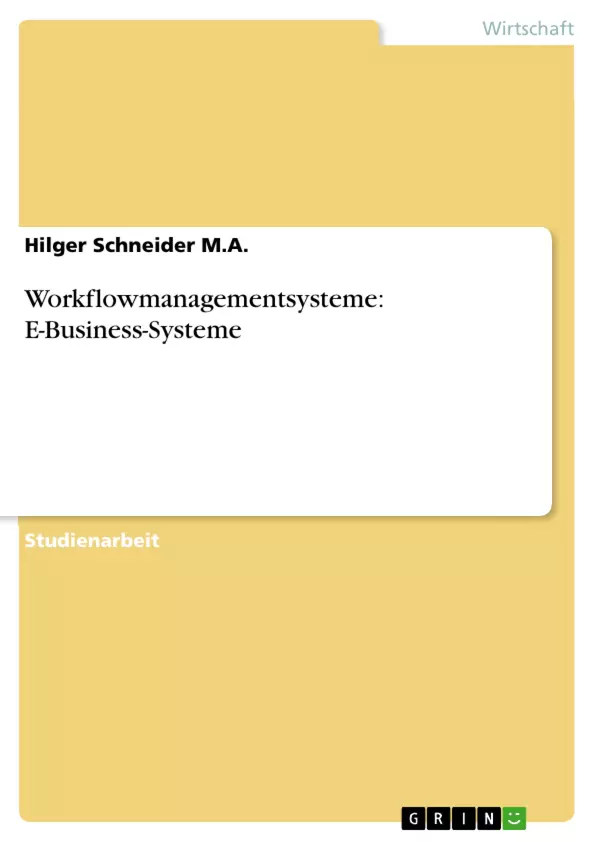Was ist Workflow und was bedeutet Workflow- Management?
Unter dem Begriff Workflow versteht man die alltäglichen Arbeitsabläufe in einem Unternehmen, die mit einem bestimmten Ziel und mehr oder weniger festen Regeln durchgeführt werden.
Ein Workflow- Management- System soll dann diese Abläufe rechentechnisch unterstützen und teilweise automatisieren.
Da sich die Arbeitsabläufe im Gegensatz zu den Programmen, die sie unterstützten sollen relativ schnell ändern, werden die Arbeitsabläufe in Workflow- Management- Systemen nicht direkt und unmittelbar durch Programme codiert, sondern sie werden in abstrakter Form beschrieben. Diese Beschreibungen (oft ebenfalls Workflow genannt) sind relativ leicht zu verändern und werden von einem Workflow- Management- System interpretiert und ausgeführt. In Notfall können Workflows sogar zur Laufzeit modifiziert werden.
Viele Sprachen zur Beschreibung von Workflows besitzen eine grafische intuitive Notation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung zwischen E-Commerce und E-Business
- Gründe für E-Business
- Gründe für E-Business aus Unternehmersicht
- Gründe für E-Business aus Endbenutzersicht
- Hemmende Faktoren im E-Business
- E-Business
- E-Business im Überblick
- Geschäftsmodelle
- Business to Business (B2B)
- Business to Consumer (B2C)
- Consumer to Consumer (C2C)
- Weitere Geschäftsmodelle
- Die 4 Kräfte des E-Business
- Entwicklungsstufen des E-Business
- Kapitelzusammenfassung
- E-Business Technologien
- EDI
- XML
- Middleware
- E-Business Marktplatzsoftware: MarketSite
- Definition Marktplatz
- Software MarketSite
- Electronic Payment-Systeme im E-Business
- Definition
- Klassifizierung von Payment-Systemen im E-Business
- Beispiel eines Payment-Systems
- Allgemeine Anforderung an Payment-Systeme im E-Business
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Workflow-Management-Systeme und deren Bedeutung im E-Business-Kontext. Ziel ist es, die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten dieser Systeme aufzuzeigen und deren Relevanz für die Optimierung von Geschäftsprozessen im digitalen Zeitalter zu beleuchten.
- Abgrenzung zwischen E-Commerce und E-Business
- Gründe für den Einsatz von E-Business
- E-Business-Technologien und deren Bedeutung
- Geschäftsmodelle im E-Business
- Payment-Systeme im E-Business
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Workflow-Management-Systeme ein und erläutert deren Funktion und Bedeutung im Unternehmenskontext. Im Anschluss wird die Abgrenzung zwischen E-Commerce und E-Business vorgenommen und die wichtigsten Gründe für den Einsatz von E-Business aus Sicht von Unternehmen und Endkunden dargelegt.
Kapitel 4 befasst sich mit den verschiedenen Geschäftsmodellen im E-Business, wobei die Schwerpunkte auf B2B, B2C und C2C liegen. In Kapitel 5 werden verschiedene E-Business-Technologien, wie EDI und XML, vorgestellt. In Kapitel 6 wird die Software MarketSite als Beispiel für eine E-Business-Marktplatzsoftware erläutert. Schließlich widmet sich Kapitel 7 den Electronic Payment-Systemen im E-Business und beschreibt deren Funktionsweise und Klassifizierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Workflow-Management, E-Business, E-Commerce, Geschäftsmodelle, Technologien, MarketPlace, Payment-Systeme.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Oec. Hilger Schneider M.A. (Autor:in), 2004, Workflowmanagementsysteme: E-Business-Systeme, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/182119