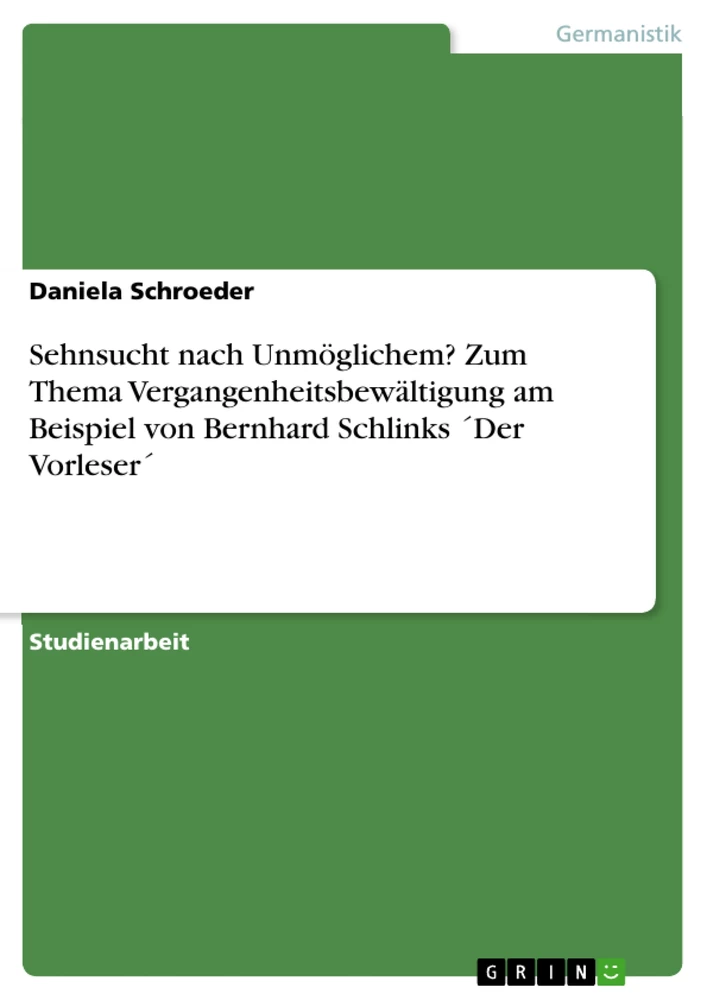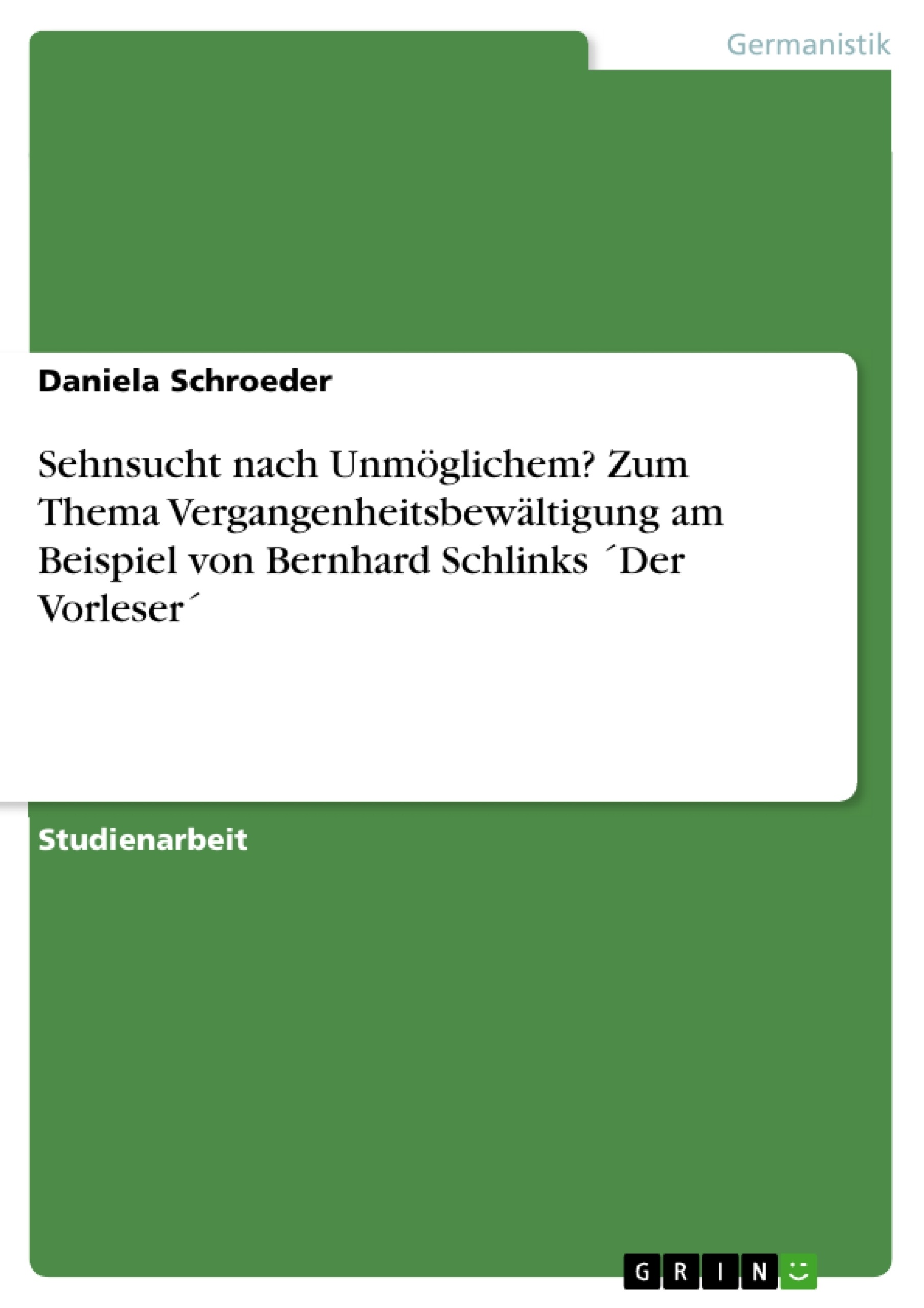Als eines der Leitthemen in der deutschen Nachkriegsliteratur sticht die faschistische Vergangenheit Deutschlands hervor. [...]
Schon die Tatsache, dass darüber in einem solchen Ausmass geschrieben wird, dass diese Bücher von einem Millionenpublikum im In- und Ausland gelesen werden, zeugt von der Aktualität des Themas, von dem Einfluss, den die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands auf die heutige Generation ausübt. Die Frage nach der Schuld belegt, wie sehr die Deutschen noch mitten in ihr stecken, wie stark sie sich über ihre Vergangenheit definieren.
Im Laufe der Jahrzehnte setzte die Literatur an verschiedensten Aspekten des Themas Schuldfrage und Vergangenheitsbewältigung an. Direkt nach dem Krieg, Ende der 40er Jahre, erschienen viele Landser-Romane, die Soldatentum und Kriegführung glorifizierten. Im scharfen Kontrast dazu schilderten Überlebende des Holocaust das schreckliche Geschehen im Nationalsozialismus. In den 50er und 60er Jahren wurde die faschistische Vergangenheit Deutschlands literarisch kaum thematisiert. Die beiden grossen ,,Ws" - Wiederaufbau und Wirtschaftswunder - beschäftigten die Nation zu sehr, um über die jüngste Geschichte nachdenken zu wollen. ,,Auf zu neuen Ufern!" hiess das Motto; die Schrecken der Nazizeit - und in vielen Fällen auch der eigene Anteil daran - sollten den Aufbau eines neuen Lebens nicht belasten. In den 60er bis 80ern erschien viel wissenschaftliche Literatur über den Holocaust selbst. Anfang der 80er Jahre schliesslich begannen sich die nachgeborenen Generationen mit der Schuld der Älteren auseinanderzusetzen. In Väter-Biografien wurde oft schonungslos mit dem Verhalten der Elterngeneration - sei es als Täter oder als Mitläufer - während des Krieges abgerechnet.
Bernhard Schlinks ,,Der Vorleser", der sich mit dem Umgang der zweiten Generation mit der Schuld der älteren Generation beschäftigt, lenkt den Blick auf eine neue Perspektive. Er behandelt die Frage, wie die Generation des Autors, geboren in den Kriegsjahren, und die Generation danach mit dem Holocaust und der Partizipation ihrer Rollenvorbilder darin umgehen können, welchen Einfluss die Schuld der Eltern und Grosseltern auf ihr eigenes Leben hat. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, dieses ,,Wie" zu definieren, sowie die Art und Möglichkeit der Vergangenheitsbewältigung, wie sie in ,,Der Vorleser" exemplifiziert wird, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schuldfrage und Kollektivschuld
- 2.1. Karl Jaspers „Die Schuldfrage“
- 2.2. Daniel Goldhagens „Hitler's Willing Executioners“
- 2.3. Schuld aus philosophisch-psychologischer Sicht
- 2.3.1. Die Entscheidungsfreiheit
- 2.3.2. Folgen der Schuld für das Individuum
- 2.4. Das Moment des Unvermeidlichen
- 3. Zur Schuldfrage in „Der Vorleser“
- 3.1. Hannas Schuld
- 3.1.1. Mögliche Gründe für Hannas Verbrechen
- 3.1.2. Hannas Umgang mit ihrer Schuld
- 3.1.3. Folgen der Umgangsweise Hannas mit ihrer Schuld
- 3.1.4. Hannas Analphabetismus in bezug auf ihre Schuld
- 3.1.5. Bedeutung der Literatur für Hannas Schuld
- 3.2. Michaels Schuld gegenüber Hanna
- 4. Generationenkonflikt und Mythos der „Gnade der späten Geburt“
- 5. Vergangenheitsbewältigung - „Sehnsucht nach Unmöglichem“?
- 6. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ im Kontext der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Sie analysiert, wie der Roman die Schuldfrage – sowohl individuell als auch kollektiv – aufgreift und die Auseinandersetzung der Nachkriegsgenerationen mit dem Holocaust darstellt. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Schuld und Verantwortung, dem Generationenkonflikt und der Frage nach der Möglichkeit einer erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung.
- Die Darstellung von Schuld und Verantwortung in „Der Vorleser“
- Der Umgang der Nachkriegsgeneration mit der NS-Vergangenheit
- Der Generationenkonflikt und seine Auswirkungen
- Die Rolle der Literatur in der Vergangenheitsbewältigung
- Die Frage nach der Möglichkeit einer „Sehnsucht nach Unmöglichem“ in Bezug auf Versöhnung und Vergebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Vergangenheitsbewältigung in der deutschen Nachkriegsliteratur ein und hebt die Bedeutung der Schuldfrage hervor. Sie beschreibt die unterschiedlichen literarischen Ansätze zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, von der Glorifizierung des Soldatentums bis hin zur Aufarbeitung des Holocausts in den Nachkriegsjahrzehnten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der literarischen Auseinandersetzung mit dem Thema und der Einordnung von Schlinks „Der Vorleser“ in diesen Kontext als einen neuen Blickwinkel auf den Umgang der jüngeren Generation mit der Schuld der Älteren. Die Einleitung betont die Aktualität des Themas und seinen Einfluss auf die heutige Generation.
2. Schuldfrage und Kollektivschuld: Dieses Kapitel untersucht verschiedene philosophische und historische Perspektiven auf die Schuldfrage im Kontext des Nationalsozialismus. Es analysiert Jaspers' Kategorien der Schuld (kriminell, politisch, moralisch, metaphysisch) und diskutiert die Frage nach Kollektivschuld. Die Diskussion von Goldhagen's Werk "Hitler's Willing Executioners" wird ebenfalls einbezogen, um verschiedene Argumentationslinien zu präsentieren und die Komplexität der Thematik zu beleuchten. Die Kapitel erörtert das Spannungsfeld zwischen individueller Verantwortung und den strukturellen Bedingungen, die die Verbrechen des NS-Regimes ermöglichten. Das Kapitel hinterfragt die Möglichkeit einer eindeutigen Antwort auf die Existenz einer Kollektivschuld.
Häufig gestellte Fragen zu „Der Vorleser“ - Inhaltsanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser“ im Kontext der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Schuld und Verantwortung, dem Generationenkonflikt und der Frage nach der Möglichkeit einer erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung im Nachkriegsdeutschland.
Welche Themen werden im Roman „Der Vorleser“ behandelt?
Der Roman behandelt zentrale Themen wie die individuelle und kollektive Schuld im Zusammenhang mit dem Holocaust, den Umgang der Nachkriegsgeneration mit der NS-Vergangenheit, den Generationenkonflikt und die Rolle der Literatur in der Vergangenheitsbewältigung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage nach der Möglichkeit von Versöhnung und Vergebung.
Welche Perspektiven auf die Schuldfrage werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene philosophische und historische Perspektiven auf die Schuldfrage, einschließlich der Kategorien der Schuld nach Karl Jaspers (kriminell, politisch, moralisch, metaphysisch) und Daniel Goldhagens These der „willigen Vollstrecker“ Hitlers. Die Komplexität des Themas wird durch die Gegenüberstellung verschiedener Argumentationslinien beleuchtet.
Wie wird Hannas Schuld im Roman dargestellt?
Die Analyse beleuchtet Hannas Schuld im Detail, untersucht mögliche Gründe für ihre Verbrechen, ihren Umgang mit ihrer Schuld und die Folgen dieses Umgangs. Die Rolle ihres Analphabetismus und die Bedeutung von Literatur im Kontext ihrer Schuld werden ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielt der Generationenkonflikt im Roman?
Der Roman zeigt deutlich einen Generationenkonflikt zwischen Michael, der Nachkriegsgeneration, und Hanna, die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieses Konflikts auf die Vergangenheitsbewältigung.
Wie wird die Frage der Vergangenheitsbewältigung im Roman dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie der Roman die Frage nach der Möglichkeit einer erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung stellt. Der Begriff „Sehnsucht nach Unmöglichem“ wird in diesem Zusammenhang diskutiert, um die Herausforderungen und Grenzen des Versöhnungsprozesses zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was sind deren Schwerpunkte?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Schuldfrage und Kollektivschuld (mit Unterkapiteln zu Jaspers, Goldhagen und philosophisch-psychologischen Aspekten), Zur Schuldfrage in „Der Vorleser“ (mit Fokus auf Hannas und Michaels Schuld), Generationenkonflikt und Mythos der „Gnade der späten Geburt“, Vergangenheitsbewältigung - „Sehnsucht nach Unmöglichem?“, und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der oben genannten Themen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Schuld und Verantwortung in „Der Vorleser“ zu analysieren und den Umgang der Nachkriegsgeneration mit der NS-Vergangenheit zu untersuchen. Sie beleuchtet den Generationenkonflikt, die Rolle der Literatur in der Vergangenheitsbewältigung und die Frage nach der Möglichkeit einer „Sehnsucht nach Unmöglichem“ in Bezug auf Versöhnung und Vergebung.
- Quote paper
- Daniela Schroeder (Author), 1999, Sehnsucht nach Unmöglichem? Zum Thema Vergangenheitsbewältigung am Beispiel von Bernhard Schlinks ´Der Vorleser´, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1820