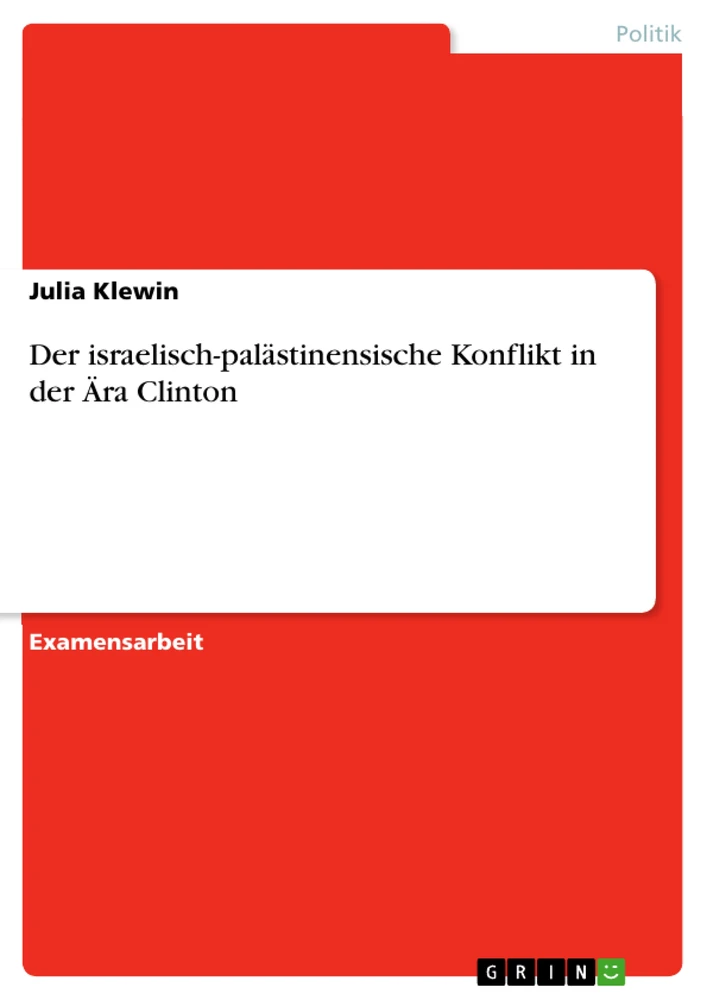1. Einleitung
Am 14. September 1993 titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung:
„Großer Schritt zum Frieden im Nahen Osten“1 und kommentierte somit
den historischen Händedruck zwischen Yitzhak Rabin und Yassir Arafat
auf dem Rasen vor dem Weißen Haus in Washington. Es war der
Schlusspunkt der Verhandlungen, auf die schließlich die feierliche Unterzeichnung der Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung der palästinensischen Autonomiegebiete folgte. Nachdem der israelische Ministerpräsident und der Vorsitzende der Palestine Liberation Organization kurze Erklärungen zu den in Oslo ausgehandelten Zielen abgegeben hatten, reichten sich die beiden Staatsmänner die Hände und schufen somit ein Bild, das in kürzester Zeit um die Welt ging und gleichzeitig zum Sinnbild für den erhofften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern wurde. „Für viele Beobachter war dies ein historischer Moment, der den Anfang vom Ende des israelischpalästinensischen Konfliktes symbolisierte“. Die Erwartungen an die Verhandlungsführer waren groß und ließen die Hoffnung auf eine friedvolle Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes ins Unermessliche steigen. Die Verleihung des Friedensnobelpreises im Dezember 1994 an Rabin und Arafat unterstrich diese positive Stimmung und ließ zum ersten Mal seit der Intifada der Jahre 1987-1993 wahre Zuversicht aufkommen.
Fast genau sieben Jahre nach dem historischen Händedruck
wurden eben diese Hoffnungen auf ein friedliches Ende des Konfliktes
begraben, als einen Tag nach dem Besuch des israelischen Oppositionsführers Ariel Sharon auf dem Tempelberg am 28. September 2000 Unruhen und bewaffnete Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern ausbrachen. Der zweiten Intifada, die erst am 8. Februar 2005 mit einer Waffenruhe beendet wurde, fielen tausende Menschen zum Opfer.
Die deutsche Sozialwissenschaftlerin Margret Johannsen sieht in dieser Gewalteskalation während der so genannten al-Aqsa-Intifada sogar den Grund für das Zerbrechen des gesamten Friedensprozesses.
Mit der vorliegenden Arbeit soll der oben beschriebene Weg von
der Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten zur großen Enttäuschung
untersucht werden. Vorzugsweise richtet sich dabei das Augenmerk auf
den Einfluss und die besondere Rolle der USA während der Amtsperiode
des US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung: Frieden - Konflikt - Krieg
- Eine Analyse des israelisch-palästinensischen Konflikts
- Konfliktgegenstände und -ursachen
- Ein- vs. Zweistaatlichkeit
- Flüchtlinge
- Jerusalem
- Siedlungen & Grenzverlauf
- Die USA und ihre Rolle im Nahostkonflikt
- Konfliktgegenstände und -ursachen
- Von Hoffnung zu Enttäuschung – Der Verlauf des Friedensprozesses und die Beteiligung der USA
- Die Prinzipienerklärung
- Die Oslo-Abkommen
- Yitzhak Rabins Ermordung
- Der Besuch Ariel Scharons auf dem Tempelberg
- Die Aussichten auf Frieden eine Dekade nach der Ära Clinton - ein Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des israelisch-palästinensischen Konflikts während der Präsidentschaft von Bill Clinton, mit dem Fokus auf die Rolle der USA im Friedensprozess. Sie analysiert den Verlauf der Verhandlungen, die Hoffnung auf Frieden, die durch den historischen Händedruck zwischen Rabin und Arafat geweckt wurde, und die spätere Eskalation der Gewalt. Die Arbeit untersucht, welche Faktoren zum Scheitern des Friedensprozesses beigetragen haben und ob Clinton als Vermittler einen größeren Einfluss hätte ausüben können.
- Der Einfluss der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt
- Der Verlauf des Friedensprozesses in der Ära Clinton
- Die Rolle von Schlüsselpersonen wie Yitzhak Rabin und Yassir Arafat
- Die Ursachen für das Scheitern des Friedensprozesses
- Die Auswirkungen des Konflikts auf die Region
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts und den Fokus der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Begriffe Frieden, Konflikt und Krieg und liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse des Konflikts. Kapitel drei befasst sich mit einer Analyse des israelisch-palästinensischen Konflikts, indem es die Konfliktgegenstände und -ursachen beleuchtet. Kapitel vier widmet sich dem Verlauf des Friedensprozesses in der Ära Clinton, inklusive der Prinzipienerklärung, den Oslo-Abkommen, der Ermordung Rabins und dem Besuch Ariel Scharons auf dem Tempelberg. Abschließend befasst sich das fünfte Kapitel mit den Aussichten auf Frieden eine Dekade nach der Ära Clinton.
Schlüsselwörter
Der israelisch-palästinensische Konflikt, Friedensprozess, Nahostkonflikt, USA, Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Yassir Arafat, Oslo-Abkommen, Prinzipienerklärung, Tempelberg, Zweistaatenlösung, Einstaatenlösung, Flüchtlinge, Siedlungen, Grenzverlauf.
- Quote paper
- Julia Klewin (Author), 2011, Der israelisch-palästinensische Konflikt in der Ära Clinton, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/181663