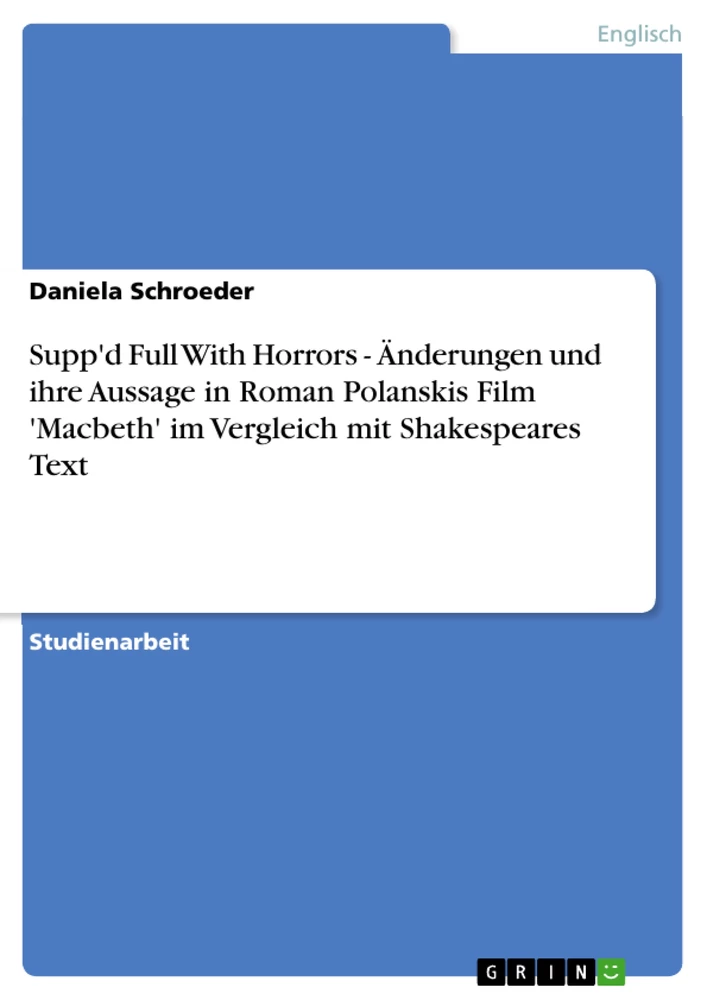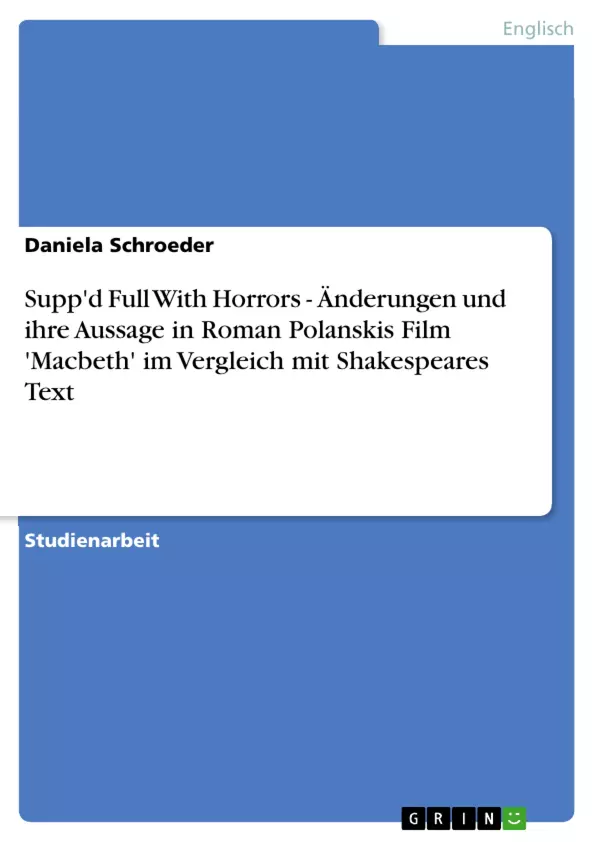Roman Polanskis Verfilmung des Macbeth aus dem Jahre 1971 ist sicher auch die blutigste. Die extensive Darstellung von Gewalt wurde stets auf die Biographie Polanskis bezogen. Geboren im August 1933 verbrachte der Regisseur seine Kindheit und Jugend im Krakauer Ghetto, von wo aus er kurz vor dessen Liquidierung entkam. Die Mutter starb im Konzentrationslager; er selbst floh vor den Nazis durch ganz Polen. Das andere prägende Ereignis seines bisherigen Lebens war die brutale Ermordung seiner zweiten Frau Sharon Tate, damals im achten Monat schwanger, und einigen engen Freunden 1969 in Polanskis Haus in Los Angeles durch Mitglieder der Kultbande "Manson-family". Erlebnisse, die der polnische Filmemacher zweifellos mithilfe seiner Werke zu bewältigen versucht hat.
Hinter der bluttriefenden Verfilmung des Macbeth durch Roman Polanski scheint aber mehr zu stecken. Der Film weicht in verschiedenen Punkten deutlich von der Vorlage Shakespeares ab. Wäre der Regisseur nur davon geleitet gewesen, seine tragische Biographie aufzuarbeiten, dann wäre ihm das auch ohne die Eingriffe in den Originaltext gelungen, da Shakespeare bereits genug Gewaltpotential im Text angelegt hat. Thema dieser Arbeit soll es daher sein, die Änderungen, die Polanski am Text, an Sprache, Handlung und an den Charakterkonzeptionen vorgenommen hat, zu analysieren und ihre Folgen für die Gesamtaussage des Films zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen wird dabei die Frage, ob in diesen Änderungen eine bestimmte Lesart des Dramas erkennbar wird und wenn ja, wodurch sie gekennzeichnet ist, bzw. inwiefern sie von Shakespeares Stück abweicht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Umsetzung des Originaltextes
- Durch den Medienwechsel bedingte Veränderungen
- Subjektive Veränderungen des Regisseurs
- Streichungen und Kürzungen des Textes
- Frei gewählte Visualisierungen einzelner Handlungselemente
- Änderungen in der Sprache
- Eingriffe in die Struktur der Handlung
- Änderungen der Charakterzeichnungen
- Lady Macbeth
- Die Jugend der Macbeths im Film
- Hexen
- Rosse
- Malcolm
- Konsequenzen der Änderungen für die Gesamtaussage des Films
- Die Dominanz des foul
- Die Sinnlosigkeit des Lebens im Angesicht von Gewalt
- Deckung der Interpretation durch den Shakespeare-Text
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Änderungen, die Roman Polanski in seiner 1971er Verfilmung von Shakespeares Macbeth vorgenommen hat. Im Fokus steht der Vergleich zwischen Film und Originaltext, insbesondere die Frage, ob und wie Polanskis Eingriffe in Text, Sprache, Handlung und Charaktere die Gesamtaussage des Films beeinflussen und eine spezifische Interpretation des Dramas hervorbringen.
- Analyse der durch den Medienwechsel bedingten Veränderungen.
- Untersuchung der subjektiven Veränderungen Polanskis, insbesondere von Streichungen und Kürzungen.
- Bewertung der Auswirkungen dieser Änderungen auf die Charakterisierung der Figuren.
- Erforschung des Einflusses der Änderungen auf die Gesamtaussage des Films.
- Vergleich der Interpretation des Films mit Shakespeares Originaltext.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt Roman Polanskis Macbeth-Verfilmung als besonders brutal und stellt die Frage nach den Beweggründen für die Abweichungen vom Originaltext. Es wird die These aufgestellt, dass die zahlreichen Änderungen nicht allein auf Polanskis Biografie zurückzuführen sind, sondern auch eine bestimmte Lesart des Dramas zum Ausdruck bringen.
Umsetzung des Originaltextes: Dieses Kapitel untersucht zunächst die unvermeidlichen Veränderungen durch den Medienwechsel vom Theaterstück zum Film. Es wird die Interpretationsfreiheit des Lesers dem eingeschränkten Blickwinkel des Zuschauers gegenübergestellt. Anschließend werden die subjektiven Eingriffe Polanskis analysiert, wobei die Auslassung eines Drittels des Originaltextes hervorgehoben wird. Der Fokus liegt auf der Frage, wie diese Auslassungen und Veränderungen die Interpretation des Werks beeinflussen.
Subjektive Veränderungen des Regisseurs: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit den vom Regisseur vorgenommenen Eingriffen. Die Streichungen und Kürzungen werden analysiert, wobei besonders die Entfernung positiver Gegenwelten und die Fokussierung auf die allgegenwärtige Gewalt im Mittelpunkt stehen. Die Auslassung von Szenen, die einen positiven Kontrast zu Macbeths Tyrannei bieten, wird im Detail erläutert und deren Bedeutung für die Gesamtwirkung des Films diskutiert.
Schlüsselwörter
Roman Polanski, Macbeth, Shakespeare, Verfilmung, Medienwechsel, Gewalt, Interpretation, Charakterzeichnung, Textanalyse, Filmsprache.
Häufig gestellte Fragen zu Roman Polanskis Macbeth-Verfilmung
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert Roman Polanskis 1971er Verfilmung von Shakespeares Macbeth. Im Fokus steht der Vergleich zwischen Film und Originaltext und die Frage, wie Polanskis Änderungen die Gesamtaussage des Films beeinflussen und eine spezifische Interpretation des Dramas hervorbringen.
Welche Aspekte der Verfilmung werden untersucht?
Die Analyse untersucht die durch den Medienwechsel bedingten Veränderungen, Polanskis subjektive Eingriffe (Streichungen, Kürzungen, Visualisierungen, Änderungen in Sprache und Handlungsstruktur, sowie Veränderungen der Charakterzeichnungen), die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Charakterisierung der Figuren und die Gesamtaussage des Films, sowie einen Vergleich der Interpretation des Films mit Shakespeares Originaltext.
Welche konkreten Änderungen werden im Detail betrachtet?
Die Analyse befasst sich detailliert mit Streichungen und Kürzungen im Film, insbesondere der Entfernung positiver Gegenwelten und der Fokussierung auf die allgegenwärtige Gewalt. Die Auslassung von Szenen, die einen positiven Kontrast zu Macbeths Tyrannei bieten, wird im Detail erläutert und deren Bedeutung für die Gesamtwirkung des Films diskutiert. Auch Änderungen an den Charakteren Lady Macbeth, der Jugend der Macbeths, den Hexen, Rosse und Malcolm werden untersucht.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Dominanz des "foul" (des Bösen), die Sinnlosigkeit des Lebens im Angesicht von Gewalt, der Einfluss des Medienwechsels (Theater zu Film) auf die Interpretation, und die subjektive Interpretationsfreiheit des Regisseurs im Vergleich zur eingeschränkten Perspektive des Zuschauers.
Wie wird die Interpretation des Films mit dem Originaltext verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Interpretation, die Polanskis Film vermittelt, mit Shakespeares Originaltext. Es wird untersucht, inwiefern die vorgenommenen Änderungen eine spezifische Lesart des Dramas unterstützen oder hervorbringen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Roman Polanski, Macbeth, Shakespeare, Verfilmung, Medienwechsel, Gewalt, Interpretation, Charakterzeichnung, Textanalyse, Filmsprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, ein Kapitel zur Umsetzung des Originaltextes (einschließlich der Analyse der subjektiven Veränderungen des Regisseurs), ein Kapitel zu den Konsequenzen der Änderungen für die Gesamtaussage des Films, ein Kapitel zur Deckung der Interpretation durch den Shakespeare-Text und eine Schlussbemerkung. Der Aufbau wird auch detailliert im Inhaltsverzeichnis dargestellt.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die zahlreichen Änderungen in Polanskis Macbeth-Verfilmung nicht allein auf Polanskis Biografie zurückzuführen sind, sondern auch eine bestimmte Lesart des Dramas zum Ausdruck bringen.
- Quote paper
- Daniela Schroeder (Author), 2000, Supp'd Full With Horrors - Änderungen und ihre Aussage in Roman Polanskis Film 'Macbeth' im Vergleich mit Shakespeares Text, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1816