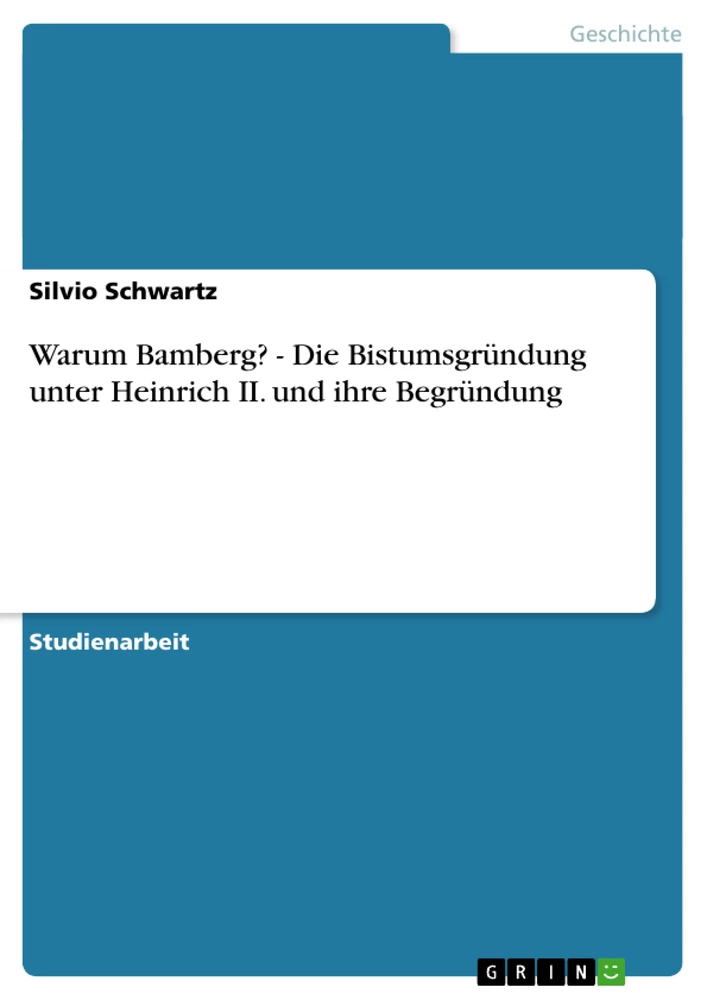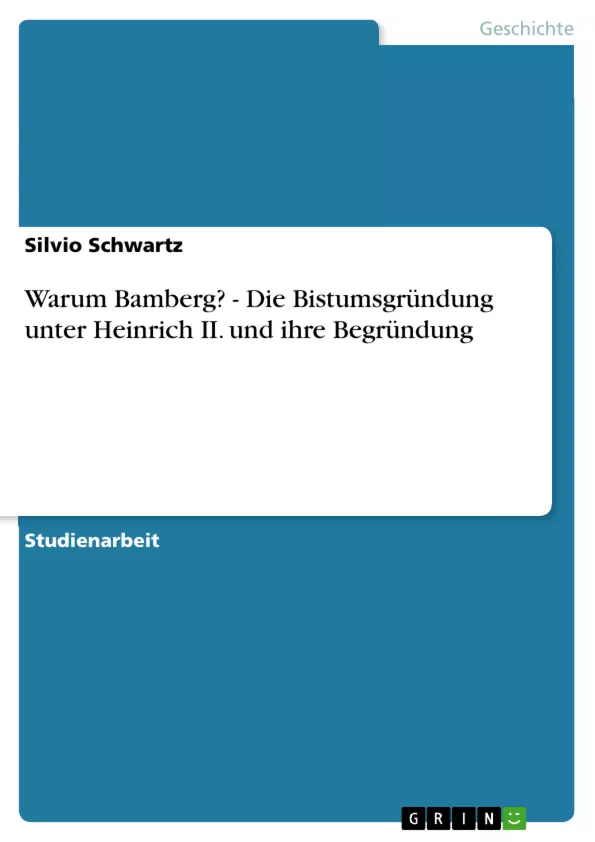Am 7. Juni 1002 wurde Heinrich IV., Herzog von Bayern, als letzter Liudolfinger zum König Heinrich II. gesalbt. Wie bei keinem anderen Herrscher des Mittelalters hat es bei ihm eine intensive „Funktionsgemeinschaft“ zwischen König und Bischöfen gegeben – dementsprechend ist bei ihm ein Wechsel von der Königspfalz zur Bischofsstadt nachzuvollziehen. Dabei griff er selbst in vorhandene Strukturen ein: Als Bischöfe setzte er Mitglieder seiner Hofkapelle ein, das Bistum Merseburg wurde 1004 von ihm wieder hergestellt und mit Bamberg gründete er 1007 „ein neues religiöses Zentrum seines Königtums“. Dabei stellt sich die Frage, wie in der Chronik des Bischofs Thietmars von Merseburg, einem Zeitgenossen Heinrichs II., und in Urkunden zur Gründung das neue Bistum begründet wird. Welche Motivationen und Hintergründe liegen dabei den Darstellungen selbst zugrunde?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Akte
- Zustimmung
- Weihungen
- Antriebskräfte
- Persönliche Motive
- Weitere Motive
- Schluss
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gründung des Bistums Bamberg unter Heinrich II. im Jahr 1007. Sie analysiert die formalen Akte der Gründung, die Zustimmung der Bischöfe und die Weihungen des neuen Bistums. Darüber hinaus werden die persönlichen und weiteren Motive Heinrichs II. für die Gründung beleuchtet.
- Formale Akte der Bistumsgründung
- Zustimmung der Bischöfe
- Weihungen des Bistums
- Persönliche Motive Heinrichs II.
- Weitere Motive für die Gründung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bistumsgründung unter Heinrich II. ein und stellt die Forschungsfrage nach der Begründung des neuen Bistums in der Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und in Urkunden zur Gründung.
Das Kapitel „Formale Akte“ behandelt die Zustimmung der Bischöfe zur Gründung. Es wird die Rolle des Bischofs Heinrich von Würzburg und die Verhandlungen mit ihm beleuchtet. Die Frankfurter Synode von 1007, auf der die Zustimmung der Bischöfe erwirkt wurde, wird detailliert beschrieben.
Das Kapitel „Weihungen“ befasst sich mit den Weihungen des neuen Bistums. Es wird die Bedeutung des Heiligen Petrus für die Gründung hervorgehoben und die Rolle der Schenkungen und Weihungen im Zusammenhang mit der Gründung des Bistums erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bistumsgründung, Heinrich II., Thietmar von Merseburg, Bischöfe, Zustimmung, Weihungen, Petrus, Rombezug, Seelenheil, Schenkungen, Frankfurter Synode, Bischofsstab, Kirchenrecht, Macht, Motivationen, Hintergründe.
- Quote paper
- Silvio Schwartz (Author), 2006, Warum Bamberg? - Die Bistumsgründung unter Heinrich II. und ihre Begründung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/181445