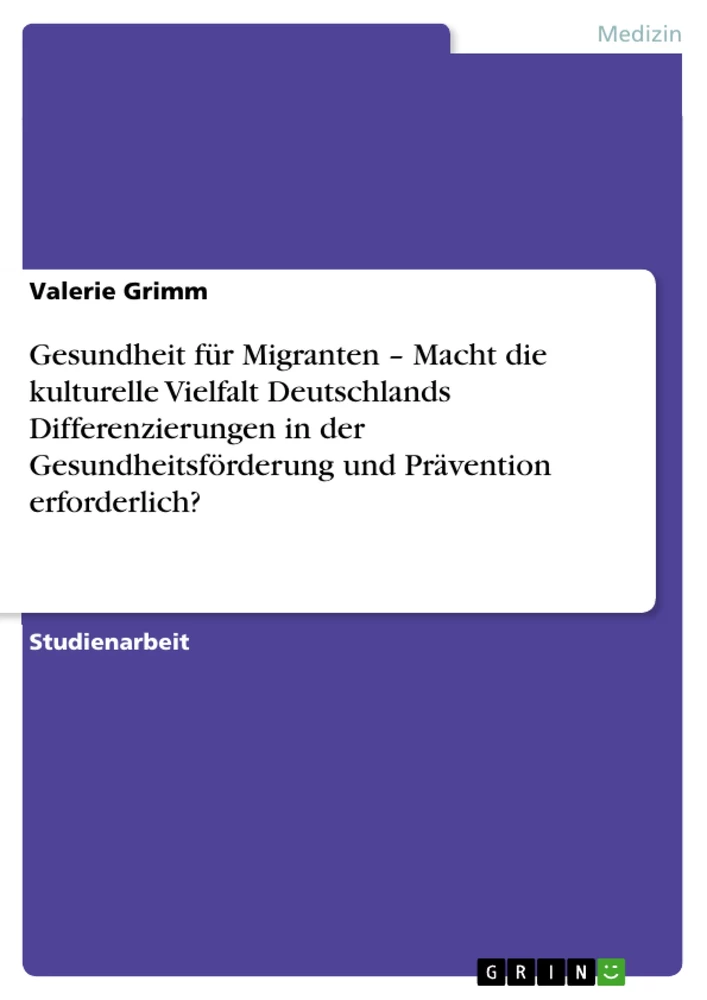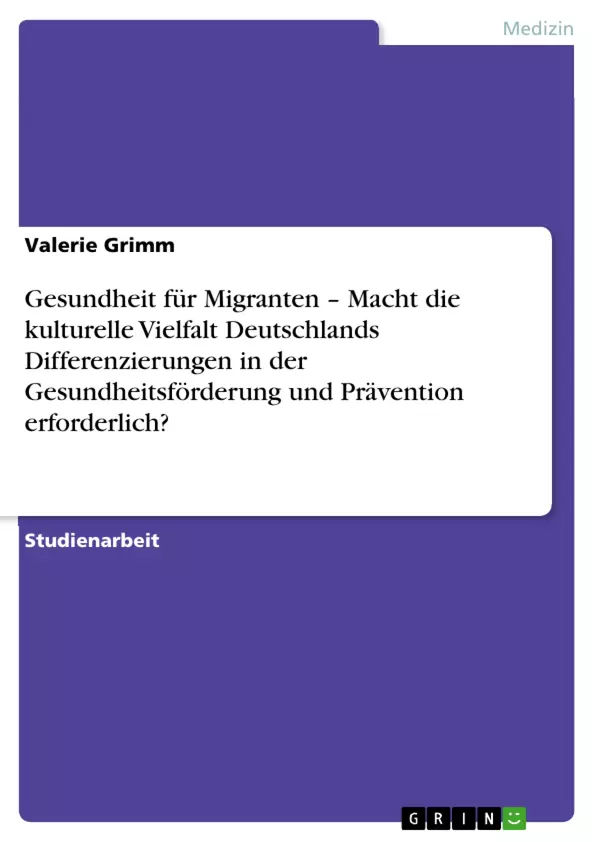„Integration macht gesund.“ Mit dieser Aussage eröffnete Marieluise Beck die Fachtagung „Gesunde Integration“, welche am 20. und 21. Februar 2003 in Berlin stattfand. Sie erläutert diese auf den ersten Blick erstaunliche Behauptung damit, dass Integration „gleiche Teilhabe in allen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen“ voraussetze, und damit auch oder bzw. gerade im Gesundheitswesen. Soweit die Theorie.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass ein gleicher Zugang zur gesundheitlichen Versorgung bzw. zu den Leistungen des Gesundheitssystems für Migranten in Deutschland bis heute noch lange keine Selbstverständlichkeit darstellt. Auch im 21. Jahrhundert werden die Art und die Qualität von medizinisch notwendigen Behandlungen in signifikantem Maß von der nationalen Herkunft des Patienten bestimmt. Sprachliche Barrieren sowie kulturelle Besonderheiten von Menschen mit Migrationshintergrund machen es für medizinisches Fachpersonal oft schwer, eine adäquate medizinische Diagnose bzw. Therapie zu stellen/verordnen. Noch immer werden spezifische Präventionsangebote für Migranten nicht flächendeckend angeboten und diese „Zielgruppe“ somit oftmals in den Regelangeboten der Gesundheitsdienste vernachlässigt bzw. zu „Patienten zweiter Klasse“ degradiert. (Vgl. BBMFI 2003: 8)
Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland lässt sich jedoch erkennen, dass nicht nur der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtheit zunimmt, sondern zudem die Aufenthaltsdauer steigt. Durch den hohen Anteil von Kindern und der steigenden Zahl von Personen in den höheren Altersgruppen erlangen Menschen mit Migrationshintergrund somit zunehmende Bedeutung als Nutzer des deutschen Gesundheitssystems; zudem können möglicherweise erhöhte Gesundheitsrisiken diese Entwicklung verstärken. (Vgl. RKI 2008: 7)
Zum Aufbau dieser Arbeit:
In Kapitel zwei wird zunächst eine Begriffsbestimmung von „Migranten“ vorgenom-men und aktuelle Zahlen und Daten zu der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund in Deutschland präsentiert. Darauf folgt eine Darstellung über mögliche Zusammen-hänge zwischen Migration, sozialer Lage und Gesundheit sowie migrationsspezifische Gesundheitsbelastungen und – ressourcen.
In Kapitel drei wird die aktuelle Gesundheitsversorgung für Menschen mit Migrati-onshintergrund kritisch beleuchtet; es soll erörtert werden, inwiefern sich der Gesundheitszustand von Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland
- „Migration“ und „Menschen mit Migrationshintergrund" - Begriffsbestimmung
- Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland - Zahlen und Daten
- Zusammenhang zwischen Migration, sozialer Lage und Gesundheit
- Migrationsspezifische Gesundheitsbelastungen und -ressourcen
- Gesundheitsversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund
- Prävention für Menschen mit Migrationshintergrund
- Zugangsbarrieren zur Prävention bei Menschen mit Migrationshintergrund
- Voraussetzungen für effektive und problemorientierte Präventionsarbeit
- Präventionsprojekte in Deutschland - eine exemplarische Auswahl
- Praxisbeispiel Afrika - Sprechstunde
- Praxisbeispiel MiMi - Projekt
- Praxisbeispiel Initiative zur Prävention von Übergewicht in türkischen Familien
- Schlussfolgerung: Stand der Prävention für Menschen mit Migrationshintergrund
- Perspektiven für die Praxis, Zusammenfassung und Fazit
- Literatur
- Sekundär- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob die kulturelle Vielfalt Deutschlands Differenzierungen in der Gesundheitsförderung und Prävention für Migranten erforderlich macht. Sie analysiert die aktuelle Situation der Gesundheitsversorgung und Prävention für Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der kulturellen Vielfalt ergeben.
- Begriffsbestimmung von „Migration“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“
- Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken von Migranten in Deutschland
- Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung und Prävention für Migranten
- Effektivität und Optimierung von Präventionsangeboten für Migranten
- Perspektiven für eine inklusive Gesundheitsförderung und Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei befasst sich mit der Definition von „Migration“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“ und präsentiert aktuelle Zahlen und Daten zur Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund in Deutschland. Es werden mögliche Zusammenhänge zwischen Migration, sozialer Lage und Gesundheit sowie migrationspezifische Gesundheitsbelastungen und -ressourcen beleuchtet.
Kapitel drei analysiert die aktuelle Gesundheitsversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und untersucht, inwiefern sich der Gesundheitszustand von Migranten von dem der deutschen Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Es werden die besonderen Gesundheitsbelastungen von Migranten und die Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung erörtert.
Kapitel vier diskutiert zielgruppenspezifische Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen für Migranten. Es werden drei exemplarische gesundheitsförderliche Maßnahmen vorgestellt und die Effektivität der gegenwärtigen Präventionsangebote für Migranten bewertet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Migration, Menschen mit Migrationshintergrund, Gesundheitsförderung, Prävention, kulturelle Vielfalt, Gesundheitsversorgung, Zugangsbarrieren, Gesundheitsrisiken, Präventionsangebote, Inklusion.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Valerie Grimm (Author), 2011, Gesundheit für Migranten – Macht die kulturelle Vielfalt Deutschlands Differenzierungen in der Gesundheitsförderung und Prävention erforderlich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/181438